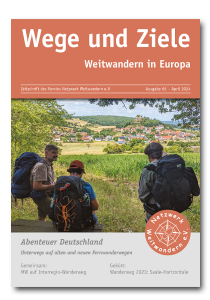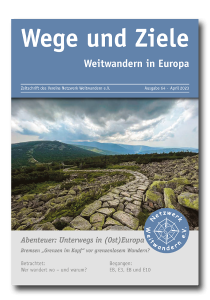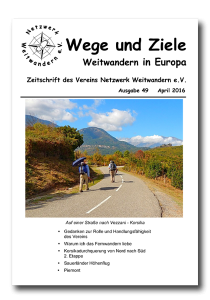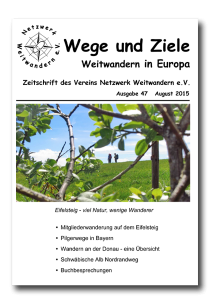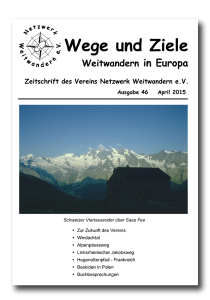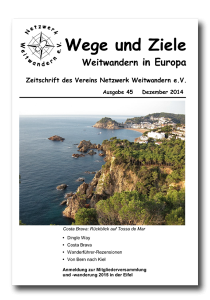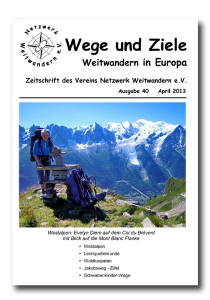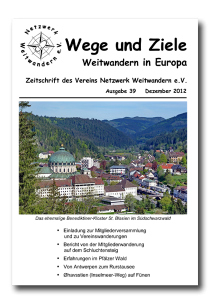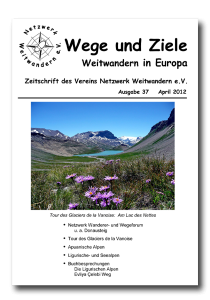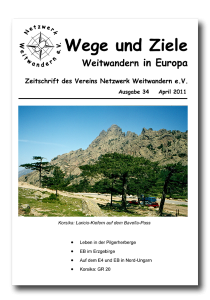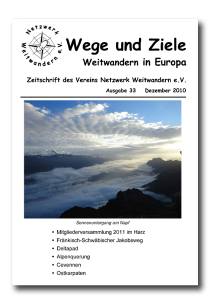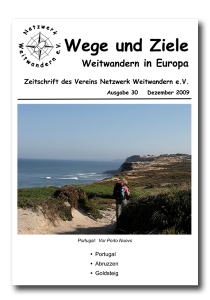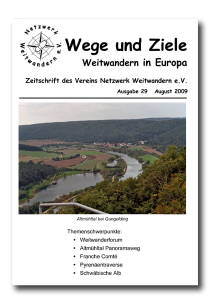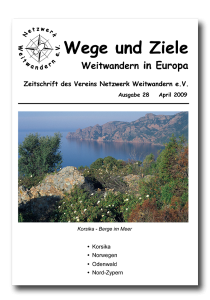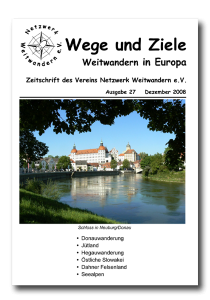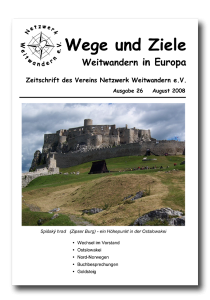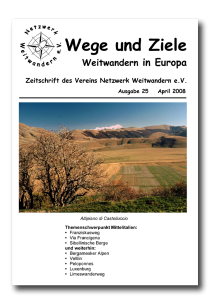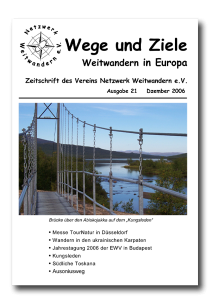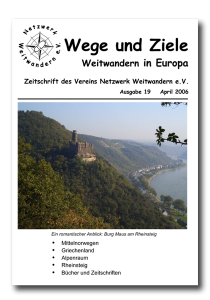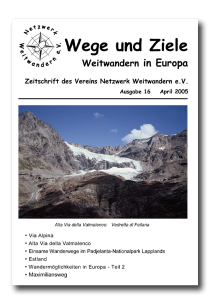In dem abgegriffenen Heft steht es schwarz auf weiß, einst haben hier Bauern gelebt. In dieser Einsamkeit hoch oben am Polarkreis, unter dem Eis des Svartissen, des größten Gletschers in Norwegen. Acht Tage bin ich unterwegs, fünf mal habe ich Menschen getroffen. Kein Land für Bauern ist das. Aber Twylee Anderson Baviere aus den USA weiß es besser, am 11. Juli 1998 notiert sie in das Hüttenbuch eine kleine Geschichte: 1890 verlässt Anders Anderson mit seiner Frau Beret Strandfjord und der 14-jährigen Tochter Anna Christine den Hof, gibt die Landwirtschaft unter den unwirtlichen Bedingungen des Saltfjellet auf, wandert nach Amerika aus. Die Enkelin von Anna Christine aber kommt zurück und schaut sich noch einmal an, wo ihre Urgroßeltern einst einen stattlichen Hof bewirtschaftet haben, den Hof Granneset.
Nachdenklich lese ich die Zeilen in dem abgegriffenen Heft. Die vergangene Woche hat mich gelehrt, wie schwierig das Leben hier oben am Polarkreis wohl war. Und dabei wandere ich eigentlich nur gemütlich durch diese herrliche Landschaft. Aber was heißt hier schon Wandern. Vorwärts kämpfen ist der richtige Ausdruck.
Das beginnt schon am ersten Tag, als ich am Bahnhof Lønsdal aufbreche. Bahnhof heißt hier im Norden auch wirklich Bahnhof. Mehr gibt es da nämlich nicht, außer eben diesem kleinen Bahnhofsgebäude aus Holz. Quer über die Schienen und durch Krüppelbirken den Hang hoch. Immer wieder führt die knallig rote Markierung mitten in den Sumpf. Von einem festen Hügelchen zum nächsten balanciere ich vorwärts, rechts in den Büschen singt ein Regenpfeifer sein trauriges Lied. Schritt für Schritt bekomme ich Routine, ahne die Steine im Sumpf, die einen festen Tritt garantieren. Und wenn die Ahnung trügt, stecke ich bis zum Knöchel im Morast, bringe das Bein fast nicht mehr heraus, drohe umzukippen, während eiskaltes Wasser sich den Weg durch die Socken zur Haut bahnt.
Mit dem gemütlichen Wandern in den Mittelgebirgen hat die Realität Norwegens hier am Polarkreis wenig zu tun. Allein schon, weil die Übergänge zwischen den Hütten ewig lange sind, acht, neun Stunden laufe ich meistens am Tag, die Pausen sind da noch nicht mit eingerechnet. Also, morgens um sieben los, abends um sieben ankommen – wenn alles gut geht. Aber zwischen allen Strapazen dann diese kleinen Erlebnisse, die mir beweisen, wie richtig es war, hierher zu kommen, wie schön dieses Saltfjellet doch ist. Husch, hüpfen vier Schneehühner keine drei Meter vor mir in die Höhe, trappeln rasend schnell davon. So lautlos rennen die Vögel, dass ich sie gleich wieder aus den Augen verliere, weil ihr Gefieder mit der Monotonie aus Granitbrocken und Flechten verschwimmt, die in rund tausend Metern über Normalnull das sogenannte Kahlfjell bildet.
Ganz am Ende der langen Etappe, keine halbe Stunde vor der Hütte, heißt es dann Schuhe ausziehen. Bis zu den Knien geht der Raudis-Fluss , den ich durchwaten muss. Eiskalt und reißend das Wasser, am Ende eines anstrengenden Tages kühlen die Füße in einer Art Kneippkur noch mal ab. Hoch über dem Fluss liegt dann die Hütte, Saltfjellstua heißt sie. Wie fast immer auf der Wanderung habe ich sie für mich allein, obwohl es zehn oder auch vierzehn Betten gibt, in die ich meinen Schlafsack legen kann. Trink- und Kochwasser aus dem Fluss holen, Holz sägen und ran schleppen, ein Vollbad im eiskalten Wasser, mit klappernden Zähnen essen kochen, längst ist es dunkel, bis ich endlich Zeit für ein paar Zeilen in das Hüttenbuch finde. Und doch habe ich den Eindruck, einen wundervollen Tag erlebt zu haben. Ohne einer einzigen Menschenseele zu begegnen.
Wo am ersten Tag auf der Höhe noch endlose Blockfelder über etliche Stunden Sohlen und Konzentration ruinierten, stellen am zweiten Tag vor der Bejarstua endlose Sümpfe meine Geduld am Ende einer weiteren Acht-Stunden-Etappe auf eine harte Probe. Quatschend sinke ich ein, zum Glück nie tiefer als bis zu den Knöcheln, ziehe glucksend die Schuhe mit einiger Anstrengung wieder heraus. Langsam aber sicher weicht das Leder durch. Meine Geduld ist auch bald durch, als ich endlich die Hütte erreiche. Dort treffe ich auch erstmals wieder Menschen, Norweger. Gleich neben der Hütte gibt es eine Straße, die einige Bauernhöfe im Tal versorgt.
Über sein Handy bestellt mir der Norweger ein Taxi, das mich am nächsten Morgen zwanzig Kilometer das Tal hinauf fährt. Dort endet die Straße, die Einsamkeit des Nordens hat mich wieder. Durch Birkenwald weiter das Tal hinauf. Äste peitschen um die Schultern, an den Zweigen hängen vom Regen der Nacht noch Tropfen, durchnässen Hemd, Hose und Schuhe. Zumindest Hemd und Hose trocknet die Hitze schnell wieder, die mein Körper beim steilen Aufstieg produziert. Durch Felsstürze und über Grashänge zieht sich die Markierung bis auf einen 918 Meter hohen Gipfel. Gletscher kommen irgendwo aus den Wolken, die heute die Gipfel verhüllen, strömen bis auf sieben- oder sechshundert Meter über Normalnull ins Tal.
Wege gibt es hier nirgends. Es lohnt einfach nicht, welche anzulegen, laufen doch allenfalls fünfzig Menschen im Jahr hier entlang. Diese wenigen Wanderer aber erleben ein phantastisches Panorama, wenn sie eine Stunde nach dem Gipfel den Bogvatnet erreichen. Milchig grünblau schimmert das endlose Wasser des Sees zwischen dunklen Granitgipfeln, zwischen denen mächtige Schnee und Eisfelder aufblitzen, die bis zum See in 661 Metern hinunter fließen. Hier könnte man auch nächtigen, eine Notunterkunft gibt es. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen “Not”. Wacklige Steinmauern sind das, siebzig Zentimeter hoch, darüber ein Wellblechdach, das Ganze kaum breit genug für einen Biwaksack. Na ja, zumindest wasserdicht ist das Gebilde ein wenig.
Ich aber laufe weiter, immer am Ufer des Bogvatnet entlang. Über federnde Wiesen und Kiesstrand, über Blockfelder und über etliche Bäche springend, immer unter den Gletscherzungen entlang, die aus den Wolken zum See herunter hängen. Ewig zieht sich der See, zwei Stunden brauche ich bis zum Ausfluss, den ich laut Führer überqueren soll. Das tue ich auch, zumindest im zweiten Anlauf schaffe ich es. Nur mit Armbanduhr und Rucksack bekleidet stehe ich in der eiskalten, reißenden Strömung. Flussabwärts donnern Stromschnellen und Wasserfälle über zerklüftete Felsen talwärts. Nachsinnieren hilft nicht weiter, direkt am Ausfluss vom See ist das Wasser nicht so tief. Also Schritt für Schritt vorwärts. Bis zum Gesäß reicht das eisige Wasser. Ohne Wanderstöcke würde mich die reißende Strömung wohl umreißen. Zwar baumelt der Hüftgurt meines Rucksacks lose umher, den Rucksack könnte ich also schnell loswerden, wenn es mich wirklich erwischt. Aber vorher wäre ich wohl an einem der Felsen zerschmettert. Nicht dran denken. Vorsichtig weiter. Ohne Wanderstöcke und Neopren-Sandalen wäre ich aufgeschmissen. So kann ich zumindest immer auf wenigstens drei Beinen stehen und habe sicheren Halt. Und schaffe es tatsächlich bis zum anderen Ufer. Bibbernd schlüpfe ich in die Klamotten. Bin froh, dass nichts passiert ist. Denn Hilfe kann ich hier keine erwarten.
Am anderen Ufer angekommen dauert es noch einmal fünf Stunden durch Sumpf und Gestrüpp, durch einen knietiefen Fluß, immer weglos und selten einer Markierung in grandioser Landschaft mit weiten U-Tälern, in denen Gletscher fließen, weidenbestandenen Ebenen und dunklen Granitgipfeln bis zur Blåkkådalshytta. Dass ich eine halbe Stunde vor der Hütte den Polarkreis nach Süden überschreite, bekomme ich gar nicht so recht mit, so erschöpft bin ich.
Aber am nächsten Tag geht’s mit neuen Kräften weiter. Goldgelb glitzert bei Sonnenaufgang der Svartissen-Gletscher von der anderen Talseite herüber, der herrliche Anblick hilft, rasch die schmerzenden Glieder zu vergessen. Eine Stunde auf dem gestrigen Weg zurück, dann abbiegen, dem ned Fossbekka-Bach bergan folgen. Markierungen gibt es keine, schließlich laufen nur vier oder fünf Menschen im Jahr diese Route. Über Grasland und Kalkhänge zu einem See hinauf. Nicht einmal zu einem Namen hat es bei diesem Gewässer mehr gereicht, so einsam ist es hier oben. Weiter über Felsenbuckel auf einen 925 Meter hohem Pass – manchmal halluziniere ich schon und stelle mir vor, ich sei in den Alpen auf 3000 Metern unterwegs. Anders ist die Landschaft hier auch nicht, nur eben einsamer.
Endlos zieht sich das Stormdalen, das Sturmtal, als gigantische, weite Tundra-Wiese zwischen schroffen Felsgipfeln und mächtigen Schneefeldern vor mir nach Osten in die Tiefe. Problemlos springe ich flott abwärts, die Strapazen des Vortages scheinen vergessen. Na gut, ab und zu muss ein kleiner Fluss durchwatet werden, Seitenbäche werden übersprungen. Aber es geht recht bequem immer am rechten Ufer abwärts. Wollgras nickt im Wind, Gletscher schicken ihre Schmelzwasser als donnernde Flüsschen ins Stormdalen.
Weiter unten tritt Krüppelwald an Stelle der weiten Tundra. Weg gibt es natürlich keinen, mühsam breche ich durch Weidendickicht und Birkenstämmchen. Während ich gestern noch jeden Sumpf verflucht habe, suche ich heute den Sumpf, weil dort keine Bäume und Büsche wachsen. Zwar quatscht das Wasser bald durchs Leder, aber im Unterholz hätte ich mich längst hoffnungslos verheddert. Stundenlang quatsche ich durch Sümpfe, breche durchs Unterholz, wenn es gar nicht anders geht, durchquere den hier gerade einmal einen halben Meter tiefen Fluss zum anderen Ufer. Und erreiche im einsetzenden Nieselregen wieder einmal ziemlich am Ende meiner Kräfte eine Schutzhütte, Nordre Stormdalen.
Sechs Pritschen, Tisch, Bank, Ofen, Geschirr – alles ist da, was man zum Überleben in der Wildnis braucht. Zumindest, wenn draußen der Regen vom Himmel rauscht, ist man auch mit einer solchen einfachen Unterkunft hoch zufrieden. Und liest im Hüttenbuch, dass hier eine Farm war, Völlig abgelegen in der Wildnis hätten sich hier zwei Brüder auf beiden Seiten des Flusses niedergelassen. Aber bereits im letzten Jahrhundert war es dort wohl doch ein wenig einsam oder das Klima zu unwirtlich, die Farmen wurden aufgegeben. Und von der Forstverwaltung als kostenlose Notunterkunft wieder hergerichtet.
Meine Notlage dauert zwei Tage. Denn am nächsten Morgen regnet es in Strömen, der Fluss ist von einem halben auf über zwei Meter Tiefe angeschwollen. Kein Wetter zum Weiterlaufen, ein Ruhetag in der Einsamkeit des Nordens ist angesagt. Danach aber soll es schon weiter gehen, in einer Regenpause breche ich auf. Der Fluss ist wieder auf eineinhalb Meter abgeschwollen, lässt sich aber bequem überqueren. Die Forstverwaltung hat nämlich ein Seil über das Wasser gespannt, mit dem über einen Seilzug ein Boot verbunden ist. Da kann man sich natürlich einfach hinüber ziehen, auch wenn man allein unterwegs ist.
Am anderen Ufer gibt es einen richtigen Weg. Und der führt in den knietiefen Sumpf – das Wasser steht einfach zu hoch. Knietief stapfe ich durchs Wasser. In den Schuhen stehen nicht nur meine Füße, sondern auch das Wasser – so habe ich mir das Abenteuer der nordischen Wildnis nicht vorgestellt. Aber so sieht die Realität leider aus. Immer wieder muss ich knietiefes Wasser durchwaten, Schuhe ausziehen ist zwecklos, da könnte ich gleich den ganzen Weg über Stock und spitzen Stein barfuß laufen. Auch der Himmel öffnet seine Schleusen wieder zu einem Wolkenbruch, der mich aber kaum mehr stört, so durchnässt bin ich schon. Also weiter, in der Ebene durch eine Seenplatte stapfend, die auf der Landkarte gar nicht eingezeichnet ist, wohl in trockeneren Zeiten auch nicht existiert. Weiter, am Gefälle im gurgelnden Bach talwärts schlitternd.
Neben mir donnert der Fluss über Felsen zu Tal, bestimmt ein toller Anblick. Aber nicht für mich, nicht an einem solchen Tag. Alles tropft, platsch und wieder stehe ich bis zum Oberschenkel im Wasser. Umgehen kann ich solche Stellen kaum, zu dicht ist das Weidengestrüpp ringsum, in dem meist auch knietief das Wasser steht. Nur gut, dass es hier so einsam ist. Da hört mich wenigstens niemand fluchen. Auf niemanden im Besonderen, höchstens auf mich selbst, wie ich nur auf die Idee kommen konnte, hier oben am Polarkreis zu wandern. Wo es fünf oder sechs mal häufiger regnet als in Frankfurt, aber erheblich kälter ist.
Irgendwo in der Gegend muss die Staatsforstverwaltung einen alten Bauernhof wieder hergerichtet haben, signalisiert mir eine Gehirnwindung, die noch nicht im Dauerregen abgesoffen ist. Da zweigt auch schon ein Weg ab, nach einer Viertelstunde stehe ich auf einer weiten Wiese hoch über dem Fluss. Granneset heißt der Hof, ein schönes Holzgebäude verspricht Trockenheit. Ein großer Tisch, acht Stühle, ein großer Holzofen zum Kochen. Auf dem Speicher alte Betten, kaum einen Meter siebzig lang. Egal, Hauptsache ein Dach über dem Kopf und bullige Wärme im Ofen, über dem tropfende Klamotten und Schuhe langsam trocknen.
Auch am nächsten Tag hält mich Dauerregen in Granneset fest. Nachdenklich lese ich die Zeilen, die Twylee Anderson Baviere in das Hüttenbuch gekritzelt hat. Die von ihrer Großmutter Anna Christine berichten, die als Vierzehnjährige mit ihren Eltern von diesem herrlichen Flecken ausgewandert ist und in Amerika ein neues Leben begonnen hat. Nach den Strapazen der vergangenen Tage verstehe ich diese Entscheidung. Wenn ich am Abend dann bei Kerzenschein mit trockenen Klamotten am bullernden Ofen sitze, verstehe ich aber auch die Sehnsucht, die diese Auswanderer selbst noch ihren Nachkommen vererbt haben. Eine Sehnsucht nach einer wunderschönen, wilden Gegend, die einst Heimat hieß. Heimat in der Einsamkeit des Nordens.
Allgemeine Informationen
Das Saltfjellet erreicht man am besten über die Nordlandsbahn, die zwei mal am Tag zwischen Trondheim und Bodö in Norwegen verkehrt. Nach Trondheim fährt man aus Süddeutschland in zwei Nächten (Schlafwagen) und einem Tag mit der Bahn, schneller ist man mit dem Flugzeug auch kaum am Ziel, weil man dann in Trondheim oder Mo i Rana übernachten muss, um auf den Zug am nächsten Morgen zu warten. Die Touren im Saltfjellet finden sich im Handbuch “Norwegian mountains on foot” beschrieben, das der norwegische Wanderverein DNT (Postboks 7 Sentrum, N-0101 Oslo, Telefon: 0047-2-2822800, Fax +47 2283 24 78, E-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Website www.turistforeningen.no, auf Bestellung zuschickt (Bezahlung mit Kreditkarte). Dort finden sich auch Informationen über benötigte Wanderkarten, die in Deutschland allerdings nicht so einfach zu erhalten sind. Hier hilft der auf solche Dinge spezialisierte Versandbuchhandel Schrieb weiter (Schwieberdingerstr. 10/2, 71706 Markgröningen, mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Internet: www.karten-schrieb.de ), der auf Anfrage auch Blattschnitte zuschickt, aus denen man die benötigten Karten aussuchen kann.
Wer im Saltfjellet wandert, sollte Erfahrung mit Wanderungen in Skandinavien haben. Die Ausrüstung kennt der Nordland-Erfahrene selbst am besten, vor allem wasserdichte Klamotten sind wichtig, schützen aber nicht vollständig vor den Unbillen der Witterung. Kondition für zwölf Stunden Wanderung mit Pausen zwischen zwei Hütten sind Grundvoraussetzung. Aus Sicherheitsgründen sollte man auf keinen Fall alleine wandern. Schlüssel für die Hütten kann man beim DNT ausleihen. Wenn man ohnehin in Oslo Station macht, holt man diesen am besten in der Zentrale (Storgata 3, im Zentrum), oder später in Mo i Rana in der Fremdenverkehrszentrale (Telefon: 0047-75-139200, Fax: -09). Eine Mitgliedschaft im DNT empfiehlt sich dringend, weil Mitglieder in den DNT-Hütten nur den halben Preis für die Übernachtung zahlen, so dass man die Jahresgebühr bald wieder eingespart hat. Lebensmittel für die gesamte Wanderung müssen mitgetragen werden, da die Hütten im Saltfjellet nicht bewirtschaftet sind. Geschirr, Gas für den Kocher und Holz für den Ofen sind aber, ebenso wie Decken, vorhanden.
Fotos: Dr. Roland H. Knauer