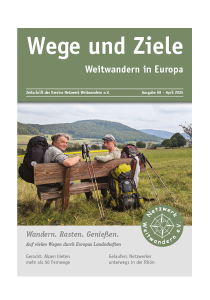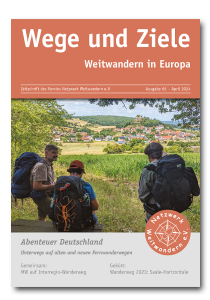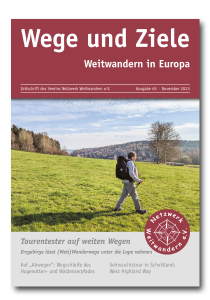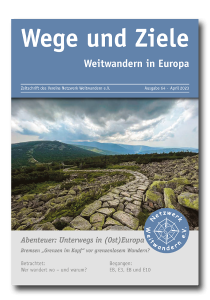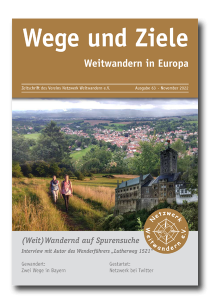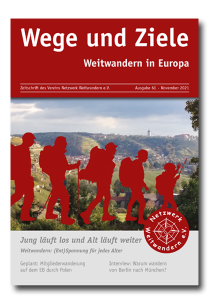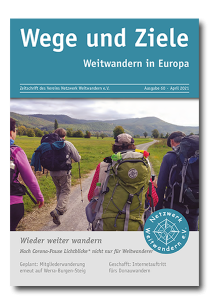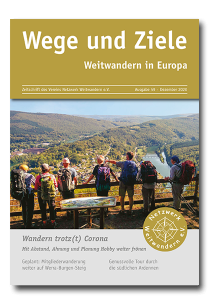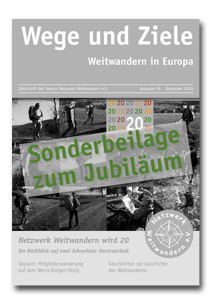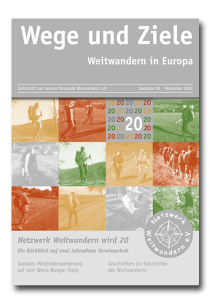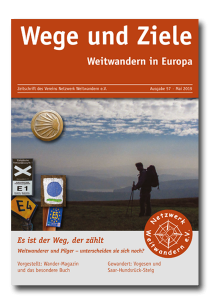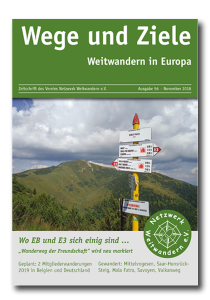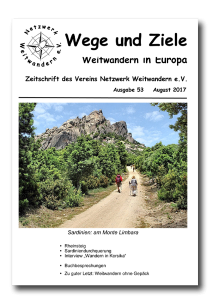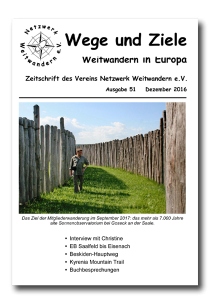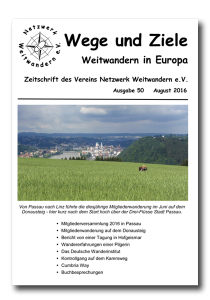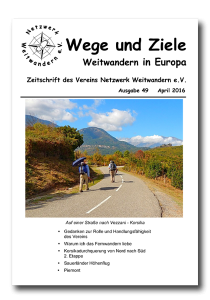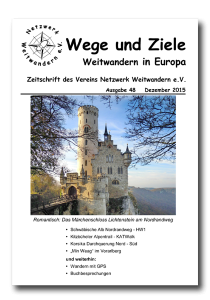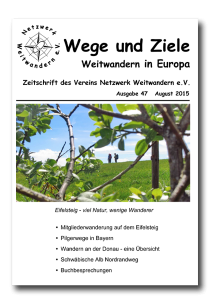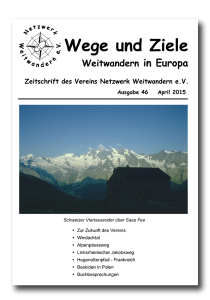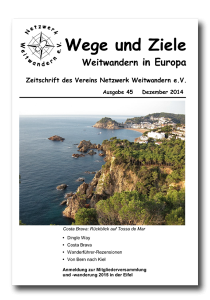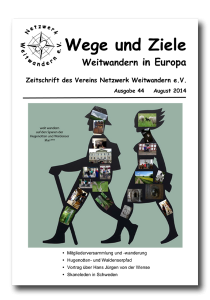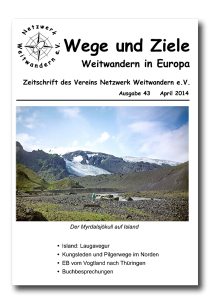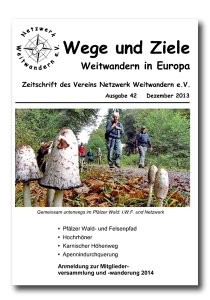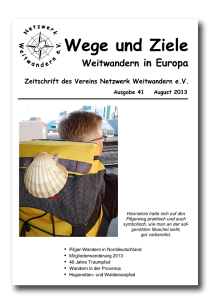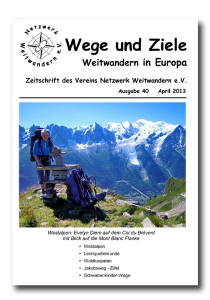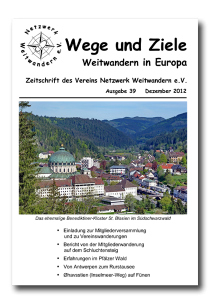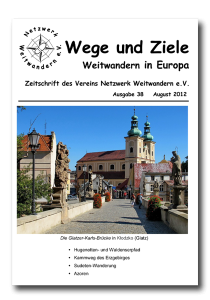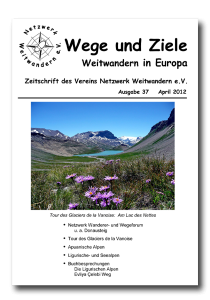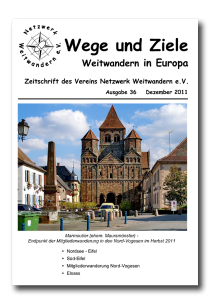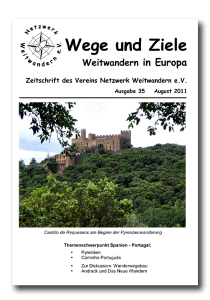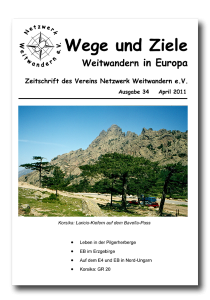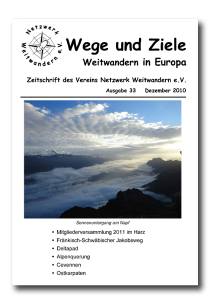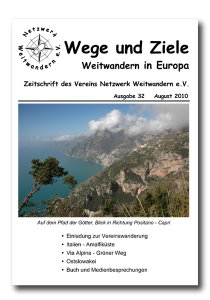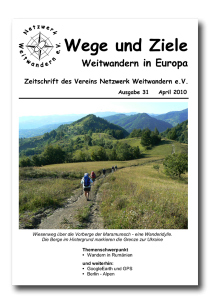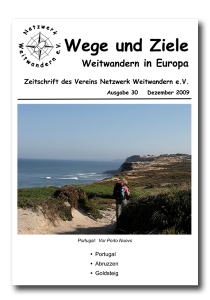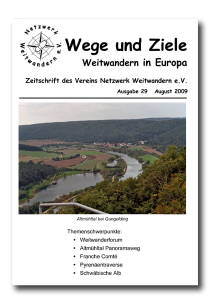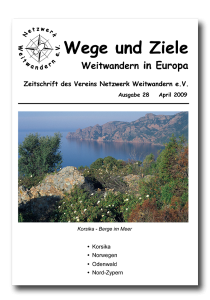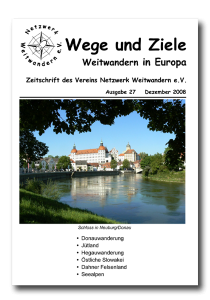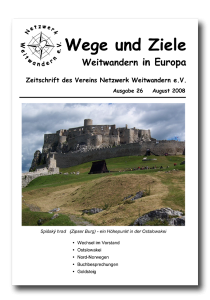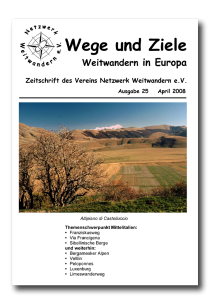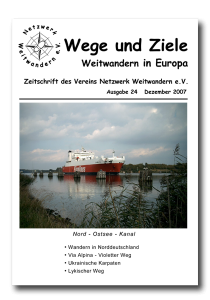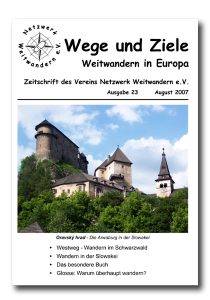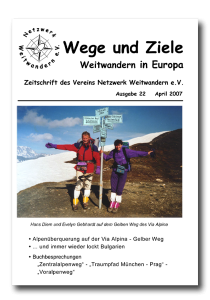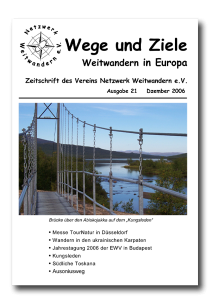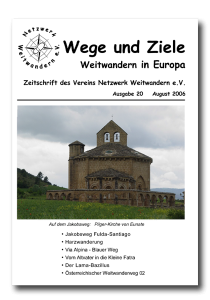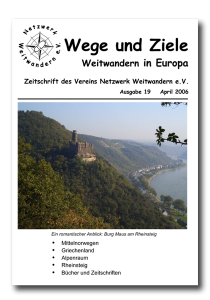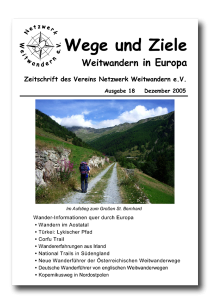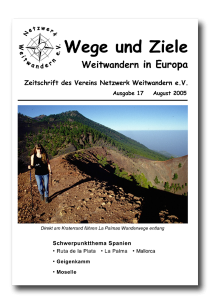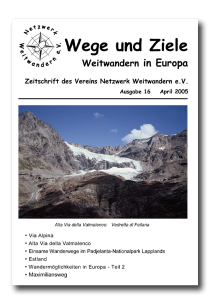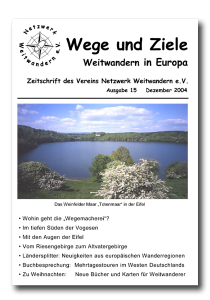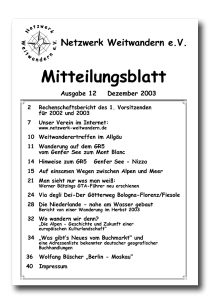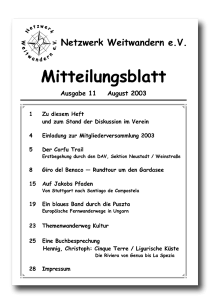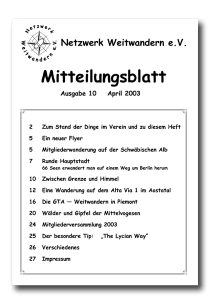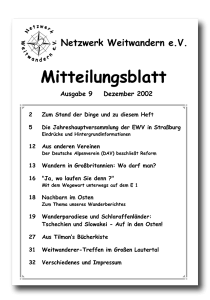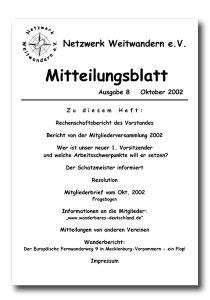Maximiliansweg – vom Bodensee zum Königssee
Auch für dieses Jahr (2024) hatte ich mir wieder eine größere Tour vorgenommen. Da ich mittlerweile unter die Schauspieler geraten war und möglichst wenige Proben verpassen wollte, bot sich ein dreiwöchiges Zeitfenster von Mitte August bis Anfang September an. Aber wohin? Nach längerer Hin-und-Her-Planerei – irgendwo durch die Dolomiten, die Runde um’s Bundesland Salzburg, einen Teil der Allgäuer Wandertrilogie – habe ich mich dann schließlich für den Maximiliansweg als „Rückgrat“ für meine Wanderung entschieden. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen umfasst dieser auch etliche Etappen oder Teilabschnitte der Allgäuer Wandertrilogie aber eben auf einem durchgängig markierten Weg, was eine kompliziertere Tourenplanung unnötig macht. Zum anderen durchquert er den deutschen Alpenraum vom Bodensee zum Königssee, eine Durchquerung die ich vor etlichen Jahren schon einmal als Radwanderung gemacht habe. Da ist es natürlich reizvoll, sie auch noch einmal zu Fuß zu erleben, verspricht das doch weitere und ganz andere, neue Eindrücke von dieser Region, da man sich ja auf Wegen und in Höhen bewegt, die, zumindest mit einem normalen Tourenrad, nicht zu bewältigen sind. Und so setzte ich mich dann am 19. August voller Vorfreude und einem nicht gerade leichten Rucksack in den Zug, der mich erst einmal nach Bregenz am Bodensee bringen soll.
Trotz mehrmaligen Umsteigens verläuft die Zugfahrt erstaunlich problemlos, doch als ich am Abend in Bregenz aussteige, gießt es wie aus Kübeln. Das fängt ja schon gut an - also erst mal das Regenzeug aus dem Rucksack gepfriemelt. Als ich mich auf einer Bank im Wartesaal wetterfest mache, komme ich mit einer älteren Dame ins Gespräch. Sie erzählt mit, dass sie früher auch öfter im Bregenzer Wald gewandert ist, aber drei Wochen vom Bodensee zum Königssee und das zu Fuß durch die Berge mit den ständigen Auf- und Abstiegen, nee, das sei doch Quälerei, davon würde sie mir dringend abraten. Ich beruhige sie, dass ich das ja nicht zum ersten Mal mache, und stiefele zum Hotel, wo ich, obwohl nur 15 Minuten vom Bahnhof entfernt, schon ziemlich durchnässt ankomme. Zum Abendessen muss ich noch mal durch den Regen - Hotel Garni halt – aber auf dem Rückweg hat er schon ein wenig nachgelassen, zumindest bilde ich mir das ein und hoffe auf morgen.
Der Maximiliansweg wird auch häufig mit dem Zusatz dekoriert „Eines Königs Reise“[1]. Er wurde benannt nach Maximilian II., König von Bayern. Dieser unternahm im Sommer 1858 eine 5-wöchige Reise von Lindau am Nordrand der Alpen nach Berchtesgaden. Meist fuhr er zwar in Kutschen, aber einige Stücke legte er zu Pferd zurück und bestieg auch einige Gipfel, darunter den Grünten und den Wendelstein. Die Route des Königs hat mit dem heutigen Maximiliansweg allerdings nur wenige Überschneidungen.
1991 eröffnete der Deutsche Alpenverein den Maximiliansweg als reinen Fußweg.
Die offiziell erste Etappe des Maximiliansweges beginnt in Lindau und führt über Bregenz nach Wolfurt, doch die spare ich mir und fahre erst noch ein Stück mit dem Zug in den Bregenzer Wald. Ich habe schließlich mehrere Jahre in dieser Region gelebt und kenne die meisten Wanderwege am und um den Bodensee. Aber auf dem Weg zum Bahnhof, es regnet auch nicht mehr, mache ich einen kleinen Abstecher an den See und tauche meine Hände ins Wasser. So Gott will, werde ich das am Königssee wiederholen.
Mein Weg beginnt dann in Alberschwende, Ausgangspunkt der berühmten „Käsestraße“. Mehr als 60 regionale Käsesorten lassen sich hier in einer Art „Käsetempel“ verkosten, aber angesichts eines steilen gut zweistündigen Aufstiegs von beinahe Seehöhe auf die 1200 m des Brüggelekopfs verkneife ich mir das. Oben angekommen denke ich, hätteste man doch vorher noch ein anständiges Käsebrot gegessen, denn der Alpengasthof auf dem Gipfel, der eigentlich für eine Brotzeit eingeplant war, hat seit kurzem auch noch am Montag Ruhetag. Also heißt es mit karger Rucksackverpflegung vorlieb nehmen. Immerhin gibt es einen funktionierenden Getränkeautomaten, so dass wenigstens die beim Aufstieg ausgeschwitzte Flüssigkeit wieder aufgefüllt werden kann, ohne die mitgeführten Reserven anzugreifen.
Aber es gibt ja auf dem Abstieg nach gut einer Stunde noch den Gasthof Alpenrose, um etwas Gescheites in den Magen zu bekommen. Doch deren Besitzer haben jetzt erst mal beschlossen, bis auf weiteres keine Bewirtung mehr anzubieten sondern ihr Gasthaus nur noch als Frühstückspension zu betreiben. Es ist wie verhext; irgendwie verfolgt mich auf meinen Wanderungen ein Fluch bezüglich Einkehrmöglichkeiten unterwegs. Dann also noch ein Müsliriegel aus dem Rucksack und weiter zum im wahrsten Sinne des Wortes Highlight dieser Etappe, der spektakulären Lingenauer Hochbrücke über den Tobel der Bregenzer Ache, eine romantische Flusswildnis. Um sie und die Brücke so recht genießen zu können, empfiehlt es sich, einen kleinen Umweg zu nehmen und hinunter zum Fluss abzusteigen, um ihn dann direkt auf einer Fußgängerbrücke zu überqueren mit tollen Blicken nach oben und nach unten. Hier kommen die Erinnerungen an ein lange zurückliegendes Erlebnis wieder hoch, haben doch meine Frau und ich ganz in der Nähe auf der Bregenzer Ache unsere ersten Paddelversuche im Wildwasserkajak gemacht, die damals etliche Runden „Kenterwein“ gekostet haben.
Nach der Brücke sollte es eigentlich in einem kurzen Anstieg in wenigen Minuten hinauf nach Lingenau gehen, meinem heutigen Etappenziel. Doch wenn man schon nichts im Bauch hat, ist natürlich auch der kurze Weg wegen eines Felssturzes gesperrt und die Alternative zieht sich und zieht sich, verbunden mit viel Asphalttreterei. Aber irgendwann erreiche ich dann doch mein Ziel noch rechtzeitig zu Kaffe und einem großen Stück Torte, was jetzt auch dringend erforderlich ist.
Anders als mit der deutschen Wirtschaft geht’s für mich heute nur aufwärts. Von Lingenau bis zum Staufener Haus sind in stetigem, mehr oder weniger steilen Anstieg 1200 Höhenmeter zu bewältigen und das leider nicht unerheblich auf Asphalt. Bis Hittisau wandere ich noch angenehm auf einem Walderlebnispfad aber dann sind 21/2 Stunden Aufstieg auf einem Mautsträßchen, zum Glück kaum befahren, bis zum Gasthof Höfle angesagt. Immerhin gibt’s unterwegs zwei interessante Unterbrechungen. Mit einem kurzen Schlenker runter von der Straße kann man die Kummaschlucht auf einer historischen Holzbrücke überqueren, die mit einer kleinen Geschichte verbunden ist: In der Schlucht hauste einstmals ein wilder Drache. Die Menschen fürchteten sich sehr vor ihm, bauten aber, obwohl er sich mit allen Mitteln dagegen wehrte, trotzdem von einem zum anderen Ufer eine starke Holzbrücke. In der Brücke hängten sie ein Kruzifix auf, so dass ihnen das schreckliche Untier nichts anhaben konnte. Wenn Menschen gelegentlich Steine in die Schlucht werfen, schlägt der Drache auch heute noch mit seinem Schwanz um sich, aber davon wird die Schlucht nur breiter, bis sich in ferner Zukunft unter der Brücke ein fruchtbares Tal ausbreiten und der Lindwurm seine Macht verloren haben wird. Noch ist es aber nicht soweit und ich habe für alle Fälle auch einen Stein reingeworfen, um den Prozess der Talentstehung, wenn auch nur unwesentlich, zu beschleunigen.
Wieder zurück auf der Straße führt sie mich dann noch zu einem 200 Jahre alten denkmalgeschützten Sägewerk, von dem ich leider nur die Außenanlagen bewundern kann, da man sich für eine Führung durch das gesamte Werk rechtzeitig hätte anmelden müssen. Dann geht’s auf der Straße weiter stetig bergauf bis zum Leckner See, der auf etwas über 1000 m liegt, malerisch in Hochalmen eingebettet. Entstanden ist er durch eine Naturkatastrophe. 1817 entlud sich auf dem Rohnen, einem Gipfel über dem Lecknertal, ein gewaltiges Unwetter, das zwei Tage lang mit Blitz und Donner tobte. Nachdem es sich verzogen hatte, breitete sich im Tal da, wo es bis dato saftige Wiesen gegeben hatte, ein mächtiger See aus, der so tief war, dass nur noch die höchsten Tannenwipfel herausragten. Nach und nach fanden die Menschen Gefallen an dem See und so ist er bis heute ein beliebtes Ausflugsziel, insbesondere für E-Mountainbiker, die brauchen nämlich keine Maut bezahlen.
Kurz darauf erreiche ich den Alpengasthof Höfele und – ich wage es kaum zu glauben – er ist tatsächlich geöffnet. Das gibt’s doch gar nicht, der Fluch ist, zumindest für heute, gebannt und so wird ausgiebig Mittagsrast gemacht. Das ist auch bitter nötig, denn vom Gesamtaufstieg sind gerade mal 400 Höhenmeter geschafft, d.h. auf dem letzten Viertel des Weges habe ich bis zum Ziel noch 800 vor mir. Die werden also ganz schön steil.
Wenigstens ist jetzt erstmal Schluss mit dem Asphalt. Der Weg führt zunächst angenehm schattig einen steilen aber gut begehbaren Waldpfad bergauf bis zur südlichen Lauchalm mit Sennerin im Bikini im Liegestuhl vor der Hütte, die mich, wie mir scheint, als ich ihr „Grüß Gott“ wünsche mitleidig anblickt. Ein paar Meter weiter weiß ich auch warum. Hier beginnt der steilste Abschnitt hinauf zum Hochgrat und das auf einem „Weg“ wie ich ihn noch nie zuvor im Gebirge gesehen habe: Gepflastert mit Lochsteinen, durchwachsen mit allem möglichen Gekraute unterschiedlicher Größe und an vielen Stellen schon so bröselig, dass man höllisch aufpassen muss, nicht umzuknicken – in steilstem Gelände mit schwerem Rucksack und einer Haglundferse geschlagen ganz schön happig. Doch piano, piano komme ich schließlich wohlbehalten am Hochgrat an und muss dann nur noch 5 Minuten hinunter bis zum Staufener Haus, meinem heutigen Etappenziel. Kaffee und Kuchen hab ich mir mal wieder sowas von verdient.
Nach unruhiger Nacht in der bis auf den letzten Platz belegten Hütte sieht man heutiger grober Wanderplan vor, den Gipfel des Hochgrat zu besteigen, zumindest einen großen Teil der Nagelfluhkette zu überqueren, um dann von der Ornachalp nach Gunzesried-Säge abzusteigen und von dort mit dem Bus nach Sonthofen zu fahren, dem Startpunkt der nächsten Etappe. Doch der Blick aus dem Hüttenfenster zeigt – nichts. Alles dicht, Aussicht gleich Null und nach Auskunft des Hüttenwirts wird alsbald auch noch länger anhaltender Regen einsetzten. Ich überlege kurz, sollste oder sollste nicht, komme aber dann zu dem Schluss, dass mir die Überquerung der Nagelfluhkette, die auf einem schmalen Gratweg schon bei gutem Wetter nicht ganz ohne ist, unter den gegebenen Umständen doch zu riskant erscheint und wähle eine Variante, die unterhalb des Hochgrats hinunter ins Gunzesrieder Tal führt. Das hat auch noch den durchaus nicht zu verachtenden Nebeneffekt, dass noch zwei Jausenstationen am Weg liegen.
Je weiter ich runterkomme desto lichter wird zwar zeitweise der Wolkennebel, aber wenigstens ein Blick auf die Gipfel der Nagelfluhkette ist mir dennoch nicht vergönnt. Als dann auch noch kurz nach der ersten Jausenstation, die natürlich, wie ein Plakat an der Eingangstür kundtut, die Bewirtung mittlerweile eingestellt hat, plötzlich heftiger Regen einsetzt – bis ich endlich das Regenzeug aus dem Rucksack gezerrt und angezogen habe, bin ich schon pitschenass – bin ich mir nun doch sicher, dass es die richtige Entscheidung war, den einfacheren Weg gewählt zu haben. Die zweite Jausenstation, die ich, immer noch gottergeben durch den dichten Regen trabend, erreiche, ist wunderbarerweise geöffnet. Da kann ich mir dann ausgiebig und in aller Ruhe das Regenende abwartend diverse Köstlichkeiten aus der zugehörigen Käserei samt einer Hoalben schmecken lassen – geht ja jetzt nur noch auf breitem Fahrweg bergab. Und so kommt zunächst innerlich und dann tatsächlich auch noch äußerlich nach und nach die Sonne raus und ich kann, wenigstens halbwegs wieder trocken, sogar früher als vorgesehen, in Gunzensried-Säge ohne lange Warterei den Bus nach Sonthofen besteigen. Dort ist auch noch Zeit, ein wenig die südlichste Stadt Deutschlands zu erkunden. Besonders interessant finde ich ein kleines Freilichtmuseum mit Grabdenkmälern aus unterschiedlichen Epochen auf dem örtlichen Friedhof, das mir die Erkenntnis vermittelt „Die Welt muss notwendig immer schlechter werden, denn es sind immer die Besten gestorben.“ Kaffe und Kuchen gibt’s diesmal auf dem Althaus-Platz. Hier hat Johann Althaus gewohnt, der eine Zeit lang als Käser in der Schweiz gearbeitet hat und bei Strafe das Rezept für den Emmentaler geklaut und ins Allgäu gebracht hat. Deshalb ist Allgäuer Emmentaler bis heute preiswerter als das Schweizer Original, schmeckt aber fast genauso gut.
Die heutige Etappe empfand ich im Nachhinein schon als grenzwertig ich würde sie so nicht noch einmal laufen. Die ersten drei Stunden geht es, vorbei an der Burgruine Fluhenstein, auf eine Asphaltstraße fast 700 Höhenmeter ohne Unterbrechung ständig bergauf. Die Sonne brennt schattenlos vom Himmel. Das hat mit Wandern eigentlich nichts mehr zu tun sondern ist eher eine Schinderei, weil man ja auch noch einiges an Gepäck zu tragen hat. Nicht einmal die schöne Umgebung kann ich richtig genießen. Als der Asphalt dann endlich aufhört, bin ich schon ganz schön geschlaucht, doch jetzt beginnt eigentlich erst der richtige Aufstieg. Noch einmal 500 Höhenmeter wollen auf kürzester Distanz, also extrem steil, bis auf den Gipfel des Tiefenbacher Eck (1569 m) bewältigt werden. Wenigstens kann ich jetzt auf naturbelassenen Pfaden bergan steigen, lediglich die Durchquerung eines sumpfigen Geländes inkl. der Suche nach einem geeigneten Weg, um nicht im Matsch zu versinken, erforder noch mal zusätzliche Anstrengung. So bin ich dann heilfroh, als ich nach insgesamt 5 Stunden endlich den Gipfel erreicht habe und mir eine ausgiebige Mittagspause gönnen kann. Die Aussicht von hier oben entschädigt schon für die Mühsal aber nicht für die elende Asphalthatscherei.
Teilweise erholt geht’s dann weiterhin auf schattenlosem Pfad nach einem kurzen steilen Abstieg noch einmal in einen Gegenanstieg bis unterhalb des Gipfels vom Spieser, aber glücklicherweise muss man nicht drüber – das hätte ich vermutlich auch kaum noch geschafft. Der Maximiliansweg umgeht ihn und führt mich direkt auf die Terrasse der bewirtschafteten Hirschalpe (1500 m), wo ich es bei Skiwasser und Zupfkuchen gut aushalten kann.
Laut Wanderführer sollte ich von hier noch knapp ein Stunde gemütlich abwärts laufend bis zu meinem Etappenziel nach Unterjoch benötigen. Ein Blick auf die Karte macht mich stutzig und so erkundige ich mich vorsichtshalber noch mal bei den Wirtsleuten, die über die Zeitangabe nur lachen können und meinen, das sei völlig unmöglich. Erst mal müsse ich wieder hinauf bis fast auf den Jochschrofen, dann ein langer steiler Abstieg bis zur Alpenstraße und danach an dieser entlang (viel befahren) bis nach Unterjoch. Mit 2, eher 2 ½ Stunden müsse ich schon noch rechnen. Sie empfehlen mir den einstündigen Abstieg auf gut begehbarem Weg nach Oberjoch, übrigens dem höchstgelegenen Bergdorf Deutschlands. So hab ich es dann auch gemacht und dort im „Löwen“ noch ein gutes Nachtquartier gefunden. Wie’s morgen weitergeht – schau’n wir mal. Jetzt genieße ich erst mal den Abend bei einem leckeren Essen, ordentlichem Bier und einer tollen Aussicht bei der einsetzenden Abenddämmerung.
Nachdem ich nun eher unfreiwillig in Ober- statt Unterjoch gelandet bin, muss ich mir erst mal Gedanken machen, wie ich von hier aus am besten wieder den Anschluss an meinen Maximiliansweg finde. Mit Hilfe einiger Recherchen im Internet stellt sich heraus, dass der günstigste Ort dafür wohl Füssen ist, ist er doch von Oberjoch aus recht gut mit Öffis erreichbar. Also auf nach Füssen. Mit zweimaligem Umsteigen und ohne allzu lange Wartezeiten erreiche ich am Mittag auch den dortigen Bahnhof. Ich könnte also noch problemlos mit der Bahn zum Tegelberghaus hinauffahren, dort übernachten um am nächsten Tag wieder auf dem Maximiliansweg zur Kenzenhütte zu laufen. Doch dann tut sich ein neues Problem auf: Die Kenzenhütte, der entscheidende Standort für die nächsten beiden Etappen ist komplett ausgebucht. Da es sich um eine privat betriebene Hütte handelt, kann ich mich auch nicht auf meinen Status als Alpenvereinsmitglied berufen. So bleibt mir leider keine andere Wahl, als noch einmal den Öffentlichen Nahverkehr zu bemühen, um, kombiniert mit einer kurzen einstündigen Wanderung den übernächsten Etappenort Eschenlohe anzusteuern. Also ist es noch nix mit einer weiteren Etappe auf dem Maximiliansweg, aber angesichts drückender Hitze, die auch noch für morgen vorhegesagt ist, bin ich darüber nicht wirklich böse. Die Wieskirche, Unter- und Oberammergau sowie Kloster Ettal konnte ich auf diese Weise wenigstens vom Busfenster aus bestaunen, auf dem Wanderweg hätte ich davon gar nichts mitbekommen.
Angesichts der Wetterprognosen für den nächsten Tag – die schwüle Hitze soll sich in Sturm, Gewitter und Dauerregen entladen – beschließe ich für heute, gegen Ende der Etappe ein Stück vom Maximiliansweg abzuweichen und in Kochel am See Station zu machen. Dort lockt mich die Möglichkeit, das erwartbare Sauwetter für einen Besuch des Franz-Marc-Museums zu nutzen, was meine Frau und ich schon immer mal geplant aber irgendwie nie realisiert hatten.
Es gibt zwei Varianten, von Eschenlohe dorthin zu gelangen: Eine lange mit einem dreistündigen Steilanstieg auf den Herzogenstand und einer anschließenden Fahrt mit einer Gondelbahn hinunter zum Walchensee oder eine kürzere mit deutlich weniger Anstieg und einem Fußweg zum Walchensee. Bei schwülen 32° kommt für mich nur die zweite infrage. Die ersten zwei Stunden sind beide Varianten identisch. An der Stelle, wo dann die lange steile Variante abzweigt, schlägt mir mein Führer vor, einem ebenen Forstweg weiter bis zu seinem Ende zu folgen, von wo dann ein schmaler Pfad zu Ohlstädter Alm führt. Von dort kann man dann hinunter zum Walchensee laufen. Soweit die Theorie. Ich marschiere also schön im Schatten den Forstweg weiter bis zu seinem Ende, aber da ist dann in einem ausgetrockneten Flussbett auch alles zu Ende. Ein Pfad, der zu dieser Alm führen könnte, ist trotz intensiven Suchens nicht zu entdecken. Auf der Karte meiner Rother-App ist auch weder die Ohlstädter Alm geschweige denn ein Pfad dorthin auffindbar. Zum wiederholten Male erweist sich mein Wanderführer als unzuverlässig, zumindest als zu unpräzise. Eine richtig gute alte Wanderkarte hätte man hier halt gebraucht. Hab ich aber nicht und so bleibt nichts als der Rückzug nach Eschenlohe und die Fahrt mit Bahn und Bus nach Kochel, was glücklicherweise völlig unproblematisch ist. Fazit: Eine schöne, landschaftlich reizvolle aber schweißtreibende sechsstündige Wanderung, die, wenn auch anders als geplant, letztendlich doch noch zum Ziel geführt hat.
Die katastrophale Wettervorhersage ist voll eingetroffen. Erst Sturm und Gewitter, dann den ganzen Tag Dauerregen und zwar so heftig, dass es, obwohl ich keinen Schritt gewandert bin, gereicht hat, dreimal durchnässt zu werden. Das erste Mal in Kochel auf dem Weg vom Hotel zum Franz-Marc-Museum. Da es sich um die bedeutendste und umfangreichste Ausstellung seiner Werke handelt, die zudem noch sehr interessant eingebettet ist in dazu passende Bilder von anderen Malern, die ebenfalls der „Brücke“- sowie der „Blaue Reiter“ – Gruppe angehörten, kann ich dort mit diesen tollen Bildern eine anregende und gute Zeit verbringen mit dem nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt, auch wieder halbwegs abzutrocknen.
Da bei diesen sintflutartigen Regenfällen nicht im Traum an eine wie auch immer geartete Weiterwanderung zu denken ist – ich bin ja kein Masochist – beschließe ich, gleich mit dem Bus nach Lenggries zu fahren, dem Startpunkt für die nächste Etappe. Dazu muss ich aber vom Museum zum Bahnhof laufen, was bedeutet, ein zweites Mal durchnässt zu werden. Die Bahnhofshalle ist schon von einer Gruppe Radfahrer okkupiert, die ihre Tour abgebrochen haben und dort eine große Umziehaktion inszenieren, um wenigstens ein paar trockene Fäden am Leib zu haben, bevor sie mit dem Zug heimfahren.
Da mein Bus erst in einer ¾ Stunde fährt, kann ich noch ein wenig vor mich hin trocknen während ich ein Käsebrötchen verdrücke. Mit mir steigen dann auch zwei junge Damen ein, die wohl ebenfalls wandernd unterwegs und völlig durchnässt sind. Während der Fahrt vollführen sie einen komplizierten Sitzstriptease, um ihre nassen Klamotten gegen ein paar trockene aus dem Rucksack zu tauschen – ein echt gute Nummer, die viel Körperbeherrschung erforderte. Sie sind gerade mit der Vorstellung fertig, als der Bus in Lenggries ankommt. Hier muss ich mich nun noch auf die Suche nach einem freien Zimmer machen, die Touristeninformation ist schon geschlossen, was mich schließlich ein drittes Mal pitschnass werden lässt. Da aller guten Dinge drei sind, reicht’s jetzt auch für heute.
Endlich mal wieder ein halbwegs normaler Wandertag. Heute soll es nach Bad Wiessee an den Tegernsee gehen. Der Regen hat in der Nacht aufgehört, aber tiefhängendes Gewölk begleitet mich durch das wunderschöne Hirschbachtal, das mich in stetigem aber moderatem Anstieg bis hinauf auf den Hirschbachsattel führt. Oben angekommen erwarten mich vier Wegweiser: Einer in Richtung zurück nach Lenggries, einer zum Fockenstein und die Aueralm, einer nach Campen und der vierte nach Bad Wiessee am Tegernsee und da will ja hin. Die Tausendeurofrage: Welchem dieser Wegweiser wäre die geneigte Leserschaft gefolgt? Richtig – ich wähle auch den Weg nach Bad Wiessee. Das erweist sich aber alsbald als Fehlentscheidung. Er führt sausteil abwärts, häufig nur mühsam zu erkennen und immer wieder von Hindernissen wie umgestürzten Bäumen blockiert, kurzum ein Weg, der schon in trockenem Zustand eine echter Herausforderung darstellt. Doch nach dem gestrigen Dauerregen ist der Abstieg schon eine Art Kamikaze-Unternehmen. Gaaanz, gaaanz laaangsaaam, immer wieder im Morast versinkend und große sumpfige Stellen mühsam umgehend, geht’s Schrittchen für Schrittchen talwärts. Bloß nicht ausrutschen, dann könnte ich vollends abschmieren und mich möglicherweise sogar verletzen. Irgendwann habe ich es mit schlammverkrusteten Schuhen und Hosenbeinen dann doch geschafft, heil unten im Sollbachtal anzukommen. Aber in einem solchen Zustand am mondänen Tegernsee aufzulaufen, da geniert man sich ja doch. Also Schuhe und Hose ausgezogen und auf einem Stein im munter dahinfließenden Sollbach gereinigt und geschrubbt. Bis nach Bad Wiessee ist das alles wieder trocken und jetzt außerdem river-stone-washed, vielleicht ein neues Label für Outdoorausrüstung. Am Waschplatz fällt mein Blick noch auf einen Wegweiser, der mir zu verstehen gibt, dass ich mir die ganze Quälerei inkl. Reinigungsaktion hätte sparen können, wäre ich oben dem Wegweiser nach Campen gefolgt, dann hätte mich ein schöner Forstweg auch bis hierher geführt. Jetzt noch mal zurück macht aber auch keinen Sinn. Das Abstiegsabenteuer abgehakt und gemächlich bis zum Tegernsee gewandert, wo ich im gemütlichen Café am See lande und mir Kaffee und Kuchen schmecken lasse, bis mich ein Schiff auf die andere Seeseite zu meinem heutigen Nachtquartier bringt. Das ist zwar nicht gerade billig - Tegernsee eben - aber jetzt meiner exklusiven river-stone-washed-Ausrüstung durchaus angemessen.
Heute geht’s von See zu See – vom mondänen, touristisch ziemlich überlaufenen Tegernsee zum eher noch bäuerlich geprägten, beschaulichen Schliersee. Erst heißt es 600 Höhenmeter anständig steil bis zur Gindelalm aufzusteigen und dann die 600 Höhenmeter wieder abzusteigen aber etwas gemächlicher. Die Sonne heizt ganz schön ein aber der Weg verläuft meist recht angenehm im schattigen Wald. Aufgrund des schönen Wetters sind hier doch mal zahlreiche Wander*innen unterwegs, ist diese Tour von See zu See doch sehr beliebt. Entsprechend gibt es auch einige reizvoll gelegene Einkehrmöglichkeiten – alle geöffnet!!! und von mir ausgiebig genutzt. Wenn sich die Gelegenheit schon mal so üppig bietet, wäre es leichtfertig, sie auszulassen. Doch wohl ein wenig zu ausgiebig, wie sich später am Schliersee herausstellt. Dort gibt es nämlich rund um den See noch eine interessante und äußerst humorvolle Freiluftausstellung mit Arbeiten bekannter Karikaturisten, die ich mir zumindest auf dieser Seeseite entlang des Maximiliansweges etwas ausführlicher anschauen möchte. Darüber hinaus locken auch noch viele schöne Seecafés, von denen ich mindestens eines mit meinem Besuch beehren möchte und so vergeht die Zeit unmerklich im Fluge und es ist schon nach vier, als ich eigentlich die letzten drei Stunden bis nach Fischbachau, dem offiziellen Etappenziel angehen müsste. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich es wohl noch geschafft hätte, wenn es hätte sein müssen, aber meine DB-App klärt mich darüber auf, dass es nicht sein muss. In 20 Minuten geht ein Zug nach Fischbachau und so fahre ich dann lieber12 Minuten mit der Bahn als noch 3 Stunden zu laufen, zumal ich vom Bahnhof in Fischbachau auch noch fast eine Stunde zu Fuß bis in die Dorfmitte zurücklegen muss. Dort übernachte ich im einzigen Gasthof, wo anständig Schafskopf gekloppt wird, die Speisekarte sehr übersichtlich und das Zimmer mit hübschen Bauernmöbeln und tatsächlich ohne Glotze ausgestattet ist. Da lässt sich gut ruhen.
Zum Übergang in die Chiemgauer Alpen hat heute der Wendelstein seine imposante Kulisse vor mir aufgetürmt, mit 1840 m der höchste Punkt meiner Tour auf dem Maximiliansweg. Das bedeutet 1200 Höhenmeter Aufstieg ohne auch nur eine kleine ebene Passage zwischendrin bei hochsommerlichen Temperaturen von um die 30°. Da lohnt es sich doch, bevor es so richtig bergauf geht, in der Wallfahrtskapelle von Birkenstein ein Kerzlein anzuzünden. „Kapelle“ ist eigentlich missverständlich, denn es handelt sich um einen ganzen Komplex einer bombastischen und z.T. archaisch anmutenden Inszenierung der Marienfrömmigkeit. Offensichtlich gibt’s da auch einen großen Bedarf, schaut man sich die Besucherscharen an, die hier schon am Morgen um 9:00 Uhr ihre Gebete verrichten, Opferkerzen entzünden und wundertätiges Wasser in mitgebrachte Fläschchen abfüllen - und das sind beileibe nicht nur Wandersleut, die sich, so wie ich, ein wenig Beistand für die Wendelsteinbesteigung erhoffen.
Als die Kerze brennt, geht’s los. Viele Wege führen von hier auf den Gipfel, alle dauern lange, alle sind anstrengend und etliche Leute sind am Start. So wie es aussieht wählen die meisten von ihnen die Route, die einige bewirtschaftete Almen passiert, ich entscheide mich hingegen für den landschaftlich reizvolleren Meditationsweg. Da hat’s zwar keine Einkehrmöglichkeiten unterwegs dafür aber bis zum Gipfel 7 Stationen, die dazu einladen, innezuhalten und eine bestimmte Besonderheit am Weg auch im Kontext seines eigenen Lebens zu bedenken wie etwa eine Weggabelung, ein Ausbuchtung mit weitem Blick in die Landschaft oder das gleichzeitige Vorkommen giftiger und heilsamer Pflanze an ein und derselben Stelle.
So gewinne ich Erkenntnis um Erkenntnis immer mehr an Höhe, was aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass es ganz schön schlaucht. Aber der Weg der Erkenntnis ist nun mal kein leichter, auch wenn man sie hier im wahrsten Sinne des Wortes im Vorbeigehen gewinnen kann. Auf dieser Variante sind nur wenige Wander*innen unterwegs, aber ich komme mit fast allen in ein kurzes Gespräch. Nach 5 Stunden Aufstieg ist es dann, natürlich inklusiv der notwendigen Pausen zum Essen, Trinken, Schauen und Denken, geschafft: Ankunft auf der Terrasse des Wendelsteinhauses. Von zwei Seiten aus kann man hier auch mit einer Bahn hinaufgelangen und entsprechend voll ist es natürlich. Aber die letzten Meter zum Gipfel müssen alle zu Fuß zurücklegen. Mein Resümee: Wunderschön war’s und sehr anstrengend, insbesondere wegen der Hitze. Einen doch ziemlich schweren Rucksack unter diesen Bedingungen solange bergauf zu schleppen, ist doch nicht mehr so recht mein Ding. Für den „Abstieg“ nach Brannenburg nehme ich dann lieber die Zahnradbahn, ein zwar nicht ganz billiges aber auch sehr beeindruckendes Erlebnis.[2]
Der Start in die heutige Etappe zum Hochrieshaus ist mal wieder einer mit Hindernissen. Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten ist die Straße nach Nußdorf am Inn, die ich erstmal bis zur Überquerung der A 93 hätte nehmen müssen, gesperrt. Laut Auskunft im Touristenbüro Brannenburg kommt man auch als Fußgänger nicht durch und somit auch nicht über die Autobahn. Ich könnte jetzt auf die nächstgelegen Autobahnbrücke ausweichen und dann auf der anderen Seite auf den ursprünglichen Weg nach Nußdorf zurückkehren, aber das würde dann eine Verlängerung der ohnehin schon 7-stündigen Wanderzeit um etwa zwei weitere Stunden bedeuten – nicht wirklich schmackelig. Mit Hilfe der sehr freundlichen und kompetenten Mitarbeiterin in der Touristeninformation knobeln wir eine Alternative aus: Wanderung von Brannenburg nach Grainbach, um dort dann in die Hochriesbahn umzusteigen und kommode zum Gipfel zu schweben. Und so wird’s dann auch gemacht. Ich gestehe, nach dem Mörderanstieg gestern auf den Wendelstein kann ich heute auch gut auf ein ähnliches Unternehmen hinauf zu Hochries auf 1568 m verzichten. Die Etappe ist bei der großen Hitze und etlichen asphaltierten Abschnitten trotzdem noch lang und anstrengend genug, um kein schlechtes Gewissen zu bekommen. Oftmals ist auch die Wegführung nicht so eindeutig zu klären. So endet z.B. eine laut App mögliche „Abkürzung“ mit totalem Wegverlust und einer mühseligen Kraxelei, um wieder auf eine Straße zu gelangen, die in die richtige Richtung weiterführt. Doch gegen 16:00 Uhr erreiche ich noch rechtzeitig die Talstation der Hochriesbahn und schwebe dann entspannt zunächst mit einem Sessellift und dann mit einer Kabinenbahn auf 1600 m in die Höhe, wo ich mich im schicken neu renovierten Hochrieshaus des DAV erst mal mit einem Hefeweizen erfrische.
Die anschließende Anfrage bei der Sonnenalm, dem eigentlich nächsten Etappenziel ergibt “fürs ganze Wochenende komplett ausgebucht.“ Mittlerweile weiß ich auch warum das so ist. Bei hochsommerlichem Wetter werden die Hütten, die über einen Bergbahnanschluss verfügen, an Wochenenden vollständig von Gleitschirmflieger*innen belegt. Dann ist die Thermik nämlich optimal und sie bekommen, wenn sie einem einschl. Verband angehören, Mehrfachkarten für die Lifte zu einem äußerst günstigen Preis, weil der jeweilige Verband für die erforderliche Rückerstattung an die Liftbetreiber aufkommt. Wir einfachen Wanderer gucken dann in die Röhre, auch als DAV-Mitglieder, die mit ihren Beiträgen zum Unterhalt der Hütten beitragen – Geld regiert mittlerweise eben überall die Welt.
Wie dem auch sei, die nächste Etappe muss ich halt wieder ein wenig umplanen. Sie wird nun relativ kurz und endet schon um die Mittagszeit in Hohenaschau. So bleibt noch Zeit, dem Chiemsee einen Besuch abzustatten, schließlich hat der Namensgeber meines Wanderweges am 23.Juli 1858 auch schon eine festliche Rundfahrt um den See unternommen. Von Hohenaschau mit dem Zug nach Prien ist es nur ein Katzensprung und von dort lasse ich mich bei herrlichstem Sonnenschein zwei Stunden gemütlich über das Bayrische Meer schippern, natürlich inkl. Kaffee und Kuchen und den schönsten Aussichten auf die umliegenden Berge.
Da Müßiggang bekanntlich aller Laster Anfang ist, soll man ihm nicht allzu sehr frönen, und so wird die nächste Etappe von der Sonnenalm nach Marquartstein auch gleich wieder eine echte Härteprüfung. Zunächst bringt mich die Kampenwand-Bahn noch gemächlich nach oben, aber dann ist schnell Schluss mit Lustig. Die Wegbeschreibung in meinem Führer „etwa 100 Meter oberhalb der Steinlingalm biegen wir nach links in Richtung Latschenbewuchs ab“ hätte mich schon misstrauisch mach müssen. Der Pfad, am Anfang noch erkennbar, wird mit zunehmender Dauer immer schlechter, ist unter dem Latschenbewuchs häufig nur noch erahnbar und steil und glitschig. Als krönenden Abschluss geht’s dann am Ende in der Direttissima hinauf zu eine schmalen Scharte. Da angekommen, bin ich schon fix und foxi, aber hier kann man nicht mal seinen Rucksack absetzen, um ein wenig zu verschnaufen, so eng ist es. Also bleibt nur der sofortige Abstieg auf der anderen Seite wieder senkrecht hinunter durch eine drahtseilversicherte (immerhin!) Felsrinne – und das alles mit meinem Gepäck und bei sicher mehr als 30° C.
Auch der weitere Weg entlang des Raffen und des Hochalpenkopfes bleibt schwieriges Terrain – und dann passiert’s. Vermutlich aufgrund des hohen Flüssigkeitsverlustes durch Anstrengung und Hitze erwischt mich aus, im wahrsten Sinne des Wortes, heiterem Himmel ein Wadenkrampf, der mich stürzen und etliche Meter einen steilen Hang hinunterrutschen lässt. Ich lerne, es ist gar nicht so einfach, mit Krampf und schwerem Rucksack wieder hinauf auf den Weg zu kraxeln. Glücklicherweise gibt’s keine Verletzungen und der Krampf geht auch wieder ziemlich rasch vorüber. Ich bin dann aber doch recht froh, endlich die Piesenhauser Hochalm zu erreichen, wo eine ausgiebige Mittagsrast jetzt ein unbedingtes Muss ist. Bis hierher habe ich gut drei Stunden gebraucht, der Wanderführer gibt dafür 1. Stunde 15 an. Als ich das dem Hüttenwirt zeige, schüttelt er nur den Kopf und versichert mir, meine drei Stunden seien ganz normal gewesen für diesen Abschnitt. Gestärkt und ausgeruht ist der weitere Weg kein Problem mehr und so erreiche im am späten Nachmittag, wie vorgesehen, Marquartstein. Hier tut sich aber nun wieder ein altbekanntes Problem auf: Es gibt drei Gasthöfe, einer ist wegen Renovierung geschlossen, einer hat den Beherbergungsbetrieb aufgegeben und der noch verbleibende ist ausgebucht. Was tun? Ich finde heraus, dass es heute noch einen Bus nach Reit im Winkl gibt und das von dort eine attraktive Extrarunde des Maximiliansweges erwandert werden kann. Also fahre ich da erst mal hin. Das ist ja ein Touristenort, also sollte auch noch ein Zimmer zu bekommen sein. Das gelingt allerdings nur mit Mühe und Not – in Bayern sind noch Sommerferien – und das auch nur für eine Nacht. Eigentlich wöllte ich zwei Nächte bleiben, um mit leichtem Gepäck die Extrarunde zu laufen. Geht nun nicht, mal sehen wie’s morgen weitergeht.
Mein erster Weg nach dem Frühstück führt mich zur Touristeninformation mit einer einzigen Frage: Gibt es einen Wanderweg von Reit im Winkl nach Ruhpolding? Da wäre nämlich mein nächster Etappenort, den ich auch gerne wieder wandernd erreicht hätte – und siehe da, es gibt einen. In einem Rutsch wäre der Weg zu lang; ihn auf zwei Tage aufzuteilen, geht aber auch nicht, da es zwischendrin zwar bewirtschaftete Almen aber keine Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Doch die Dame von der Touristeninformation weiß Rat: Ich könnte bis zum Weitsee ein Stück mit dem Bus zurücklegen und hätte dann von dort noch eine gut sechsstündige Wanderung vor mir. Das klingt sehr gut, zumal der Bus in einer Viertelstunde direkt hier vor der Tür abfährt. Na, besser kann es doch gar nicht kommen. Doch was nicht kommt, ist der Bus. Niemand weiß, warum nicht, und auch eifrigstes Fahrplanstudium durch mehrere Mitarbeiterinnen der Touristeninformation führt nur zu dem Schluss, eigentlich müsste er gekommen sein – je nun, ist halt ein Bus der Deutschen Bahn. Der nächste würde, wenn überhaupt, erst in drei Stunden fahren, es ist Sonntag, und das wird mir zu spät. Daher bestelle ich mir kurzerhand ein Taxi und lasse mich zum Startpunkt meiner heutigen Etappe bringen. Und die ist wirklich großartig. Die zu bewältigenden Höhenmeter halten sich in Grenzen; immer wieder geht es im Wald an plätschernden Bachläufen entlang – bei mindestens 32° C keineswegs zu verachten; dann wieder wandert man über offenes Almgelände mit fantastischen Ausblicken in die umgebende Berglandschaft; und was das Beste ist: Einige Almen sind bewirtschaftet, so dass ich dort wunderbar im Schatten sitzend meinen Durst löschen und den direkt vor Ort produzierten Käse genießen kann. Auf diese Weise erreiche ich ganz entspannt am späten Nachmittag Ruhpolding und auch die Zimmersuche klappt mit einigen Telefonaten erstaunlich rasch. Die ersten niederschmetternden Landtagswahlprognosen aus Sachsen und Thüringen schaue ich mir noch an, aber dann muss ich los, sie mir schön essen und trinken. Aber das gestaltet sich gar nicht so einfach, weil in zahlreichen Lokalitäten mit viel Tracht, Tischingdarassabumm und reduzierter Bierzeltküche die feuchtfröhlichen Feierlichkeiten anlässlich des heutigen Georgirittes begangen werden. Aber ein wenig abseits der Innenstadt werde ich in einem Ristorante doch noch fündig.
Mein Wanderführer veranschlagt für die nächste Etappe nach Bad Reichenhall neun Stunden Gehzeit. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit seinen Zeitangaben muss ich wohl mindestens noch mal zwei Stunden drauf rechnen und dann ich kann ich die Tour, so wie sie beschrieben ist, gleich drangeben, da es unterwegs auch keine weitere Übernachtungsmöglichkeit gibt, um die Etappe zweizuteilen. Die Wegführung ist zudem bis Inzell, zumindest der Karte und der Beschreibung nach, auch nicht sonderlich attraktiv, überwiegend geht es durch bebautes Siedlungsgebiet. Also muss eine Alternative her, wenn man nicht gleich die ganze Strecke mit Bus und Bahn zurücklegen will, was angesichts des wunderschönen Wanderwetters – die Hitze hat nachgelassen, der Himmel strahlt immer noch tiefblau – äußerst bedauerlich wäre. Jetzt erweist sich eine kleine Wanderkarte, die ich in der Touristeninfo in Reit im Winkl bekommen habe, als sehr hilfreich. Statt auf dem Maximiliansweg weiterzulaufen nehme ich ab Ruhpolding den wesentlich kürzeren und angenehmeren Salzalpensteig, der mich durch die Wiesenlandschaft um Ruhpolding zunächst Richtung Laubau und dann durch die grandiose Almlandschaft des Schwarzachentals führt. Hier reihen sich die Schwarzachenalm, die Keitl-Alm, die Bichleralm und die Herbacheralm wie Perlen auf einer Schnur aneinander. Überall würde man gerne einkehren, aber dann würde aus der sechsstündigen Tour auch schnell ein Tagesunternehmen und ich will am Schluss für das letzte Stück noch einen Bus erwischen, um nicht an der Alpenstraße entlang laufen zu müssen. Also verkneife ich mir das und hebe mir noch ein wenig Zeit für das Highlight des Weges auf. An der Herbacheralm, die des Öfteren schon Drehort für div. Filme war, beginnt nämlich die Schwarzachenklamm. Man muss sich dort aufmerksam bewegen und sollte auch nur an einigen Stellen verweilen, dort aber ruhig länger, weil die Schlucht sehr steinschlaggefährdet ist. Aber es ist ein atemberaubend schöner Wegabschnitt von etwa einer Stunde Dauer, der dann in Weißbach an der Alpenstraße rauskommt. Hier steige ich dann in den Bus nach Bad Reichenhall und werde innerhalb einer Viertelstunde aus der Einsamkeit einer Gebirgsschlucht in eines der mondänsten Heilbäder Bayerns katapultiert. Nach einem kurzen Spaziergang durch den Kurpark im Hotel angekommen, klar, nicht ganz billig hier aber dafür direkt in der Stadt, bin ich sehr zufrieden mit der gewählten Wegvariante, habe ich doch auch noch Zeit für einen schönen Stadtrundgang, natürlich mit einem Besuch im Kurcafé.
Nun ist schon, ehe man sich’s versieht, die letzte Etappe von Bad Reichenhall nach Berchtesgaden am Königssee angesagt. Zunächst fährt man am besten ein kleines Stück mit dem Stadtbus nach Bayrisch Gmein. Auf dem Weg zur Bushaltestelle spaziere ich noch einmal ganz langsam an dem mächtigen Gradierwerk vorbei, um intensiv die heilkräftige, solegeschwängerte Luft in meine Lungen zu saugen, allerdings um den Preis, dass mir der Bus gerade vor der Nase wegfährt. Aber egal, in 20 Minuten kommt der nächste.
Am Wanderzentrum von Bayrisch Gmein beginnt, neben zahlreichen weiteren Wanderwegen auch die letzte Etappe des Maximilansweges. Sie dauert schon so ihre 5 - 6 Stunden und es ist auch noch mal mächtig heiß geworden, aber die zu bewältigenden Höhenmeter sind moderat. Z.T. wurde dieser Weg in früheren Zeiten intensiv für den Salztransport genutzt. Davon kündet z.B. noch ein massiver Turm am Wegesrand, ein sogen. Hallthurm, in dem das Salz zwischengelagert wurde, bevor es in verschiedene Richtungen weitergetragen wurde. Ab diesem historischen Bauwerk verläuft der Weg für etwa 2 Stunden sehr schön in leichtem Auf und Ab bis zu einem kleinen Weiler auf „Maximilians Reitweg“, eine Art Panoramaweg oberhalb eines breiten Tales und gibt immer wieder weite Ausblicke auf die grandiose Bergwelt der Berchtesgadener Alpen frei. Aufgrund der Hitze ist die Sicht allerdings ein wenig eingetrübt. Nach und nach füllt dann auch die Rückseite des gewaltigen Watzmannmassivs – Vater, Mutter und sieben Kinder – das Blickfeld immer vollständiger aus je näher man nach Berchtesgaden kommt. Hier muss natürlich die zugehörige Sage erzählt werden:
Einst, in undenklicher Frühzeit, lebte und herrschte in diesen Landen ein rauher und wilder König, welcher Watzmann hieß. Er war ein grausamer Wüterich, der schon Blut getrunken hatte aus den Brüsten seiner Mutter. Liebe und menschliches Erbarmen waren ihm fremd, nur die Jagd war seine Lust, und da sah zitternd sein Volk ihn durch die Wälder toben mit dem Lärm der Hörner, dem Gebell der Rüden, gefolgt von seinem ebenso rauhen Weibe und seinen Kindern, die zu böser Lust auferzogen wurden. Bei Tag und bei Nacht durchbrauste des Königs wilde Jagd die Gefilde, die Wälder, die Klüfte, verfolgte das scheue Wild und vernichtete die Saat und mit ihr die Hoffnung des Landmanns. Gottes Langmut ließ des Königs schlimmes Tun noch gewähren.
Eines Tages jagte der König wiederum mit seinem Troß und kam auf eine Waldestrift, auf welcher eine Herde weidete und ein Hirtenhäuslein stand. Ruhig saß vor der Hütte die Hirtin auf frischem Heu und hielt mit Mutterfreude ihr schlummerndes Kindlein in den Armen. Neben ihr lag ihr treuer Hund, und in der Hütte ruhte ihr Mann, der Hirte. Jetzt unterbrach der tosende Jagdlärm den Naturfrieden dieser Waldeinsamkeit; der Hund der Hirtin sprang bellend auf, da warf sich des Königs Meute alsobald auf ihn, und einer der Rüden biß ihm die Kehle ab, während ein anderer seine scharfen Zähne in den Leib des Kindleins schlug und ein dritter die schreckenstarre Mutter zu Boden riß. Der König kam indes nahe heran, sah das Unheil und stand und lachte.
Plötzlich sprang der vom Gebell der Hunde, dem Geschrei des Weibes erweckte Hirte aus der Hüttentüre und erschlug einen der Rüden, welcher des grausamen Königs Lieblingstier war. Darüber wütend fuhr der König auf und hetzte mit teuflischem Hussa Knechte und Hunde auf den Hirten, der sein ohnmächtiges Weib erhoben und an seine Brust gezogen hatte und verzweiflungsvoll erst auf sein zerfleischtes Kind am Boden und dann gen Himmel blickte. Bald sanken beide zerrissen von den Ungetümen zu dem Kinde nieder; mit einem schrecklichen Fluchschrei zu Gott im Himmel endete der Hirte, und wieder lachte und frohlockte der blutdürstige König. Aber alles hat ein Ende und endlich auch die Langmut Gottes.
Es erhob sich ein dumpfes Brausen, ein Donnern in Höhen und Tiefen, in den Bergesklüften ein wildes Heulen, und der Geist der Rache fuhr in des Königs Hunde, die fielen ihn jetzt selbst an und seine Königin und seine sieben Kinder und würgten alle nieder, daß ihr Blut zu Tale rann, und dann stürzten sie sich von dem Berge wütend in die Abgründe. Aber jener Leiber erwuchsen zu riesigen Bergen, und so steht er noch, der König Watzmann, eisumstarrt, ein marmorkalter Bergriese, und neben ihm, eine starre Zacke, sein Weib, und um beide die sieben Zinken, ihre Kinder - in der Tiefe aber hart am Bergesfuß ruhen die Becken zweier Seen, in welche einst das Blut der grausamen Herrscher floß, und der große See hat noch den Namen Königssee, und die Alpe, wo die Hunde sich herabstürzten, heißt Hundstod, und gewann so König Watzmann mit all den Seinen für schlimmste Taten den schlimmsten Lohn und hatte sein Reich ein Ende.[3]
Der Mozart-Radweg führt mich schließlich auf den Spuren von Maximilian II die letzten Kilometer direkt bis in die Stadtmitte. Inzwischen hat es begonnen, heftig zu regnen und da mein Hotel etwas außerhalb von Berchtesgaden in Richtung Ramsau liegt, kann ich meine Hände nun leider nicht mehr zum Abschluss auch noch einmal in den Königssee tauchen, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte.
Wenn ich ein kurzes Resümee ziehen sollte würde ich sagen, ein landschaftlich sehr reizvoller Weg mit interessanten Orten und Sehenswürdigkeiten aber auf zu vielen Abschnitten kein wirklich schöner Wanderweg. Es überwiegen asphaltierte und breite geschotterte Fahrwege, etliche offenbar erst in letzter Zeit angelegt, um dem E-Bike-Hype gerecht zu werden, und meistens der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Das macht das Wandern, insbesondere bei hohen Temperaturen und mit schwererem Gepäck manchmal schon unnötig mühsam. Ich würde den Maximilansweg, mehr noch als ich es ohnehin schon getan habe, allenfalls als grobe Richtschnur betrachten und mir die konkrete Wegführung und Etappenplanung selber zusammenstellen.
Den Wanderführer „Maximiliansweg“ von Andreas Friedrich aus dem Rother-Verlag, aktualisierte 3. Auflage von 2022 halte ich nach meinen Erfahrungen nicht für empfehlenswert. Die Wegbeschreibungen sind oft sehr knapp und oberflächlich, insbesondre erfährt man selten etwas über spezifische Schwierigkeiten bestimmter Wegabschnitte; Informationen zu Einkehr- und Unterkunftsmöglichkeiten sind nicht auf dem aktuellen Stand, auch nicht dem von 2022, und die Wanderzeiten für die einzelnen Etappen sind häufig, selbst nach Einschätzung der Einheimischen, erheblich viel zu kurz angegeben, was durchaus Risiken birgt, wenn man sich daran orientiert.
[1] So der Titel eines Buches von Prof. Friedrich von Bodenstedt, der den König auf dieser Reise begleit und sie aufgezeichnet hat.
[2] Die gut 10 Kilometer lange, weitgehend über die Ostflanke des Berges führende Strecke weist sieben Tunnel, acht Galerien und zwölf Brücken auf. Um den Betrieb auch im Winter aufrechtzuerhalten, wurde über dem Abgrund eine aufwändige Trasse mit abenteuerlichen Serpentinen in die steilen Felswände des Wildalpjochs und des Soins gehauen.
[3] Nach Ludwig Bechstein