|
Europ
Alpen
A AL AND
B
BG BIH BY
CH
CY
CZ
D
DK
E
EST
F FIN FL
GB
GR
H
HR
I
IRL IS
L LT LV M MC MD
MK MNE
N
NL P
PL
RO RSM RUS
S
SK
SLO
SRB
TR
UKR V
W
a n d e r b e r i c h t e - D e u t s c h l a n d
Inhaltsverzeichnis:
• Der Maximiliansweg Von Hans Diem
• Mit den Augen der Eifel
Von Tilman Kleinheins
• Wanderbedingungen in Nordthüringen
Von Dr. Lutz Heidemann
• Der König - Ludwig - Weg Von Günther Krämer
• Themenwanderweg Kultur
Von Willi und Helga
Großkopf
• Runde Hauptstadt -
66 Seen erwandert man auf einem Weg um
Berlin herum
Von Dr. Roland H. Knauer
• Wanderbericht - Der Europäische Ferwanderweg 9
in Mecklenburg-Vorpommern - Ein Flop!
Von Lutz Heidemann
• Wandern "auf hohem Niveau" -
Erfahrungen vom neuen Rheinsteig
Von Lutz Heidemann
• Mit dem Zelt von Lenggries nach
Urdorf am Walchensee
Von Markus Mohr
• Harzwanderung
Mai 2006
Von Gerhard Wandel
• Der Hunsrück
- Terra incognita
Von Werner Hohn
• 220 km unterwegs auf
Forstautobahnen und anderen Schotterwegen
- manchmal auch auf Fußpfaden
Von Hartmut Hermanns
• Entdecken Sie den
Schwarzwald neu
Von
Hans-Georg Sievers
•
Wandern wo andere Rad fahren
Weitwanderwege auf Normal Null
Von Werner Hohn
•
In 6 Tagen 109 km auf der Via Alpina - dem Violetten Weg
von Oberstdorf bis Garmisch
Von Hans Diem
• Eine Wanderung entlang der
deutschen Donau
Von Günther Krämer
•
Durch das Dahner Felsenland
Von Thomas Striebig
•
Pfingsten 2008: Unterwegs im Odenwald
Von Walter Brückner
•
Auf dem Altmühltal-Panoramaweg
Von Harald Vielhaber
• Betrachtungen eines Goldsteigwanderers
Eine Wanderwoche auf dem ehemaligen Burgenweg
im Oberpfälzer Wald
Von Tilman Kleinheins
• Auf dem "Limeswanderweg" von Jagsthausen nach
Lorch
Von Gerhard Wandel
• Wanderroute Moselle
Von Gerhard Wandel
• Auf dem "Goldsteig" durch den Bayerischen Wald
Von Gerhard Wandel
• Auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg
Sommer
2010
Von Wolfgang Dettling
• Auf dem EB unterwegs im Erzgebirge
Drei
Etappen auf dem EB: von Neuhermsdorf über Rechenberg-Bienenmühle,
Deutschgeorgenthal
und Rauschenbach nach Neuhausen und weiter über
Schwartenberg,
Seiffen, Olbernhau und Ansprung nach Pobershau
Von Katharina Wegelt
• Pfingsten 2010
Durch
die südliche Eifel von Brohl am Rhein nach Trier: 22.05. - 04.06.2010
Von Walter Brückner
• Fern, so fern, der Fichtelberg
Bei
einer Wanderung auf dem Kammweg eintauchen in die Geschichte
des
Erzgebirges - und der Schnaps schmeckt nach weißen Gummibärchen
Schwartenberg,
Seiffen, Olbernhau und Ansprung nach Pobershau
Von Franz Lerchenmüller
• "Zehn kleine Negerlein"-Wanderung
Mitgliederwanderung
des Netzwerks aus der Sicht von Gästen
Von Dr. Klaus Stanek, Gast-Mitwanderer
• Pfälzer Wald Tour im Mai 2011
Von Hans Diem
• Ein ganzer Jakobsweg in zwei Tagen
September
2009: Vom Rhein an die Mosel
Von Werner Hohn
Der
Maximiliansweg
Eine
Überschreitung der deutschen Alpen von Lindau nach Berchtesgaden
Von
Hans Diem
Die
Wegbeschreibung von Hans Diem kann bestellt werden bei ALPINA-Buchversand,
Postfach 1211, D-85606 Aschheim.
 Der Maximiliansweg ist benannt
nach König Maximilian II. von Bayern, der im Jahr 1858 eine Alpenreise von
Lindau nach Berchtesgaden unternahm. Er wurde meist in Kutschen gefahren, ist
aber auch teilweise geritten und zu Fuß auf einige Gipfel gestiegen. Im Jahr
1991 hat der DAV den Maximiliansweg eröffnet, er führt natürlich als reiner
Fußweg in 22 Tagen 370 km weit von Lindau nach Berchtesgaden über fünf
verschiedene Gebirge: 3 Tage lang durch das österreichische
Bregenzerwald-Gebirge, 3 Tage über die Allgäuer Alpen, 4 Tage über die
Ammergauer Alpen, 6 Tage über die Bayerischen Alpen, 5 Tage über die
Chiemgauer Alpen und 1 Tag in den Berchtesgadener Alpen. Der Maximiliansweg ist benannt
nach König Maximilian II. von Bayern, der im Jahr 1858 eine Alpenreise von
Lindau nach Berchtesgaden unternahm. Er wurde meist in Kutschen gefahren, ist
aber auch teilweise geritten und zu Fuß auf einige Gipfel gestiegen. Im Jahr
1991 hat der DAV den Maximiliansweg eröffnet, er führt natürlich als reiner
Fußweg in 22 Tagen 370 km weit von Lindau nach Berchtesgaden über fünf
verschiedene Gebirge: 3 Tage lang durch das österreichische
Bregenzerwald-Gebirge, 3 Tage über die Allgäuer Alpen, 4 Tage über die
Ammergauer Alpen, 6 Tage über die Bayerischen Alpen, 5 Tage über die
Chiemgauer Alpen und 1 Tag in den Berchtesgadener Alpen.
Der
Maximiliansweg ist ein aussichtsreicher Balkonweg am Nordrand der Alpen,
einerseits mit Tiefblick auf das bayrische Alpenvorland mit Wäldern, Wiesen,
Seen und Dörfern, andererseits mit Ausblick auf die prächtige Bergwelt der
Alpen. Aus schmucken Dörfern geht es durch Bergwälder hinauf zu Almen und
Blumenwiesen, zu Hütten mit Bewirtung und Unterkunft, Bergwege führen weiter
auf grüne Joche, Steige klettern auf felsige Gipfel mit Rundschau. Da drängt
die Neugier weiter, ein Joch, ein Gipfel nach dem anderen lockt. Die Route benützt
die unterschiedlichsten Wege von der Autostraße bis zum Felssteig. Da sie nicht
durchgehend markiert und beschildert ist, braucht man die Wegbeschreibung und
Wanderkarten.
Auf
der originalen „Gipfelroute“ steigen erfahrene Bergwanderer mehrmals über
felsige Grate und Gipfel, weniger ehrgeizige können auf der leichteren
„Jochroute“ diese Teilstrecken meiden und umgehen.
Der
Maximiliansweg als Frühjahrstour
Hans
Diem mit Zeltausrüstung im Mai 1998
 28.4.
abends, raus aus dem Zug, hin zum Hafen von Lindau, da halte ich den Fotoapparat
in den Regen für das erste Foto mit dem Bodensee vor schneeweißen Bergen.
Endlich mit Bedacht den ersten Schritt getan Richtung Berchtesgaden, zunächst
auf dem Bodensee-Uferweg durch viele Regenpfützen gestapft auf Bregenz zu.
Ungeniert stelle ich in der Dämmerung das Zelt an das Bodenseeufer, die
Regenwolken verziehen sich, schöne Abendstimmung kommt auf, und am Morgen weckt
mich Vogelgezwitscher und 28.4.
abends, raus aus dem Zug, hin zum Hafen von Lindau, da halte ich den Fotoapparat
in den Regen für das erste Foto mit dem Bodensee vor schneeweißen Bergen.
Endlich mit Bedacht den ersten Schritt getan Richtung Berchtesgaden, zunächst
auf dem Bodensee-Uferweg durch viele Regenpfützen gestapft auf Bregenz zu.
Ungeniert stelle ich in der Dämmerung das Zelt an das Bodenseeufer, die
Regenwolken verziehen sich, schöne Abendstimmung kommt auf, und am Morgen weckt
mich Vogelgezwitscher und Entengeschnatter. Beschaulich und ideal zum Eingewöhnen
zieht der „MaxWeg“ anfangs drei Tage lang fremd im österreichischen aber
reizvollen Bregenzerwald. 56 km weit
mit 2110 m Aufstieg führt er über Hügel mit Wald und Wiesen auf den Grenzübergang
zu, über die Schneider Spitze, den Brüggele Kopf 1182 m, den Rotenberg.
Dazwischen liegen die kleinen Bauerndörfer Alberschwende, Lingenau und Hittisau
mit alten Wälderhäusern und urigen Gaststätten. Entengeschnatter. Beschaulich und ideal zum Eingewöhnen
zieht der „MaxWeg“ anfangs drei Tage lang fremd im österreichischen aber
reizvollen Bregenzerwald. 56 km weit
mit 2110 m Aufstieg führt er über Hügel mit Wald und Wiesen auf den Grenzübergang
zu, über die Schneider Spitze, den Brüggele Kopf 1182 m, den Rotenberg.
Dazwischen liegen die kleinen Bauerndörfer Alberschwende, Lingenau und Hittisau
mit alten Wälderhäusern und urigen Gaststätten.
 Über die Allgäuer
Alpen führt der MaxWeg dann drei Tage lang auf 60 km Strecke mit 2700 m
Aufstieg. Vom Weg über die sieben Gipfel der Nagelfluh-Kette habe ich eine
fantastische Aussicht, vom höchsten, dem Hochgrat 1834 m zurück zum
glitzernden Bodensee, und hinaus aufs grüne Flachland, und hinein in eine noch
winterliche Bergwelt. Im Juni blühen hier schönste und seltene Blumen. In
diesem Mai hat es allerdings oben noch stellenweise Schnee, deshalb habe ich
auch Steigeisen dabei. Mal schinde ich mich durch knietiefen Nass-Schnee
bergauf, balanciere über eine rassige Firnschneide, steige in Riesenschritten
auf festem Firn steile Rinnen hinab. Der Abstieg vom 6. Gipfel, der Ostgrat des
Stuiben hat eine kurze Kletterstelle mit Drahtseil versichert. Über die Allgäuer
Alpen führt der MaxWeg dann drei Tage lang auf 60 km Strecke mit 2700 m
Aufstieg. Vom Weg über die sieben Gipfel der Nagelfluh-Kette habe ich eine
fantastische Aussicht, vom höchsten, dem Hochgrat 1834 m zurück zum
glitzernden Bodensee, und hinaus aufs grüne Flachland, und hinein in eine noch
winterliche Bergwelt. Im Juni blühen hier schönste und seltene Blumen. In
diesem Mai hat es allerdings oben noch stellenweise Schnee, deshalb habe ich
auch Steigeisen dabei. Mal schinde ich mich durch knietiefen Nass-Schnee
bergauf, balanciere über eine rassige Firnschneide, steige in Riesenschritten
auf festem Firn steile Rinnen hinab. Der Abstieg vom 6. Gipfel, der Ostgrat des
Stuiben hat eine kurze Kletterstelle mit Drahtseil versichert.

Ab Sonthofen
steige ich als Abstecher auf den freistehenden Grünten 1738 m, da war
seinerzeit auch Max II. oben, der Gipfel bietet ein sensationelles Panorama. Der
Weiterweg zieht aus blühenden Blumenwiesen hinauf zu Tiefenbacher Eck und
Spieser 1651 m, oben lastet noch schwer der nasse Frühjahrsschnee. Nach einer
gemütlichen Einkehr in Unterjoch marschiere ich dann im flachen Vilstal mit
langen Beinen flott auf Pfronten zu. Großeinkauf im Supermarkt, die Hälfte
gegessen, den Rest in den Rucksack. Schon bin ich im Aufstieg zum Falkenstein
mit Ruine, weiter über den schroffen Zwölferkopf 1293 m mit schönsten
Ausblicken nach Füssen am Lech, eine sehenswerte Kleinstadt.
 Nach den Schlössern
Hohenschwangau und Neuschwanstein kommt der anspruchsvollste Teil des MaxWeges,
die Ammergauer Alpen in vier Tagen mit 55 km und 3088 m Aufstieg, natürlich
mit Ausweichen für weniger angriffslustige Jochbummler. Vom Tegelberg-Haus erst
den Abstecher auf den Branderschrofen, dann weiter über die Krähe 2012 m zur
Hochplatte 2082 m. Er ist der höchste Punkt des MaxWeges und ganz schön alpin
auf seinem teils beidseitig ausgesetztem Grat. Der Ausblick ist grandios und so
aufregend wie die Nach den Schlössern
Hohenschwangau und Neuschwanstein kommt der anspruchsvollste Teil des MaxWeges,
die Ammergauer Alpen in vier Tagen mit 55 km und 3088 m Aufstieg, natürlich
mit Ausweichen für weniger angriffslustige Jochbummler. Vom Tegelberg-Haus erst
den Abstecher auf den Branderschrofen, dann weiter über die Krähe 2012 m zur
Hochplatte 2082 m. Er ist der höchste Punkt des MaxWeges und ganz schön alpin
auf seinem teils beidseitig ausgesetztem Grat. Der Ausblick ist grandios und so
aufregend wie die Gipfel-Überschreitung. Die Kenzen Hütte unterhalb hat schon
geöffnet, als einziger Gast werde ich bestens versorgt und schlafe prominent im
Einzelzimmer. Gipfel-Überschreitung. Die Kenzen Hütte unterhalb hat schon
geöffnet, als einziger Gast werde ich bestens versorgt und schlafe prominent im
Einzelzimmer.
Der Weiterweg über den Feigenkopf zieht über steilen Grasflanken am und auf dem
Grat schön hinauf zur Klammspitze 1924 m. Aber der steile Abstieg ist voll
Schnee, bei größter Vorsicht und mit den Steigeisen komme ich sicher hinab. Von
der Brunnenkopf-Hütte kurz auf den Brunnenkopf 1718 m gestiegen, der war auch
ein Ziel von König Max. Hier war schließlich sein Jagdgebiet, vom Jagdhaus in
Linderhof konnte er auf einem Reitweg weit hinauf reiten auf kleinen Norweger
Pferden. Über den Hennenkopf 1768 m komme ich schneefrei zum Teufelstättkopf
1758 m. Da zelte ich gut am Waldrand, am Morgen weckt mich das Balzen einer
Schar Birkhühner. Ich schaue ihnen lange zu und stiege dann ab ins urige
Unterammergau. Es folgt der Aufstieg zum Hörnle 1548 m mit Hütte und wunderbarem
Ausblick, Abstieg neben einer riesigen Mure nach Grafenaschau und dann 2 Stunden
lang flott auf einer Teerstraße nach Eschenlohe marschiert mit Blick auf das
blumenreiche Murnauer Moos.
 Die Bayerischen
Alpen sind der längste Abschnitt mit sechs Tagen auf 100 km Weglänge bei
6200 m Aufstieg. Der MaxWeg beginnt mit der rassigen Überschreitung von
Heimgarten 1790 m und Herzogstand 1731 m auf einem gesicherten Gratweg mit
Tiefblick auf Kochelsee und Walchensee. Nach der Querung der Kesselberg-Straße
schaue ich vom Jochberg 1565 m begeistert rundum, gehe dann lange flach und
verwinkelt durch Wald und über Almen, steige anschließend steil bergauf zum
Kreuz auf der Benediktenwand 1800 m. Tief unter mir liegt die alte Tutzinger Hütte
noch umgeben von Schnee, sie wurde inzwischen abgerissen und neu gebaut. Der
Weiterweg ist noch schneebedeckt, es ist fester Firn und gut zu gehen. Der
Tiefblick vom Brauneck ins Isartal ist grandios. Die Bayerischen
Alpen sind der längste Abschnitt mit sechs Tagen auf 100 km Weglänge bei
6200 m Aufstieg. Der MaxWeg beginnt mit der rassigen Überschreitung von
Heimgarten 1790 m und Herzogstand 1731 m auf einem gesicherten Gratweg mit
Tiefblick auf Kochelsee und Walchensee. Nach der Querung der Kesselberg-Straße
schaue ich vom Jochberg 1565 m begeistert rundum, gehe dann lange flach und
verwinkelt durch Wald und über Almen, steige anschließend steil bergauf zum
Kreuz auf der Benediktenwand 1800 m. Tief unter mir liegt die alte Tutzinger Hütte
noch umgeben von Schnee, sie wurde inzwischen abgerissen und neu gebaut. Der
Weiterweg ist noch schneebedeckt, es ist fester Firn und gut zu gehen. Der
Tiefblick vom Brauneck ins Isartal ist grandios.
 In
Lenggries kann ich mich gut
erholen, steige auf zum Geierstein 1491 m mit Weitblick zurück bis zur
Zugspitze. In Wald und Almwiesen geht es flach weiter zum Fockenstein 1564 m, da
liegt mir der Tegernsee umwerfend schön zu Füßen. Im Abstieg nach Bad Wiessee
liegt die Waxelmoos-Almhütte, die hat eine Veranda unter einem großen Vordach,
das ist ein vorzüglicher Zeltplatz für mich. kurzen Umweg über Bayrischzell. Der Ort bietet
nämlich ganz neu den damaligen Weg von König Max II. auf den Wendelstein an!
Begeistert steige ich auf diesem „Königsweg“ In
Lenggries kann ich mich gut
erholen, steige auf zum Geierstein 1491 m mit Weitblick zurück bis zur
Zugspitze. In Wald und Almwiesen geht es flach weiter zum Fockenstein 1564 m, da
liegt mir der Tegernsee umwerfend schön zu Füßen. Im Abstieg nach Bad Wiessee
liegt die Waxelmoos-Almhütte, die hat eine Veranda unter einem großen Vordach,
das ist ein vorzüglicher Zeltplatz für mich. kurzen Umweg über Bayrischzell. Der Ort bietet
nämlich ganz neu den damaligen Weg von König Max II. auf den Wendelstein an!
Begeistert steige ich auf diesem „Königsweg“ bergauf zur
Wendelstein-Kapelle, weiter unter Seilbahntouristen auf einem Wendelweg mit
Seilgeländer in steiler Felswand zum Gipfel des Wendelstein 1838 m. Er bietet
ein Panorama von Feinsten bis hin zum Alpen-Hauptkamm und hinaus bis München.
Wer hier oben schönes Wetter und Fernsicht hat, kommt nicht so leicht los. Auf
festem Frühjahrsfirn kann ich vom Gipfel direkt Richtung Inntal absteigen, es
ist der letzte Schnee auf meiner Frühjahrstour. bergauf zur
Wendelstein-Kapelle, weiter unter Seilbahntouristen auf einem Wendelweg mit
Seilgeländer in steiler Felswand zum Gipfel des Wendelstein 1838 m. Er bietet
ein Panorama von Feinsten bis hin zum Alpen-Hauptkamm und hinaus bis München.
Wer hier oben schönes Wetter und Fernsicht hat, kommt nicht so leicht los. Auf
festem Frühjahrsfirn kann ich vom Gipfel direkt Richtung Inntal absteigen, es
ist der letzte Schnee auf meiner Frühjahrstour.
 Von Nußdorf am Inn gehe ich
die Chiemgauer Alpen an und abschließend kurz in den Berchtesgadener
Alpen nach Berchtesgaden. Sechs Tage für 96 km Weg mit 5400 m Aufstieg. Der
lange Aufstieg zur Hochries 1569 m mit Hütte ist nicht beschildert und nur mit
genauem Kartenstudium zu finden. Weiter geht es über Hohenaschau auf die
Kampenwand 1663 m. Auch ein Höhepunkt, ein Felsgipfel mit Kaiserblick, zum
Wilden und Zahmen Kaiser, andererseits zum Chiemsee. Ich turne kurz an 20 Meter
Drahtseil hinab und schon bin ich auf dem Weg zur Hochplatte. Tiefblick ins
Achental, voraus alle restlichen Gipfel bis hin zum Watzmann. Runter nach
Marquartstein, hinauf auf den Hochgern 1748 m: Rückblick, Ausblick, ständig
neue Eindrücke, andere Stimmungen, schauen, staunen und knipsen, mein
Fotoapparat ist gut beschäftigt. Weiter zum Hochfelln 1664 m, da ist Von Nußdorf am Inn gehe ich
die Chiemgauer Alpen an und abschließend kurz in den Berchtesgadener
Alpen nach Berchtesgaden. Sechs Tage für 96 km Weg mit 5400 m Aufstieg. Der
lange Aufstieg zur Hochries 1569 m mit Hütte ist nicht beschildert und nur mit
genauem Kartenstudium zu finden. Weiter geht es über Hohenaschau auf die
Kampenwand 1663 m. Auch ein Höhepunkt, ein Felsgipfel mit Kaiserblick, zum
Wilden und Zahmen Kaiser, andererseits zum Chiemsee. Ich turne kurz an 20 Meter
Drahtseil hinab und schon bin ich auf dem Weg zur Hochplatte. Tiefblick ins
Achental, voraus alle restlichen Gipfel bis hin zum Watzmann. Runter nach
Marquartstein, hinauf auf den Hochgern 1748 m: Rückblick, Ausblick, ständig
neue Eindrücke, andere Stimmungen, schauen, staunen und knipsen, mein
Fotoapparat ist gut beschäftigt. Weiter zum Hochfelln 1664 m, da ist Hochbetrieb über die Seilbahn. Schön hinab nach Ruhpolding, flach nach Inzell,
hinauf auf den Zwiesel, weiter auf den
Hochstaufen 1771 m mit Hütte. Wunderbar,
ich sitze bei Abendstimmung lange oben und bekomme nicht genug vom Schauen. Ich
übernachte dann in der Gipfelhütte, der Wirt freut sich, weil da einer ab
Lindau zu Fuß gekommen ist.
Hochbetrieb über die Seilbahn. Schön hinab nach Ruhpolding, flach nach Inzell,
hinauf auf den Zwiesel, weiter auf den
Hochstaufen 1771 m mit Hütte. Wunderbar,
ich sitze bei Abendstimmung lange oben und bekomme nicht genug vom Schauen. Ich
übernachte dann in der Gipfelhütte, der Wirt freut sich, weil da einer ab
Lindau zu Fuß gekommen ist.
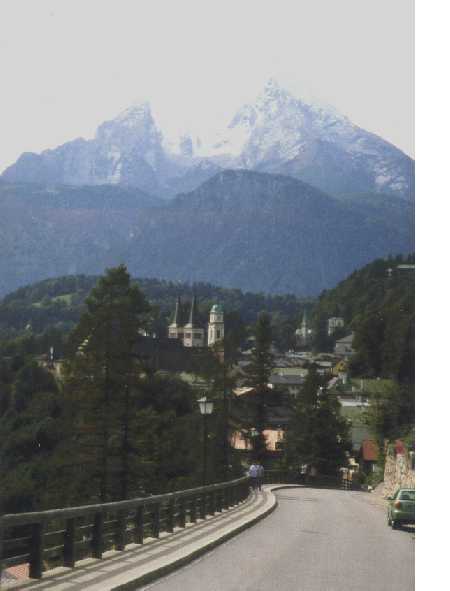 Die letzte Etappe des MaxWeg
von Bad Reichenhall nach Berchtesgaden sind gemütliche 4:30 Stunden. Das ist
mir zu wenig von den Berchtesgadener Alpen. Ich mache kurzentschlossen einen
Abstecher und steige hinauf zum Berchtesgadener Hochthron 1972 m, habe abends
grandiosen Blick auf mächtige Gebirge wie Dachstein, Watzmann und Hochkkalter
bei dramatischer Bewölkung. Bleibe über Nacht im Stöhr Haus, steige am Morgen
ab und gehe hinein ins schöne Berchtesgaden. Dieser Abstecher war mir ein krönender
Abschluss des königlich-bayrischen Maximiliansweges. Die letzte Etappe des MaxWeg
von Bad Reichenhall nach Berchtesgaden sind gemütliche 4:30 Stunden. Das ist
mir zu wenig von den Berchtesgadener Alpen. Ich mache kurzentschlossen einen
Abstecher und steige hinauf zum Berchtesgadener Hochthron 1972 m, habe abends
grandiosen Blick auf mächtige Gebirge wie Dachstein, Watzmann und Hochkkalter
bei dramatischer Bewölkung. Bleibe über Nacht im Stöhr Haus, steige am Morgen
ab und gehe hinein ins schöne Berchtesgaden. Dieser Abstecher war mir ein krönender
Abschluss des königlich-bayrischen Maximiliansweges.
Wenn sich
damals die hohe Reisegesellschaft vortrefflich amüsiert hat auf ihrer
Alpenreise, so habe ich mich königlich belohnt gefühlt. Mit etwas Geld, dem
Rucksack, dem Zelt, dem Frühjahrsschnee, dem Alleinsein auf den hohen Wegen bin
ich gut zurecht gekommen, habe mich stark gefühlt und viel jubelnde Freude gespürt.
Solch gute Erfahrungen wünsche ich jedem MaxWeg-Begeher.
Aktuelle
Ergänzungen von Hans Diem zum Maximiliansweg
(Stand:
Frühjahr 2005)
Die
Route, die 1991 vom Deutschen Alpenverein festgelegt wurde, ist meist mit
lokalen Wegweisern versehen, aber nicht als „MaxWeg“ markiert und auch nur
gelegentlich mit DAV-Tafeln „Maximiliansweg - E4“ versehen. Entgegen meiner
Mitteilung schreibt Herr Froelich vom DAV in seinem Grußwort auf Seite 8 der
Wegbeschreibung, er habe die Markierung des Weges organisiert. Im Juni 2000 war
dieser Zustand wie 1998.
Änderungen
am Wegverlauf sind auszuschließen. Dagegen sind Änderungen von
Hüttenpächtern und Hütten-Telefonnummern ständig zu befürchten, da hilft
nur eine aktuelle Rückfrage beim Alpenverein.
Im
Juni 2000 war ich auf dem MaxWeg und hatte notiert:
1.
Seite 33: Vereinfachte Wegführung zwischen Lindau und Bregenz durch eine
neue Fußgängerbrücke über den Bach Leiblach.
2.
Seite 45: Neue Wegführung von Gunzesried nach Sonthofen durch einen
neu angelegten und beschilderten Weg ab dem Mauthäusle
am Hüttenberger Eck.
3.
Seite 107: Kenzen-Hütte, neue Hütten-Telefonnummer 08368-390
4.
Seite 110: Kessel-Alm, neue Telefonnummer 08028-2602
Im
Grundsatz gilt, dass jede Angabe zur Infrastruktur von einer Woche auf die
andere überholt sein kann. Der MaxWeg ist da im Vorteil, weil sich in kurzen
Abständen 58 Dörfer und Hütten anbieten für 22 Tage.
Erschienen
in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 16 - April
2005
Mit
den Augen der Eifel
Auf
dem Karl-Kaufmann-Weg vom Ahrtal an die Mosel
Von
Tilman Kleinheins
Zuerst
Zahlen und Fakten: 16 Hauptwanderwege, 4 Regionalwanderwege, 4 Fernwanderwege
und 1 Weitwanderweg durchziehen laut offiziellem Führer, 38. Auflage, die
Eifel. Viele Tausende markierte Kilometer Wandern. Das Wanderkartenwerk des
Eifelvereins umfasst 40 Blätter im Meßtischmaßstab und 7 Blätter der 2 cm
– Karten. Höchste Erhebung: Hohe Acht mit 747 m N.N., gelegen in der Hohen
Eifel. Im Norden begrenzt von der Linie Bonn – Euskirchen – Aachen, im Osten
und im Süden nasse Grenzen mit Rhein und Mosel. Nach Westen sind der
Fortsetzung des Naturraums Eifel nur menschliche Grenzen gesetzt, an sich sind
Hohes Venn und Luxemburger Land Bestandteil der gleichen erdgeschichtlichen
Entwicklung.
Nach
den Fakten die Frage: wie kommt unsereins auf die Idee, ausgerechnet in einer
ganz bestimmten Region wandern zu wollen und nicht in einer ganz anderen. Durch
welche Einflüsse reift meist binnen Wochen und Monaten der Entschluß, wird
konkreter, äußert sich schließlich im Kauf von Wanderkarten und Führern ?
Bis plötzlich die Idee einer Streckentour klar vor dem inneren Auge liegt. Daß
die Impulse vielfältig sind, ist klar, in meinem Fall waren es die bekannten
Eifelkrimis von Berndorf, die mich neugierig auf die Region machten. plötzlich die Idee einer Streckentour klar vor dem inneren Auge liegt. Daß
die Impulse vielfältig sind, ist klar, in meinem Fall waren es die bekannten
Eifelkrimis von Berndorf, die mich neugierig auf die Region machten.
Der
HWW 2, Karl – Kaufmann – Weg, Brühl – Trier, 183 km
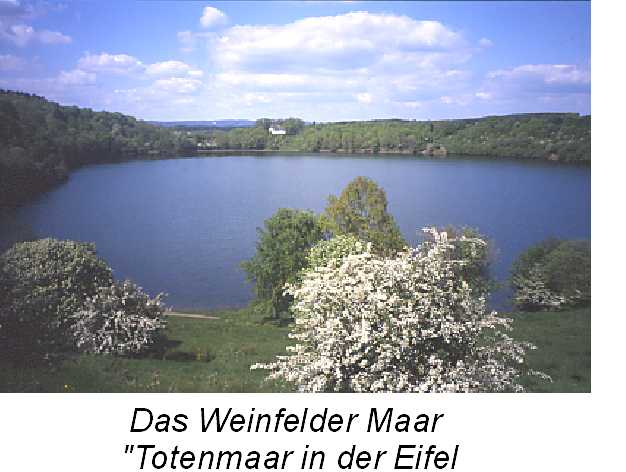 Genug
geschwärmt, wo geht´s los ? Ahrweiler (Betonung auf der ersten Silbe) im
Ahrtal, nördlichstes Rotweinanbaugebiet Deutschlands, bequem von Hamburg via
Nachtzug nach Köln, über Remagen und den Ahrtalexpress erreichbar. Morgens um
9:00 Uhr starte ich in den ersten Wandertag, der leider zum Großteil verregnet
ist, aber dennoch herrliche Eindrücke vermittelt: wunderbare Tiefblicke ins
tief eingeschnittene Ahrtal samt seinen Winzerorten und steilen Rebhängen,
südwestlich am Horizont zu erkennen die „Hohe Acht“, davor bewaldete
Hügelketten, die ihre Farbe vom nahen grün ins ferne blau wechseln.
Tiefhängende Wolken und Nebelfetzen ziehen aus den Tälern auf. Die Markierung
von Anfang an zwar äußerst vielfältig (manche Bäume gleichen
Kommunikationszentren), aber stets gut und zuverlässig. Eines sei
vorweggenommen: rund 60 % des gesamten Weges verlief auf Hartbelägen aller Art.
Mit Interesse habe ich deshalb gelesen, dass auch der Eifel – Verein im Rahmen
des Projektes „Wanderbares Deutschland“ sein Wegenetz überprüft. Nur
posititv, wenn tatsächlich hier und da Streckenverlegungen stattfinden (Meulenwald
!) und Wegewarte wie Vereinsfunktionäre der Einmischung von außen offen
begegnen. Es kann eigentlich nur n o c h besser werden, als es schon ist, denn:
tatsächlich keine andere Mittelgebirgstour hat mich bisher so begeistert. Genug
geschwärmt, wo geht´s los ? Ahrweiler (Betonung auf der ersten Silbe) im
Ahrtal, nördlichstes Rotweinanbaugebiet Deutschlands, bequem von Hamburg via
Nachtzug nach Köln, über Remagen und den Ahrtalexpress erreichbar. Morgens um
9:00 Uhr starte ich in den ersten Wandertag, der leider zum Großteil verregnet
ist, aber dennoch herrliche Eindrücke vermittelt: wunderbare Tiefblicke ins
tief eingeschnittene Ahrtal samt seinen Winzerorten und steilen Rebhängen,
südwestlich am Horizont zu erkennen die „Hohe Acht“, davor bewaldete
Hügelketten, die ihre Farbe vom nahen grün ins ferne blau wechseln.
Tiefhängende Wolken und Nebelfetzen ziehen aus den Tälern auf. Die Markierung
von Anfang an zwar äußerst vielfältig (manche Bäume gleichen
Kommunikationszentren), aber stets gut und zuverlässig. Eines sei
vorweggenommen: rund 60 % des gesamten Weges verlief auf Hartbelägen aller Art.
Mit Interesse habe ich deshalb gelesen, dass auch der Eifel – Verein im Rahmen
des Projektes „Wanderbares Deutschland“ sein Wegenetz überprüft. Nur
posititv, wenn tatsächlich hier und da Streckenverlegungen stattfinden (Meulenwald
!) und Wegewarte wie Vereinsfunktionäre der Einmischung von außen offen
begegnen. Es kann eigentlich nur n o c h besser werden, als es schon ist, denn:
tatsächlich keine andere Mittelgebirgstour hat mich bisher so begeistert.
Alle
kleine Schumachers
Woran´s
lag? In erster Linie natürlich an der Vielfalt der durchwanderten
Landschaftsformen. Und davon bietet der Karl – Kaufmann – Weg jede Menge.
Bereits im offiziellen Eifelführer von 1911 behaupten die Verfasser, der
sogenannte Eifelhöhenweg sei „die schönste [Wanderung] in der Eifel.“ Nach
dem Ahrtal Richtung Süden in die Hocheifel, die mich mit gefrierpunktnahen
Zeltnächten überrascht. Herrliche Fernblicke ringsum und bis hinüber ins
Siebengebirge vom Kaiser-Wilhelm-Turm auf der Hohen Acht (747 m), zehn Kilometer
später kompletter Szenenwechsel: der Nürburgring, oder kurz, wie der Eifeler
sagt, „der Ring“. Wirtschaftsfaktor Nr.1 in der fast ausschließlich
agrarisch geprägten Region, es dreht sich einfach alles um ihn. Als ich dort
vorbeikomme auch auf ihm, denn es ist Familientag. VaterMutterKind im Astra
Kombi schleichen über den legendenumwobenen Asphalt, während jede Menge Hobby
– Röhrls das Letzte aus ihren Motoren herausholen. Haarsträubende
Überholmanöver und schlimme Unfälle sind die Folge. Kein Zufall ist auch die
traurige Spitzenposition des Landkreises Ahrweiler, der alljährlich und im
Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Verkehrsunfalltoten ganz Deutschlands
zu beklagen hat. Alle kleine Schumachers !
Maare
und Burgen
 Der
Karl – Kaufmann –Weg zieht über die Höhe weiter, führt an Cotenickelchen,
Bränkekopf und Rote Heck vorbei ( alle um die 600 m ), berührt die Orte
Kelberg und Darscheid um schließlich auf den Dauner „Hausberg“, den
Firmerich (489 m) zu leiten, von dessen Schutzhütte aus ich einen Panorama –
Blick auf die Stadt genießen kann. Wesentlich mehr als der Ort, interessieren
mich die nur einige Fußkilometer entfernt Der
Karl – Kaufmann –Weg zieht über die Höhe weiter, führt an Cotenickelchen,
Bränkekopf und Rote Heck vorbei ( alle um die 600 m ), berührt die Orte
Kelberg und Darscheid um schließlich auf den Dauner „Hausberg“, den
Firmerich (489 m) zu leiten, von dessen Schutzhütte aus ich einen Panorama –
Blick auf die Stadt genießen kann. Wesentlich mehr als der Ort, interessieren
mich die nur einige Fußkilometer entfernt liegenden Maare. Mit dem Gemündener
Maar, dem Totenmaar und dem Schalkenmehrener Maar hat der Wanderer die größte
Dichte solcher „Seen“, die von der Allgemeinheit als Kraterseen längst
erloschener Vulkane verstanden werden. Nehmen wir das so hin und überlassen den
Experten die wissenschaftlichen Erläuterungen; es bleiben dennoch
unübersehbare Besonderheiten: man wandert aufwärts zu den Seen ! Normalerweise
liegen Mittelgebirgsseen tief unten in Senken und Tälern. Außerdem sind die
mit Wasser gefüllten Maare ( von rund 80 Maaren in der Eifel sind das nur 8 )
in der Regel recht tief: mit rund 70 m liegt das Pulvermaar ganz vorne.
Schließlich sei nebenbei noch erwähnt, dass das Wandern an und um die Maare
ein Hochgenuß ist, vor allem, wenn viele Kilometer Hochwald hinter einem
liegen. Ganz besonders das Hinüberlaufen zum Schalkenmehrener Maar – Ort
direkt am Wasser gelegen – lässt einen nicht nur einmal den Auslöser der
Kamera betätigen. Unweit dieser Idylle schlage ich am Waldrand mein Zelt auf,
koche, lese, bin ungewaschen und fern der Heimat. liegenden Maare. Mit dem Gemündener
Maar, dem Totenmaar und dem Schalkenmehrener Maar hat der Wanderer die größte
Dichte solcher „Seen“, die von der Allgemeinheit als Kraterseen längst
erloschener Vulkane verstanden werden. Nehmen wir das so hin und überlassen den
Experten die wissenschaftlichen Erläuterungen; es bleiben dennoch
unübersehbare Besonderheiten: man wandert aufwärts zu den Seen ! Normalerweise
liegen Mittelgebirgsseen tief unten in Senken und Tälern. Außerdem sind die
mit Wasser gefüllten Maare ( von rund 80 Maaren in der Eifel sind das nur 8 )
in der Regel recht tief: mit rund 70 m liegt das Pulvermaar ganz vorne.
Schließlich sei nebenbei noch erwähnt, dass das Wandern an und um die Maare
ein Hochgenuß ist, vor allem, wenn viele Kilometer Hochwald hinter einem
liegen. Ganz besonders das Hinüberlaufen zum Schalkenmehrener Maar – Ort
direkt am Wasser gelegen – lässt einen nicht nur einmal den Auslöser der
Kamera betätigen. Unweit dieser Idylle schlage ich am Waldrand mein Zelt auf,
koche, lese, bin ungewaschen und fern der Heimat.
Schon
der nächste Tag bringt neue Landschaftsform: das Liesertal bei Manderscheid.
Vorher aber bei bestem Wanderwetter über Brockscheid (bekannte Glockengießerei
) und Eckfeld, vorbei am ehemaligen Kloster Buchholz (wo der Abfallcontainer des
Friedhofes brennt und ich die Feuerwehr per Handy alarmiere) zum „Belvedere“
über Manderscheid. Oberburg und Niederburg ( letztere im Besitz des
Eifelvereins), zwei mächtige Ruinenanlagen aus dem 10. und 12. Jahrhundert in
unmittelbarer Nachbarschaft, prägen die Umgebung Manderscheids ebenso, wie
Liesertal und das Tal der Kleinen Kyll. Plötzlich läuft man auf
Serpentinenpfaden, über Holzbrücken die Bachseite wechselnd oder an herrlichen
Aussichtspunkten vorbei. Wegführung und Charakteristik des „2ers“ gefielen
mir ab hier bis nach Dreis im Salm – Tal besonders gut. Nicht zuletzt wegen
des hervorragenden Klosterbiers, das vermutlich schon lange nicht mehr von der
Zisterzienser – Bruderschaft des Klosters Himmerod gebraut wird, aber immer
noch so schmeckt. Das Kloster selbst liegt einsiedlig im Salmtal. Im Zuge der
Napoleonischen Krieg zerstört, dienten die Trümmer der Klosterruine dem
örtlichen Haus- und Straßenbau. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts konnte der „Neubau“
(die charakteristische Fassade, anstelle von Türmen, wurde erhalten) geweiht
und seiner ursprünglichen Bestimmung übergeben werden. Revitalisierung eines
Ortes des Glaubens. des Klosters Himmerod gebraut wird, aber immer
noch so schmeckt. Das Kloster selbst liegt einsiedlig im Salmtal. Im Zuge der
Napoleonischen Krieg zerstört, dienten die Trümmer der Klosterruine dem
örtlichen Haus- und Straßenbau. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts konnte der „Neubau“
(die charakteristische Fassade, anstelle von Türmen, wurde erhalten) geweiht
und seiner ursprünglichen Bestimmung übergeben werden. Revitalisierung eines
Ortes des Glaubens.
Trierer
Wallfahrt
Ein
Wiesenrand unweit der Gemeinde Niederkail ist für heute mein „Campingplatz“.
Der Pächter schaut fragend aus seinem Suzuki Jeep heraus, lässt mich aber in
Ruhe, als ich ihm glaubhaft versichere: kein offenes Feuer, kein Müll, alleine
und morgen in aller Frühe wieder weg. Weit weniger zu beeinflussen ist der
Lärm der F 16 und anderer amerikanischer Kampfjets, die von der unmittelbar
benachbarten Airbase Spangdahlem aus zu Übungsflügen aufsteigen. Es gibt
jedoch die Vereinbarung, nachts nicht zu fliegen. Nicht wenige der hiesigen
Eifeler haben Beschäftigung rund um den Standort gefunden. So wird die jüngst
von der Bush - Regierung getroffene Entscheidung, die Truppenstärke in
Spangdahlem ( = Doppelort: Spang und Dahlem) zugunsten Rammsteins zu reduzieren,
wenig begeistert aufgenommen. Freude über den Abzug bleibt den Hippies
vorbehalten, erklärt mir ein Jogger, dessen Arbeitsplatz ebenfalls gefährdet
ist.
Der
Weiterweg durchs Salmtal könnte idyllischer nicht sein. In den Orten Bruck und
Dreis ist den sommerlichen Temperaturen entsprechende Stille eingekehrt.
Während keiner anderen Mittelgebirgstour in Deutschland bin ich übrigens so
leicht mit den Menschen ins Gespräch gekommen, wie in der Eifel. Annähernd
allen mit denen ich sprach, war der Karl – Kaufmann – Weg bekannt, nicht
wenige waren große Teile davon selbst schon gelaufen. Hier wird die gute
Einrichtung des Eifelvereins als Heimatsinn stiftende Institution sichtbar. Gilt
doch sonst beim Streckenwandern in der Regel der Satz: Frag nie einen
Einheimischen! Bekannt war der Weg auch wegen der jährlich stattfindenden
Pilgerfahrt von Blankenheim (Ahrtal – Quelle) nach Trier zur Grablege des
Apostels Matthias, des einzigen Apostelgrabs
nördlich der Alpen. Die Wallfahrer gehen innerhalb drei Tagen die rund 100 km
lange Strecke zum Teil auf dem „2er“: ohne Buße keine Vergebung. Matthias, des einzigen Apostelgrabs
nördlich der Alpen. Die Wallfahrer gehen innerhalb drei Tagen die rund 100 km
lange Strecke zum Teil auf dem „2er“: ohne Buße keine Vergebung.
 Vergebung
ist immer von Nöten, beschließe aber dennoch meine herkömmliche
Etappeneinteilung beizubehalten und steuere als letztes Übernachtungsziel den
Ort Quint im Moseltal an. Zwischen der Salm und der Mosel liegt der Meulenwald,
den mein Weg ausschließlich auf Forststraßen durchzieht. Hier hätte eine
Korrektur, eine Streckenverlegung vier Meter rechts oder links in Wald hinein,
meine Füße ( und Augen) geschont. So beißt man sich halt durch den leider
unattraktiven Abschnitt. Vergebung
ist immer von Nöten, beschließe aber dennoch meine herkömmliche
Etappeneinteilung beizubehalten und steuere als letztes Übernachtungsziel den
Ort Quint im Moseltal an. Zwischen der Salm und der Mosel liegt der Meulenwald,
den mein Weg ausschließlich auf Forststraßen durchzieht. Hier hätte eine
Korrektur, eine Streckenverlegung vier Meter rechts oder links in Wald hinein,
meine Füße ( und Augen) geschont. So beißt man sich halt durch den leider
unattraktiven Abschnitt.
Das
erste Haus in Quint ist das des Försters, der meine Frage nach möglichem
Zeltplatz auf seiner Wiese sehr bestimmt ablehnt, sieht er in mir doch eher
einen Bruder der Landstraße. Erst nach gutem Zureden, überlässt er mir 5 qm.
Der
nächste Tag verspricht mit dem Moseltal erneut veränderte Blicke und
Landschaft. Zusammen mit dem linksführenden Moselhöhenweg läuft der Karl –
Kaufmann – Weg das auf und ab der Moselhöhen aus. Ehrang und Biewer bleiben
die einzigen Orte, bevor mich der Felsenpfad zum hochgelegenen Weißen Haus
(Gasthaus) und hinunter zur Moselbrücke führt. Bei der End- wie Anfangspunkt
anzeigenden Orientierungstafel am Beginn der Brücke, ohne die einer
Streckentour etwas wichtiges fehlte, bleibe ich länger stehen und lese:
Endpunkt auch des Josef-Schramm-Weges (Nr. 4) und des bekannten „6ers“ von
Aachen nach Trier.
Ein
Landstrich, in dem Wanderer vom Weg weg von Mitmenschen zum Frühstück nach
Hause eingeladen werden („Komm Jong, mach Dir en Käs-Schmier!“) will
wiederbesucht sein. Der „6er“ steht auf dem Programm 2005.
Erschienen
in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 15 - Dezember
2004
Wanderbedingungen
in Nordthüringen
Von
Dr. Lutz Heidemann
Bei
dem Stichwort „Wandern in Thüringen“ denken viele zuerst an den etwa 170 km
langen Rennsteig, den Höhenweg auf dem Thüringer Wald. Doch für Weitwanderer,
die etwas mehr Einsamkeit und vielseitigere Landschaft schätzen, gibt es als
reizvollere Alternative z. B. einen ebenfalls im Raum Eisenach beginnenden Weg,
der zuerst durch den Hainich führt, dann am Nordrand des Thüringer Beckens
entlanggeht und bei Heldrungen die Unstrut überquert. Dieser Nordrand wird
durch eine Kette immer schmaler werdender Bergrücken markiert. Zuletzt
wanderten man über die nur wenige hundert Meter breite Schmücke und den
Kalkrücken zwischen Eckartsberga und Bad Sulza und gelangten nach zehn Tagen zu
Ilm und Saale.
Meine
Frau und ich sind diese Strecke im Frühjahr 2000 gewandert. Das Ausgangsgebiet
für unsere kurzfristig vorbereitete Oster-Tour war der Hainich, ein
außergewöhnlich großer Buchenwald und aus diesem Grund seit Dezember 1997 zum
13. deutschen Nationalpark erklärt. Auch an den folgenden Tagen bestimmten
ausgedehnte Buchenbestände das Landschaftsbild, in der Finne trafen wir auch
Eichen an. Zu dieser Zeit waren die Bäume noch ohne Laub, aber der Waldboden
war voll von blühenden Busch-windröschen und Himmelschlüsselchen. Der
Bärlauch roch kräftig und Fachleute hätten Orchideen erkannt. Einmal fragten
wir zwei alte, uns entgegenkommende Männer nach einer gelbblühenden Pflanze
und hörten als Antwort, das seien „Antonisröschen“, im Hinterkopf hatte
ich den Namen Adonisröschen. Streckenweise wurden wir an blühenden Hecken
entlanggeführt; der Weg war dann von herabgefallenen Blüten wie weiß
gepudert. Viele Wege waren auch von Obstbäumen gesäumt; wir freuten uns über
Nachpflanzungen. Dezember 1997 zum
13. deutschen Nationalpark erklärt. Auch an den folgenden Tagen bestimmten
ausgedehnte Buchenbestände das Landschaftsbild, in der Finne trafen wir auch
Eichen an. Zu dieser Zeit waren die Bäume noch ohne Laub, aber der Waldboden
war voll von blühenden Busch-windröschen und Himmelschlüsselchen. Der
Bärlauch roch kräftig und Fachleute hätten Orchideen erkannt. Einmal fragten
wir zwei alte, uns entgegenkommende Männer nach einer gelbblühenden Pflanze
und hörten als Antwort, das seien „Antonisröschen“, im Hinterkopf hatte
ich den Namen Adonisröschen. Streckenweise wurden wir an blühenden Hecken
entlanggeführt; der Weg war dann von herabgefallenen Blüten wie weiß
gepudert. Viele Wege waren auch von Obstbäumen gesäumt; wir freuten uns über
Nachpflanzungen.
Die
Strecke war gut trassiert, d.h. abwechslungsreich geführt. Überwiegend war es
ein Kammweg. Es machte Spaß, entlag der Waldränder zu gehen. Reizvoll waren
die Ausblicke in das weite, leicht gewellte thüringische Becken. Auch die
Markierung war gut. Eher beobachteten wir ein Übermaß an Markierungen und
Schildchen, denn oft existierten Parallelführungen mit anderen Wanderwegen. Es
gab ausreichend Zu- und Abwege von der Hauptstrecke. Probleme mit der Markierung
gab es höchstens in geschlossenen Ortschaften.
Wir
durchquerten die ehemalige Freie Reichsstadt Mühlhausen, die Residenzstadt
Sondershausen, kleine Städte und Marktflecken, stattliche Dörfer und kamen an
mittelalterlichen Burgen und Klöstern vorbei. In Frankenhausen sahen wir uns in
dem „Panorama-Museum“ über der Stadt das 123 m mal 14 m messende Rundbild
an, das von dem Maler Werner Tübke mit wenigen Gehilfen bis 1987 fertiggestellt
wurde und auf dem er, ausgehend von der an dieser Stelle stattgefundenen
Metzelei im Bauernkrieg von 1525, ein vielfiguriges
„Welttheater“
des 16. Jahrhunderts gestaltet hat.
Thüringen
ist ein reizvolles Wanderland. Die von der DDR-Wirtschaft verursachten
Landschaftsschäden sind weniger stark als in den anderen Ländern. In den
Waldgebieten gab es große militärische Sperrgebiete, wo zwar Soldaten übten
und viel Munition verschossen, die heute noch im Boden stecken kann, wo sich
aber auch Pflanzen und Tiere gut entwickeln konnten. Der Naturpark Hainich ist
aus einem solchen Militärsperrbezirk entstanden. Erst an den Rändern von
Thüringen gibt es Überreste von Tagebauen und Halden vom Kali- oder
Uranbergbau. Bei den Orten waren wir immer wieder erstaunt und erfreut, wieviel
an alter Bausubstanz in den vergangenen Jahren gesichert und wiederhergerichtet
worden war. Viele Dörfer haben noch ihre alte Form bewahrt. Thüringen ist ein
Land der Klein- und Mittelstädte. Die Kleinstaaterei in Thüringen führte zu
vielen kleinen Residenzen. Nicht nur Weimar hatte einen „Musenhof“, z. B.
auch in Meiningen, Sondershausen oder Gera haben die Fürsten als Mäzene
gewirkt und oft die zu ihrer Zeit modernen Künstler unterstützt. Gespräche,
insbesondere in den Privatquartieren, gaben uns die Chance, etwas von der
Befindlichkeit der Menschen in Thüringen zu erfahren. weniger stark als in den anderen Ländern. In den
Waldgebieten gab es große militärische Sperrgebiete, wo zwar Soldaten übten
und viel Munition verschossen, die heute noch im Boden stecken kann, wo sich
aber auch Pflanzen und Tiere gut entwickeln konnten. Der Naturpark Hainich ist
aus einem solchen Militärsperrbezirk entstanden. Erst an den Rändern von
Thüringen gibt es Überreste von Tagebauen und Halden vom Kali- oder
Uranbergbau. Bei den Orten waren wir immer wieder erstaunt und erfreut, wieviel
an alter Bausubstanz in den vergangenen Jahren gesichert und wiederhergerichtet
worden war. Viele Dörfer haben noch ihre alte Form bewahrt. Thüringen ist ein
Land der Klein- und Mittelstädte. Die Kleinstaaterei in Thüringen führte zu
vielen kleinen Residenzen. Nicht nur Weimar hatte einen „Musenhof“, z. B.
auch in Meiningen, Sondershausen oder Gera haben die Fürsten als Mäzene
gewirkt und oft die zu ihrer Zeit modernen Künstler unterstützt. Gespräche,
insbesondere in den Privatquartieren, gaben uns die Chance, etwas von der
Befindlichkeit der Menschen in Thüringen zu erfahren.
Neben
dem eingangs erwähnten Rennsteig und der von uns begangenen Wegefolge in
Nordthüringen gibt es noch mehrere andere Hauptwanderwege. Sehr reizvoll stelle
ich mir den Weg auf den Saale- Höhen vor. Die Orte am Fluß haben alle einen
von der Geschichte geprägten Charakter: z. B. Saalfeld, Rudolstadt, Kahla,
Jena, Dornburg und Bad Kösen. Bei Naumburg mündet die Unstrut in die Saale und
auch dieser Fluß wird von einem Weitwanderweg begleitet. Am Nordrand von
Thüringen , z.T. wohl schon auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt verläuft der
Karstwanderweg mit einer, wie der Name andeutet, charakteristischen
Landschaftsstruktur und Pflanzenwelt.
In
dem Internet-Angebot von „ www.wanderbares.deutschland.de“ wird neben
dem altbekannten Rennsteig auch ein „Thüringenweg“ vorgestellt, der in 23
Etappen von Altenburg im Osten nach Creuzburg an der Werra reicht. Von der
Residenzstadt Altenburg werden die Wanderer nach Gera in die nächste
Residenzstadt geführt, gehen weiter über Thalbürgel mit seiner schönen
romanischen Klosterkirche nach Jena und Bad Berka. Auf dem Weg zum Thüringer
Wald wird Paulinzella mit der schönsten Kirchenruine Deutschlands gestreift,
dann geht der Weg am Fuß des Thüringer Waldes über Eisenach bis nahe an die
hessische Grenze bei Creuzburg an der Werra. Viel Vergnügen bei dieser
Wanderung! - Ein weiteres Wegeangebot aus dem „wanderbarem Deutschland“ ist
der Saale- Orla- Weg, ein Rundkurs in 23 Etappen. Dieser Weg könnte zur
Vernetzung mit anderen Langstreckenwegen benutzt werden. Als „Fortschritt“
sei registriert, daß die jüngste Fassung für jeden Weg eine Übersicht über
den Asphaltanteil an den Gesamtstrecken enthält. Um eine großräumige
Routenplanung betreiben zu können, wäre es wünschenswert, wenn es eine
Übersichtskarte z. B. im Maßstab 1: 500.000 über die Thüringer
Fernwanderwege gäbe. weiter über Thalbürgel mit seiner schönen
romanischen Klosterkirche nach Jena und Bad Berka. Auf dem Weg zum Thüringer
Wald wird Paulinzella mit der schönsten Kirchenruine Deutschlands gestreift,
dann geht der Weg am Fuß des Thüringer Waldes über Eisenach bis nahe an die
hessische Grenze bei Creuzburg an der Werra. Viel Vergnügen bei dieser
Wanderung! - Ein weiteres Wegeangebot aus dem „wanderbarem Deutschland“ ist
der Saale- Orla- Weg, ein Rundkurs in 23 Etappen. Dieser Weg könnte zur
Vernetzung mit anderen Langstreckenwegen benutzt werden. Als „Fortschritt“
sei registriert, daß die jüngste Fassung für jeden Weg eine Übersicht über
den Asphaltanteil an den Gesamtstrecken enthält. Um eine großräumige
Routenplanung betreiben zu können, wäre es wünschenswert, wenn es eine
Übersichtskarte z. B. im Maßstab 1: 500.000 über die Thüringer
Fernwanderwege gäbe.
Für
die Wege und ihre Markierungen engagieren sich in Thüringen die Mitglieder
vieler örtlicher Vereine. Nach der Wende wurden die alten Wander- und
Gebirgsvereine wiedergegründet. Da gab es räumliche Überschneidungen. Der
Rennsteigverein deckt nur den Kern des Thüringer Waldes ab. Hinzu kamen der
1880 gegründete Thüringerwaldverein und der Thüringer Gebirgs- und
Wanderverein. Nun haben die deutschen Vereine die Tradition, sich an „ihren“
Gebirgen und nicht an politisch-administrativen Grenzen zu orientieren. Das
erschwert z. B. die Kooperation mit staatlichen Organen oder
Fremdenverkehrsverbänden. Deshalb haben sich die Thüringer Vereine seit
einiger Zeit mit den angrenzenden Gebirgsvereinen unter dem Dach eines „Landesverbandes
Thüringen“ zusammengeschlossen. Die Struktur dieses Verbandes läßt sich auf
ihrer Homepage unter www.wanderverband-thueringen.de nachvollziehen. Es scheint
aber auch unterschiedliche Trägerschaften für die Wege zu geben, was sich auf
die Markierung und „Bewerbung“ auswirken wird. Der Saale- Orla- Weg
untersteht z. B. dem Landratsamt des Saale- Orla- Kreises, der Rennsteig dem
oben genannten Landesverband Thüringen. So tritt im Internet als Partner für
den Saale- Orla- Kreis der „Fremdenverkehrsverband Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale“ auf. Bei den dort unter „Gastgeber“ auftretenden Hotels
fehlen die Ortsangaben... Es wäre sinnvoll, wenn die Internet-Seiten von „Neutralen“
gegengelesen würden. „Fremdenverkehrsverband Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale“ auf. Bei den dort unter „Gastgeber“ auftretenden Hotels
fehlen die Ortsangaben... Es wäre sinnvoll, wenn die Internet-Seiten von „Neutralen“
gegengelesen würden.
Die
Wegevielfalt in Thüringen ist groß. Wir bemerkten das bei unserer Wanderung.
Der Nationalpark Hainich hat ein eigenes Wegesystem mit „niedlichen“
Symbolschildchen. Der über den Kamm verlaufende Weg heißt Rennstieg, eine
Verwechslungsgefahr mit dem Rennsteig ist vorprogrammiert. Anschließend
benutzten wir bis Bad Frankenhausen den schon 1930 eingerichteten Barbarossaweg.
Träger dieses von Korbach bis zum Kyffhäuser reichenden Weges ist der
Hessisch-Waldeckische Gebirgs- und Heimatverein. Dann folgten wir dem
Dün-Hainleite-Weg. Zur Orientierung benutzten wir anfangs die über den Hainich
bei ARTIFEX Langensalza herausgekommene Freizeitkarte Nr. 2; (dieser Verlag
macht auch Karten über das mittlere Thüringen). Später griffen wir auf die
ausgezeichneten Karten M. 1: 50.000 des Landesvermessungsamtes zurück, die wir
in Buchhandlungen, z. B. in Mülhausen, kauften. Da wir zum Schluß auf der
Grenze zu Sachsen-Anhalt wanderten, reichten diese Karten nicht weiter; gute
Hilfe leistete das Faltblatt mit Wander-Karte 1: 75.000 „Untere IImaue“
(herausgegeben von der Stadtverwaltung Bad Sulza), das z. B. die
Wegeverbindungen bis nach Dornburg mit seinen interessanten Schlössern
enthielt. Damit hätte man auch entlang der Ilm bis Weimar oder über Bad Kösen
nach Naumburg gelangen können.
Als
wir im Jahr 2000 wanderten, bekamen wir sehr umfangreiches Material für die
Übernachtungen von dem Tourismus Service Center. Das gibt es so nicht mehr, es
hat eine Nachfolge in der „Thüringer Tourismus GmbH“, Weimarische Straße
43, 99099 Erfurt Tel: 0361/ 37420 gefunden. In der entsprechenden Homepage „ www.thueringen-tourismus.de“
hatte ich Schwierigkeiten, Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten auf
Ortsebene zu finden.
Für
diejenigen, die unsere Wanderung vom Jahr 2000 nachvollziehen wollen, sind
nachfolgend unsere Etappen und Unterkünfte aufgelistet. Der Ausgangspunkt
unserer Route und der Platz, wo wir das Auto stehengelassen hatten, war der
Ortsteil Hütscheroda in der Gemeinde Behringen in der weiteren Umgebung von
Eisenach, dort Übernachtung im Hotel Zum Herrenhaus Tel.: 036254/7200
1.
Tag bis Mihla 20 km,
dort Übernachtung im Hotel Graues Schloß (Tel.: 036924/42272)
2.
Tag bis Mühlhausen 22km,
dort gibt es viele Hotels
3.
Tag bis Holzthaleben 28 km,
Übernachtung in einem Privatzimmer
4.
Tag bis Sondershausen 31 km,
dort gibt es viele Hotels
5.
Tag bis Bad Frankenhausen 29km,
dort gibt es viele Hotels,
Übern.: Hotel Thüringer Hof Tel.: 034671/51010
6.
Tag bis Heldrungen 28 km,
Übernachtung in einem Privatzimmer
7.
Tag bis Rastenberg 28 km,
Übernachtung bei Privatzimmervermieter:
Greisler, Tel.: 036377/80391
8.
Tag bis Bad Sulza 27 km, dort gibt es viele Hotels
9.
Tag Wanderung bis zu den Dornburger Schlössern 12 km, Bahnfahrt
zu- rück nach Langensalza, dort Übernachtung, es gibt mehrere Hotels
10.Tag
Wanderung bis Hütscheroda 20 km
Erschienen
in "Mitteilungsblatt"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 13 - April 2004
Der
König - Ludwig - Weg
auch
Luggi-Weg oder Postweg (?!) genannt
Von
Günther Krämer
Seit
1977 ist dieser Weg als Weitwanderweg ausgeschildert und führt in mehreren
Varianten vom Gedenkkreuz im Starnberger See nach Füssen. Die Beschilderung ist
nicht immer gut. Bei der Routenwahl hilft manchmal Intuition, aber auf alle
Fälle immer die richtige Karte, und einmal war sogar der Kompass von Nutzen!
Ein solches Schilderchaos wie hier im Alpenvorland haben wir selten gesehen.
Wann kommt denn endlich auch in Deutschland die einheitliche
Wanderwegbeschilderung, die das Wandern in der Schweiz, in Tschechien und in der
Slowakei zum unschwierigen Vergnügen macht?
Einen
guten Führer gibt es im Moment nicht. Folgende Wanderkarten 1 : 50 000 des
Bayerischen Landesvermessungsamtes sind unerlässlich: UKL 1 Ammersee -
Starnberger See und Umgebung, UKL 3 Pfaffenwinkel - Staffelsee und Umgebung, UKL
10 Füssen und Umgebung.
Der
Luggi-Weg ist ein idealer Winter-Wanderweg: Wanderer werden nicht von Radlern
bedroht, Bäume ohne Laub lassen Durchblicke zu - z.B. auf die Villen am
Starnberger See -, die im Sommer nicht möglich sind, es gibt kaum
Quartierprobleme, die meisten Wege sind vom Schnee geräumt oder der Schnee ist
nach kurzer Zeit festgetreten. Die manchmal nicht vorhersehbaren
Schneeverhältnisse erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und dennoch eine
exakte Planung der Route mit relativ kurzen Tagesetappen. Die Gesamtlänge
beträgt ungefähr 115 km.
Ach
so, warum Postweg? Ganz einfach: Entlang des Weges laden täglich Gasthäuser
zur Post zum Schlemmen und Übernachten ein!
Hier
die Beschreibung des Luggi-Wegs, erwandert vom 29.12.2003 bis zum 3.1.2004.
Unser
Winter-Luggi-Weg (Postweg)
1.
Tag, 29.12.2003
Anfahrt
mit der Bahn über München, dann S-Bahn S6 nach Starnberg, von dort mit Bus 975
Richtung Wolfratshausen bis zur Haltestelle Berg, Grafstraße. Hier gleich eine
außergewöhnlich gute Mittagsrast im Geburtshaus des Dichters Oskar Maria Graf
(Oskar-Maria-Graf-Stüberl, 08151-51688, Ruhetag Di u. Mi). Grafstraße -
Wittelsbacherstraße, links auf dem Fußweg zur Votivkapelle und runter zum See,
wo das Gedenkkreuz im Wasser steht. Auf demselben Weg zurück, vorbei am Schloss
Berg und auf dem Uferweg entlang der Villen und der Fischerhäuser nach
Starnberg. Auf der Söckinger Straße stadtauswärts, links ab in die
romantische Maisinger Schlucht. Am Ortsanfang von Maising kurz rechts (Straße),
dann links auf dem Mühlleitenweg nach Pöcking zum stilvollen Gasthof zur Post
(www.posthotel-poecking.de) . Geburtshaus des Dichters Oskar Maria Graf
(Oskar-Maria-Graf-Stüberl, 08151-51688, Ruhetag Di u. Mi). Grafstraße -
Wittelsbacherstraße, links auf dem Fußweg zur Votivkapelle und runter zum See,
wo das Gedenkkreuz im Wasser steht. Auf demselben Weg zurück, vorbei am Schloss
Berg und auf dem Uferweg entlang der Villen und der Fischerhäuser nach
Starnberg. Auf der Söckinger Straße stadtauswärts, links ab in die
romantische Maisinger Schlucht. Am Ortsanfang von Maising kurz rechts (Straße),
dann links auf dem Mühlleitenweg nach Pöcking zum stilvollen Gasthof zur Post
(www.posthotel-poecking.de) .
2.
Tag, 30.12.2003
Auf
der Nebenstraße geht es zunächst Richtung Aschering , kurz vor dem Wald rechts
auf den Feldweg Richtung Maisinger See, unter der B2 durch, im Wald dann links,
durch das kleine Moor nach Aschering. Ab jetzt ist der Weg nach Andechs gut
ausgeschildert: Durch den Wald beim Eßsee, wo Konrad Lorenz seine Forschungen
betrieben hat, am Barockgefängnis Rothenfeld vorbei, beim Parkplatz über die
Staatsstraße, kurz durch den Wald und auf dem Kreuzweg an der Friedenskapelle
vorbei zum Kloster Andechs. Eigentlich wäre hier eine ausgiebige Einkehr
angesagt gewesen, aber Busse, Menschenmassen und deren "feiner Duft"
in den Klosterbräustuben haben uns vertrieben, der Klostergasthof war
überfüllt und ein anderes geöffnetes Gasthaus gab es nicht. Also weiter,
vorbei am Forschungsinstitut von Irenäus Eibl-Eibesfeldt, hier links ab
Richtung Weilheim und am Waldrand (Parkplatz) auf einem aussichtsreichen
Traumpfad - es gibt ausreichend Rastbänke - durch Wald und Weidelandschaft,
vorbei an der Hartkapelle, der Waldkapelle Moritz von Schwinds, nach Pähl, wo
am Ortsende (Straßenkreuzung) im Gasthaus zur Neuen Post (die Alte Post, heute
Silberner Floh, in der Ortsmitte ist nur abends geöffnet), wo Glühwein
angesagt ist. Nach den letzten Häusern links auf den Feldweg und gleich wieder
rechts straßenparallel bis zur Ammer, die wir auf der Straßenbrücke
überqueren. Auf den Wiesen neben der Straße kommen wir bequem nach Raisting,
wo schon der Ballon der Erdfunkstelle der Telekom grüßt. Der bezeichnete
Luggiweg macht einen großen südlichen Umweg. Im Winter kann man querfeldein
und über Wiesen gehen! In Raisting logieren wir fürstlich im Gasthof zur Post
(www.post-raisting.de)! querfeldein
und über Wiesen gehen! In Raisting logieren wir fürstlich im Gasthof zur Post
(www.post-raisting.de)!
3.
Tag, 31.12.2003
Es
schneit heute nur einmal, aber das ohne Unterlass! Am Gasthof links auf dem
Sträßchen nach Stillern und im Tal noch etwa 1,5 km weiter, bis der Luggiweg
rechts durch den Wald nach Wessobrunn hochführt. Die 1200-jährige Tassilolinde
steht links unten in der Talsenke, das Kloster ist im Winter leider nur
nachmittags um 15 Uhr zu besichtigen, aber das Barockkirchlein und der
romanische Glockenturm sind ja auch etwas. Und dann gibt es einen Gasthof zur
Post (08809-208), wo man sehr gut einkehren kann. Vorbei an alten Bauernhöfen,
deren Geschichte auf Tafeln erklärt wird - so findet man auch das Geburtshaus
der Brüder Johann Baptist (Maler) und Dominikus (Baumeister) Zimmermann, der
bedeutendsten Rokokokünstler, - gehen wir steil ins Schlittbachtal hinunter
und genauso steil wieder hoch, bis wir über Pürschlehen, Guggenberg und St.
Leonhard den Weiler Linden mit seiner uralten Linde und dem darin eingelassenen
Marienbild erreichen. Über den Schwabhof geht es in den großen Wald, lange
geradeaus, dann links nach Hohenpeißenberg (den Berg sparen wir uns, da wir
sowieso nichts sehen können). Ewig lang latschen wir die Hauptstraße entlang,
an der Sparkasse dann rechts die Bahnhofstraße hinunter zum
"Bahnhof", von wo stündlich um .38 Uhr ein Zug nach Schongau fährt.
Da die "Alte Post" geschlossen hat, nächtigen wir in der "Blauen
Traube" (www.hotel-blaue-traube.de) und feiern Silvester in "Schauga",
wie Schongau im Dialekt heißt.
4.
Tag, 1.1.2004
Mit
dem Zug (stündlich um .02) fahren wir nach Peiting Ost, am Bahnhof rechts bis
zur Kreuzung, hier links, dann in die Zugspitzstraße, immer dem k nach, vorbei
an der großen Spanplattenfabrik, unter der B472 durch bis zum Parkplatz am
Waldrand oberhalb der Ammerschlucht. Hier rechts in den Wald. Wir sind die
ersten nach dem Neuschnee, und entsprechend anstrengend ist das Spuren im
Neuschnee. Aber der schöne Weg entschädigt für alle Mühen: Hangquellen,
Kalktuffbildungen in allen Formen und Stadien, Baumgestalten, Ausblicke ins tief
eingeschnittene Tal, Brücklein, Treppen, Felsen ... Ohne Stöcke wäre dieser
Weg gefährlich! Dann sind wir unten an der Ammer, die dieses Naturwunder
geschaffen hat. Bald führt der Weg steil rechts hoch, vorbei am Hof
Schweinberg, kurz darauf links an den Waldrand und hier immer an der Hangkante
unter dem weit ausladenden Dach der Bäume , kurz abwärts, zwischen zwei
Fischteichen hindurch, kurz hoch, durch ein halb verfallenes Tor - und wir
stehen im Hof des Klosters Rottenbuch. Die Rokokokirche ist eine Überraschung,
vor allem was die Größe der Kirche und den Reichtum der Ausstattung anbelangt.
Gleich daneben Einkehr im Gasthaus zum Koch (08867-921195). Danach queren wir
die B23 und gehen gleich schräg links durch den Ort, über Solder und Kreitfilz
zur Straße, der wir nach Wildsteig folgen. Nach der obligatorischen
Barockkirche stürmen wir auf den Rat der Haushälterin des Pfarrers den Gasthof
zur Post (franz.bertl@t-online.de, 08867-221) mit ausgezeichneter
bayerischer Spezialitätenküche und schönen Zimmern. Der Abend bietet uns
Einblicke in das oberbayerische Wirtshausleben, verschönt durch den harten Kern
der Musikkapelle Wildsteig. Neuschnee, und entsprechend anstrengend ist das Spuren im
Neuschnee. Aber der schöne Weg entschädigt für alle Mühen: Hangquellen,
Kalktuffbildungen in allen Formen und Stadien, Baumgestalten, Ausblicke ins tief
eingeschnittene Tal, Brücklein, Treppen, Felsen ... Ohne Stöcke wäre dieser
Weg gefährlich! Dann sind wir unten an der Ammer, die dieses Naturwunder
geschaffen hat. Bald führt der Weg steil rechts hoch, vorbei am Hof
Schweinberg, kurz darauf links an den Waldrand und hier immer an der Hangkante
unter dem weit ausladenden Dach der Bäume , kurz abwärts, zwischen zwei
Fischteichen hindurch, kurz hoch, durch ein halb verfallenes Tor - und wir
stehen im Hof des Klosters Rottenbuch. Die Rokokokirche ist eine Überraschung,
vor allem was die Größe der Kirche und den Reichtum der Ausstattung anbelangt.
Gleich daneben Einkehr im Gasthaus zum Koch (08867-921195). Danach queren wir
die B23 und gehen gleich schräg links durch den Ort, über Solder und Kreitfilz
zur Straße, der wir nach Wildsteig folgen. Nach der obligatorischen
Barockkirche stürmen wir auf den Rat der Haushälterin des Pfarrers den Gasthof
zur Post (franz.bertl@t-online.de, 08867-221) mit ausgezeichneter
bayerischer Spezialitätenküche und schönen Zimmern. Der Abend bietet uns
Einblicke in das oberbayerische Wirtshausleben, verschönt durch den harten Kern
der Musikkapelle Wildsteig.
5.
Tag, 2.1.2004
Wir
folgen dem Wiesweg über Schwarzenbach zur Wieskirche, treffen dort den
Wildsteiger Pfarrer und seine Haushälterin, ertragen den Touristenrummel,
setzen unseren wunderschönen Weg durch die tief verschneite Winterlandschaft
fort über die Höfe Resle und Schober, biegen vor Oberreithen links ab, nach
der Überquerung der Trauchgauer Ach wieder rechts, am Keltenberg Hainzenbichl
vorbei - und schon weist uns ein Schild nach links (600 m) hoch zur Trauchgauer
Almstube (08368-348, Mo Ruhetag), die uns von der Musikkapelle Wildsteig
wärmstens zur Einkehr empfohlen wurde, zu Recht, wie wir feststellen: Die
Portionen sind doppelt so groß wie normal, und das bei guter Qualität. Wieder
runter zum Luggiweg, nach Trauchgau hinein, vor der Kirche links ab auf den
Feldweg, der an der Talstation des Skilifts Halblech vorbeiführt, weiter zum
Bruckschmid und nach Buching, wo wir noch Zeit haben, Bekannte zu besuchen.
Quartier finden wir im Hotel Bannwaldsee (www.bannwaldseehotel.de) .
Buching, wo wir noch Zeit haben, Bekannte zu besuchen.
Quartier finden wir im Hotel Bannwaldsee (www.bannwaldseehotel.de) .
6.
Tag, 3.1.2004
Geräumte
Feldwege führen uns parallel zur B17, teils weiter entfernt, teils zwischen
Bannwaldsee und Straße zum Campingplatz Bannwaldsee. Nach dem Campingplatz
gehen wir rechts am Zaun entlang bis zum Bach, hier wieder links am Bach
entlang, bis wir bei Mühlberg die B17 und die Mühlberger Ach überqueren. Am
Lußbach entlang gehen wir nach Hohenschwangau. Der Aufstieg durch die
Pöllatschlucht ist leider gesperrt, so gehen wir vom Parkplatz vor dem
Sportplatz aus hinauf nach Neuschwanstein, ergötzen uns an der Vielfalt der
Menschen und ihrer Bekleidung - der Gipfel war eine Japanerin in Stöckelschuhen
im Schnee! Einkehr im Schlossrestaurant Neuschwanstein (08362-81110).
Anschließend auf dem Fahrweg runter und rüber zum Schloss Hohenschwangau. Auf
dem Sattel auf halbem Weg zum Schloss Hohenschwangau links ab und auf dem sehr
schönen Alpenrosenweg hoch über dem Schwansee zum Lechfall oder direkt nach
Füssen. Mit der Bahn erfolgt die Rückfahrt nach/über Augsburg oder München.
Für Westdeutsche und Baden-Württemberger ist die Rückfahrt mit dem Bus zum
Bahnhof Pfronten-Ried und weiter über Kempten und Ulm kostengünstiger und
schneller.
Erschienen
in "Mitteilungsblatt"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 13 - April
2004
Themenwanderweg
Kultur
Gewandert
von Willi und Helga Großkopf, Stuttgart,
vom
17. bis 20. September 2002
Dieser
Wanderweg wurde im unteren Bayerischen Wald vor etwa 2 Jahren von den
Haidelgemeinden Hunterschmiedung, Grainet, Philippsreut, Haidmühle und
Neureichenau neu eingerichtet und verläuft in der Ungebung der Bayerwaldberge
„Dreisessel“ und „Haidel“. Seine Gesamtlänge beträgt 130 km, dabei
sind jedoch mehrere Rundwanderwege eingerechnet, die man aber nicht alle
unbedingt gehen muß, sondern man kann auch eine große Ringtour mit weniger
Kilometern wandern.
Mit
„Kultur“ sind in diesem ländlichen Gebiet – das zwar mit viel Wald, aber
nie mit Reichtümern gesegnet war – Bildstöcke (Marterln), Kapellen und
Dorfkirchen gemeint, die man am Wege findet. Abgesehen davon kann man als
Wanderer vor allem die schöne Landschaft des Bayerischen Waldes eingehend
kennen lernen.
Dieser
Weg ist von Dr. med. Peter Dillinger, Freyung, in einem Taschenbuch beschrieben
und schön bebildert worden; darin sind auch Landschaftsbeschreibungen und
Geschichtsdaten angegeben, sowie Wegeskizzen gezeichnet, die aber nicht sehr
detailliert sind. Der Herausgeber dieses Büchleins ist die ARGE Haidelgemeinden,
Rathaus – Obere Hauptstr. 21, 94143 Grainet, Tel.: 08585/9600-30. Der
Ansprechpartner ist dort Herr Fuchs. Eine spezielle Wanderkarte mit
eingezeichnetem Wegverlauf gab es leider noch nicht und so haben wir uns auf die
Markierung (weiß-violettes Quadrat mit Kirchturm) und auf eine erhältliche,
regionale Fritsch-Wanderkarte verlassen. Soviel zu den Vorbereitungen. haben wir uns auf die
Markierung (weiß-violettes Quadrat mit Kirchturm) und auf eine erhältliche,
regionale Fritsch-Wanderkarte verlassen. Soviel zu den Vorbereitungen.
Unsere
Wanderung begann in Haidmühle und wir wollten im Uhrzeigersinn die o.g.
Haidelgemeinden erreichen. Schon in Neureichenau mussten wir aber feststellen,
dass die Markierung dort aufhörte; dies wurde uns auch vom dortigen
Fremdenverkehrsbüro bestätigt. Zuständig für die Markierung sind die
beteiligten Gemeinden, jedoch nicht alle haben sie schon vorgenommen.
Wir
änderten deshalb unsere Tour und gingen nicht –wie geplant- über Gsenget,
Klafferstraß usw., sondern marschierten in Richtung Grainet. Im weiteren
Wegverlauf mussten wir wiederholt feststellen, dass die Markierung lückenhaft
war oder z.T. ganz fehlte; relativ gut war sie in den Ortsbereichen Haidmühle,
Altreichenau, Gschwendet, Herzogsreut und Philippsreut. Wir haben uns also an
deren, örtlichen Markierungen unserer Regionalwanderkarte orientiert und uns
den Weg gesucht; dadurch bekam der Untertitel „Spurensuche“ des Wanderwegs
eine zusätzliche Bedeutung!
Unsere
Route führte uns also von Haidmühle über Neureichenau, Altreichenau, Grainet,
Herzogsreut, Philippsreut und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Diese Strecke
beträgt etwa 60 km und umfasst die Hälfte des Gesamtweges.
Der
Weg führte uns durch ausgedehnte, stille Wälder und immer wieder zu
Aussichtspunkten auf die schöne Hügellandschaft des Bayerischen Waldgebirges.
Wir sahen verlassene Dorfplätze am Säumerweg „Goldener Steig“ nach Böhmen
wie Schwendreut und Leopoldsreut, die erst Mitte des vorletzten Jahrhunderts von
den Bewohnern aufgegeben wurden und wo jetzt noch eine neu renovierte Kapelle
bzw. Kirche steht. Man fragt sich nachdenklich, wie die Leute dort in der rauen
Waldlandschaft in über 1000 m Höhe ihr karges Dasein gefristet haben? haben?
Wir
selbst konnten uns an der typischen „Bayerischen Waldesruh“ erfreuen.
Anzumerken
ist noch, dass insgesamt nur mäßige Anstiege zu bewältigen waren.Da wir auch
mit dem Wetter Glück hatten, war es schlussendlich eine schöne Wanderung.
Wermutstropfen
waren nur die lückenhafte Markierung, die fehlende spezielle Wanderkarte, sowie
die häufig geschotterten Waldwege bzw. asphaltierten Sträßchen.
Unterkünfte
waren um diese Jahreszeit in allen Orten zu bekommen und wir konnten sie aus dem
jeweiligen Ferienangeboten aussuchen. Besonders empfehlen möchten wir
diesbezüglich:
Pension
Kollern, Obere Hauptstr. 3, 94143 Grainet, Tel.: 08585/259 und Restaurant
Forellenhof, Fam. Schrottenbaum, Hauptstr. 27, 94158 Philippsreut, Tel.:
08550/1338.
Nach
unserer Rückkehr haben wir Herrn Fuchs von der ARGE in Grainet telefonisch
über unsere Erlebnisse – insbesondere die Markierungslücken – informiert.
Er sagte zu, dies bei den zuständigen Gemeinden zu reklamieren und überraschte
uns mit der Neuigkeit, dass soeben die spezielle Wanderkarte für diesen Weg
herausgekommen ist, die er uns auch sofort zuschickte.
Die
Karte heißt:
Offizielle
Wanderkarte 1: 50.000, 1. Auflage Landkreis Freyung – Grafenau, € 6,55
Herausgeber:
Studio für Landkartentechnik, Dipl.-Ing. Detlev Maiwald,
Gutenbergring
36, 22848 Norderstedt, Tel.: 040/5324046.
Diese
Karte kann man auch unter der o.g. Adresse von der ARGE in Grainet erwerben.
Damit
ausgestattet kann der interessierte Wanderer einzelne Rundwege oder die große
Rundtour des „Themenwanderwegs Kultur“ selbst auswählen und leichter
finden, und wir können diesen Weg jetzt ohne Einschränkung empfehlen.
Erschienen
in "Mitteilungsblatt"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 11 - August
2003
Runde
Hauptstadt -
66
Seen erwandert man auf einem Weg um Berlin herum
Von
Dr. Roland H. Knauer
Die
Sonne funkelt zwischen im Wasser modernden Baumstümpfen. Vertrocknetes Schilf
wiegt sich raschelnd im Wind, der sanft durch die Bäume streicht. Viele
Spaziergänger schlendern auf sandigem Weg an diesem Idyll vorbei, an einem
Forsthaus mit Gastwirtschaft auf einer Lichtung findet sich kein freier Tisch
mehr. Später aber verlieren sich an diesem Feiertag die Menschenmassen und der
Weg zu den 66 Seen rund um Berlin wird wieder so einsam, wie er meist ist. Von
einem See ist allerdings vorerst auf der Etappe zwischen Birkenwerder und
Wandlitz im Norden der Bundeshauptstadt nichts zu sehen. Der Sumpf wird vom Bach
Briese abgelöst, der sich zwischen glatten Buchenstämmen durchschlängelt.
Enten schwimmen auf dem Wasser, Kolkraben rufen über den Kronen.
Abgesehen
von den vielen Menschen, die man an wenigen Stellen wie in der
Weltkulturerbe-Stadt Potsdam trifft, vergisst der Wanderer auf diesem Rundweg
rund um Berlin sehr schnell, dass er sich nur wenige Kilometer außerhalb der
einzigen Metropole Deutschlands befindet.
In
vierzehn Etappen führt dieser Weg einmal um die Bundeshauptstadt und zeigt dem
Wanderer so ungefähr alle Landschaften, die das Land Brandenburg zu bieten hat:
Märkische Heide und märkischer Sand, dunkle Kiefernwälder, uralte Eichen,
Birkenalleen, Sümpfe, Wiesen und Äcker. Mit ein wenig Glück sichtet man
Spechte, Eichelhäher, Bussarde, Milane, Falken, Haubentaucher und Graureiher.
Im Frühjahr und Sommer klappern die Störche in der Mark Brandenburg und
während des Vogelzugs im Frühjahr und Herbst rasten Wildgänse und Kraniche in
und an den Seen.
Soviel
Natur vermutet kaum jemand in der unmittelbaren Umgebung einer Millionenstadt.
Durch die deutsche Teilung aber ging die Verstädterung des Umlandes an Berlin
mit wenigen Ausnahmen weitgehend vorbei. Im Gegenteil, in manchen Dörfern
scheint die Zeit bereits vor hundert Jahren stehen geblieben. Der Wanderer
taucht in eine Vergangenheit, in der irgendwo zwischen deutschem Reich und DDR
die Uhr stehen geblieben ist. Bröckelnder Putz an mancher braunen Fassade gibt
so manchem Dorf eine Würde, die andernorts längst Wettbewerben unter dem Motto
„Unser Dorf muss schöner werden" geopfert wurde.
Ganz
eigen wirkt zum Beispiel Wandlitz: Obwohl der abgeschottete Wohnbezirk der
DDR-Größen „Waldsiedlung Wandlitz" ein ganzes Stück abseits der
Wanderung liegt und längst in eine Reha-Klinik umgewandelt wurde, atmet das
Seeufer vielleicht am deutlichsten die Atmosphäre, die nach der Wende in den
östlichen Bundesländern das Klima bestimmt. Datschen neben einfachen Ein- und
Zweifamilienhäusern im althergebrachten Braunputz wechseln sich mit pompösen
Prunkvillen, die anscheinend besser mit Alarmanlagen gesichert sind als die
legendären US-Goldreserven in Fort Knox. Und zwischen diesen Vermögensanlagen
auf Seegrundstück blättert der Putz von den Häusern der Alteingesessenen. gesichert sind als die
legendären US-Goldreserven in Fort Knox. Und zwischen diesen Vermögensanlagen
auf Seegrundstück blättert der Putz von den Häusern der Alteingesessenen.
Samt
dem Bahnhofs-Ensemble im Bauhausstil ist Wandlitz eine Sehenswürdigkeit, die
der Wanderer so quasi am Wegesrand einfach „mitnimmt".
Niemand
wird übrigens die 14 Etappen rund um Berlin in einer Tour unter die
Wanderstiefel nehmen. Sind doch alle Ausgangs- und Endpunkte der einzelnen
Wegstrecken selten im Zweistundentakt, meist aber im Stunden- oder gar im
Zehn-Minuten-Takt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wer auf
Dienstreise in Berlin ein Wochenende anhängt, kann also leicht die eine oder
andere Etappe zwischen den 66 Seen genießen und dabei eine Gegend kennen
lernen, die in Deutschland einmalig ist.
Offizieller
Startpunkt für die 373 Kilometer lange Rundwanderung ist der Touristenrummel
Potsdams um die Schlösser Sanssouci und Cecilienhof. Bald aber erreicht man aus
der quirlig-behäbigen Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg die Einsamkeit
der Mark Brandenburg - und hat bereits die ersten fünf Seen nach einer halben
Etappe fotografiert. Wie der Name es bereits andeutet, geben vor allem die
Gewässer der 66-Seen-Wanderung ihren besonderen Reiz. Dorfteiche und
Fischweiher sind dabei noch gar nicht mit gezählt. Vom Entwässerungsgraben bis
zum Kanal für große Schiffe reicht die Palette der künstlichen Gewässer, an
denen man entlang schlendert. Stundenlang folgt man Bächen wie der Briese oder
der behäbigen Havel.
Je
nach Wochentag flitzen Sportboote oder tuckern schwere Lastkähne über das
glatte Wasser, immer wieder schreckt der Wanderer Enten auf. Hohe Pappeln
spiegeln sich im glatten Wasser, der Wind rauscht durch das Herbstlaub,
übertönt aber nicht das Gezwitscher der Vögel. Manchmal endet der Weg in
gigantischen Sand- oder Schutthaufen - ein Zeichen für die lebhafte
Baukonjunktur im Umland von Berlin. Nur mit Mühe und geschickten
Balance-Übungen am Ufer eines Kanals kommt man weiter, stößt aber bald wieder
auf den alten Weg. Der wiederum ist manchmal eher wild und verwachsen als
romantisch und bequem. Aber meist ist es ein gemütliches Wandern zu den 66
Seen.
Sattrot
spiegelt sich dann wieder das Herbstlaub in einem der unzähligen Gewässer, an
denen der Wanderer vorbei kommt. Einsame Häuschen ducken sich unter dem Laub
ans Ufer. Dann taucht der Pfad wieder in einen der typischen Mischwälder ein,
in denen sich Eichen, Buchen, Birken und Kiefern der Sonne entgegen strecken.
Ein schneeweißer Schwan treibt einsam über fast schwarzes Wasser, am Ufer
zittern Angler frierend im kalten Herbstwind. Die seltenen Krebsscheren strecken
ihre Agaven-ähnlichen Blätter unter Wasser dem Licht entgegen, Schafe weiden
daneben auf einer kargen, märkischen Wiese. Und in der Ferne blinkt schon das
Wasser des nächsten der 66 Seen.
Erschienen
in "Mitteilungsblatt"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 10 - April
2003
Wanderbericht
- Der Europäische Ferwanderweg 9
in
Mecklenburg-Vorpommern - Ein Flop!
Die
Verantwortlichen vor Ort favorisieren die Radfahrer.
Von
Lutz Heidemann
Seit
einigen Jahren weist die Deutsche Generalkarte, obwohl in dem groben Maßstab
von 1: 200000, doch wie sich zeigte mit ausreichender Präzision, einen
durchgehenden Wanderweg entlang der deutschen Ostseeküste aus, der als E 9 Teil
einer Verbindung von der französischen Atlantikküste bis Danzig ist und zum
Europäischen Fernwegenetz gehört. Dieser Fernwanderweg war auch auf den
Übersichtskarten der Europäischen Wandervereinigung zur Sternwanderung vom
Sommer 2001 („EuroRando“) enthalten. Man konnte daraus den Schluss ziehen,
er müsste auch in der Örtlichkeit existieren.
Uns
reizte dieser Teil Deutschlands. Wir wollten die Natur und auch die kleineren
und größeren historischen Küstenstädte und die dort geleistete
Wiederherstellungsarbeit kennen lernen. Meine Frau und ich waren nicht zum
ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern; 1998 sind wir auf unterschiedlich
markierten Wegen in zehn Tagen über 300 km von Wismar bis Neubrandenburg
gewandert, aber die Küste hatten wir damals nicht gesehen. So machten wir uns
im August 2002 auf den Weg.
Ich
hatte wieder eine zehntägige Tour vorbereitet. Wir starteten in Altbuckow
östlich von Wismar und erreichten nach ca. 270 km am 10. Tag Wolgast. Die
Rahmenbedingungen waren gut. Bis auf einen Regentag am Anfang war bestes
Sommerwetter. Trotzdem gab es einiges auszusetzen, zumindest kann ich die Tour
nicht uneingeschränkt empfehlen.
Als
wir wieder nach Hause gekommen waren, war inzwischen die Internet-Seite
„www.wanderbares-deutschland.de“
des Deutschen Wanderverbandes installiert worden. Die Etappen, die wir gewählt
hatten, waren nahezu identisch mit den dortigen Angaben. In der generellen
Routen-Charakterisierung heißt es u.a.: „Auf naturnahen Pfaden entlang der
Ostsee-Küste genießt man den Anblick reizvoller Seebäder, die einst aus
Fischerdörfern entstanden [sind]...“. Die Seebäder mit ihrer Wilhelminischen
Architektur kann man reizvoll finden, das ist Geschmackssache und ein „weites
Feld“, doch von naturnahen Pfaden konnte nur sehr eingeschränkt die Rede
sein, denn weit überwiegend werden die Wanderer über breite befestigte
Radwegen geführt. reizvoll finden, das ist Geschmackssache und ein „weites
Feld“, doch von naturnahen Pfaden konnte nur sehr eingeschränkt die Rede
sein, denn weit überwiegend werden die Wanderer über breite befestigte
Radwegen geführt.
Besonders
krass waren die Verhältnisse auf dem Abschnitt Kühlungsborn - Zingst, also dem
Teil, der direkt an der offenen Küste lag. Dort waren die Radwege perfekt
ausgebaut oder standen kurz vor der Vollendung. Da war viel Geld verbaut und
noch stolz das Etikett „Europäischer Fernwanderweg“ auf dem Bauschild
ange-bracht worden. Pulks von Radfahrern, die z.T. nur an ihre Badeplätze
gelangen wollten, zogen an uns vorbei. Wir fühlten uns neben ihnen als „Menschen
zweiter Klasse“. Radfahren hat sich inzwischen zu einem Gruppensport
entwickelt, im sympathischsten Fall zu einer Familienausflugs-Angelegenheit.
Entweder
mit Faszination oder als eine besondere Perfidie konnten wir die an uns
vorüberziehende Inline-Scater auffassen. Allein oder in Gruppen huschten
elegante junge Menschen vorbei. Verleiher für die Geräte dieser Trendsportart
hatten sich an den Ortsausgängen niedergelassen. Mit Rucksack „sieht man da
alt aus“ und sucht sich leicht stolpernd seinen Weg am Fuß des Dammes. Oft
sind wir dann direkt ans Wasser ausgewichen und über den feuchten Sand
gelaufen, doch auch da mit unseren Teleskop-Wanderstöcken merkwürdig
betrachtet von den meist sehr spärlich bekleideten Badegästen. Später dann
von Barth bis Greifswald ist die Küste überwiegend verschilft; dort geht es
ruhiger zu. Hier hatten wir reizvolle Ausblicke auf den Bodden und den
Strelasund. Die Kirchtürme sah man näherkommen oder langsam verschwinden.
Später querten wir größere Waldstücke.
Kann
man der Grobtrassierung voll zustimmen, müsste im Detail an der Wegeführung
noch manches verbessert werden. Muss man zum Beispiel hinter Warnemünde solange
auf der Straße gehen? Kann nicht im Bereich Heiligendamm ein Fußweg, als
bescheidener Trampelpfad, parallel zum Radweg markiert werden? Können nicht die
Fußgänger westlich von Kinnbackenhagen auf dem Deich direkt nach
Wendisch-Langendorf gehen? Dass die Radfahrer aus dem Landschaftsschutzgebiet
herausgehalten werden sollen, verstehe ich ja. Kurz vor Barhöft scheint der
direkte Weg weggepflügt worden sein. So gäbe es viele kleine
Verbesserungsmöglichkeiten. Radfahrer aus dem Landschaftsschutzgebiet
herausgehalten werden sollen, verstehe ich ja. Kurz vor Barhöft scheint der
direkte Weg weggepflügt worden sein. So gäbe es viele kleine
Verbesserungsmöglichkeiten.
Sehr
mangelhaft war die Markierung. Das Grundzeichen ist ein blauer Balken auf
weißem Grund. Bei der Markierung und den Wegweisern fanden wir keinen einzigen
kein Hinweis darauf, auf einem Europäischen Fernwanderweg zu sein. Vielleicht
wäre eine Lösung, so wie in Slowenien, bei der Überlagerung eines nationalen
mit einem internationalem Weg, angebracht, dass jede fünfte oder zehnte
blau-weiße Markierung den Zusatz E 9 erhält, denn auch abzweigende Wege
scheinen so markiert zu sein. Auf dem Abschnitt hinter Barth fehlten die
Markierungen; es gab nur Hinweise auf lokale Wegstücke.
Das
Herein- und Herausführen aus Stralsund war problematisch. Nördlich und
östlich der Stadt sind Uferabschnitte durch öffentliche und halbprivate Nutzer
unzugänglich. Hier Abhilfe zu schaffen, im Extremfall über Stege im Wasser mit
Einblicksmöglichkeiten in den Betrieb eines Hafens oder einer Werft, kann viel
Geld kosten, bedeutet aber für Bevölkerung wie Besucher ein Zugewinn an
Stadtqualität.
Beim
Weg aus Stralsund heraus tauchten erst weit draußen erste Markierungen auf und
lenkten uns in Richtung Justizvollzugsanstalt, aber dann kamen wir in eine
Sackgasse. Wenig später wurden wir auf einem Betonplattenweg, der zugleich
Zufahrtsweg für die Lkws einer Müll-Deponie war, geführt. Den
Verantwortlichen für die Trassenführung auf dem Abschnitt Greifswald—Wolgast
nehme ich es persönlich übel, dass wir
hinter Eldena bis Friedrichshagen entlang einer starkbefahrenen Bundesstraße
und später auf einer Asphaltstraße bis Großschönweide gehen mussten, wogegen
ruhige und sogar granitgepflasterte Wege im angrenzenden Wald existieren. Man
kann es auch merkwürdig finden, dass ein Europäischer Fernwanderweg eine
kulturelle Besonderheit wie das ehemalige Zisterzienser-Kloster Doberan so
schnöde links liegen lässt. Wenigstens eine Wegevariante über Doberan sollte
entwickelt werden.
Andere
Weitwanderer haben wir nicht getroffen. In den Hotels wurden wir bestaunt. Auf
unseren Hinweis, dass die Strecke für Wanderer Mängel hätte, bekamen wir
einmal die Antwort, das hätten auch schon andere Gäste gesagt. Die
Verantwortlichen müssen sich entscheiden, ob sie Wanderer wollen und ihnen dann
eine adäquate Wegeführung anbieten.
Doch
ich will versöhnlich schließen, wir haben uns erfolgreich durchgeschlagen;
letztlich war es eine schöne Tour und Wanderer sind ja „hart im Nehmen“.
Die Luft tat uns gut; die wechselnde Landschaft zog uns weiter; die Menschen,
die wir ansprachen, waren freundlich und hilfsbereit. Stoff zum Nachdenken über
das heutige Aussehen des durchwanderten Gebietes, die Formung von Landschaft in
der Eiszeit und das immerwährende Verändern der Küsten gab es genug.
Wer
unsere Tour im Detail nachvollziehen will, hier noch einmal die Etappen:
1.
Wandertag: Pepelow bis Kühlungsborn-Ost, viele Hotels 28 km
2.
Wandertag: bis Warnemünde, viele Hotels 24 km
3.
Wandertag: bis Wustrow (32 km) oder Ahrenshoop 31 km
4.
Wandertag: bis Prerow (26 km) oder Zingst 30 km
5.
Wandertag: bis Barth, Hotel „Speicher“ 038231/63-300 24 km
6.
Wandertag: bis Barhöft, „Hotel Seeblick“ 038323/ 4500 36 km
7.
Wandertag: bis Stralsund, viele Hotels 17 km
8.
Wandertag: bis Reinberg 27 km Oberhinrichshagen
Hotel Borgwarthof 038328/ 8650
9.
Wandertag: bis Greifswald, viele Hotels 30 km
10.
Wandertag: bis Wolgast, 38 km Hotel
Peenebrücke,
Burgstr.2 03836/ 27260
Rückfahrt zum Auto
Wir
sind dann noch mit dem Auto durch die kleineren und größeren Städte von
Ostmecklenburg und Vorpommern gefahren und haben viele backsteingotischen
Kirchen und bescheidenen oder prächtigeren Bürgerhäusern betrachtet, die
reichen Museen und Galerien besucht und uns an den umfangreichen Renovierungen
erfreut.
Als
eine Alternative zu einer Küstenwanderung unser Weg im Jahr 1998:
1.
Wandertag: Wismar bis Wickendorf nördl. von Schwerin
(Seehotel Frankenhorst 0385/555071) 31 km
2.
Wandertag: durch Stadt Schwerin bis Leezen
(Hotel Leezen 03866/4050) 25 km
3.
Wandertag: bis Sternberg 30 km
4.
Wandertag: bis Güstrow 38 km
5.
Wandertag: nachmittags bis Krakow am See 22 km
6.
Wandertag: bis Malchow über Nossentiner Heide 33 km
7.
Wandertag: bis Waren 28 km
8.
Wandertag: bis Boek 22 km
9.
Wandertag: bis Neustrelitz 29 km
10.
Wandertag: bis Prillwitz 19 km
11.
Wandertag: bis Neubrandenburg 17 km
und nachmittags mit Bahn zurück nach Wismar.
Es
stellte sich damals heraus, dass die „Kompass-Karten“ recht brauchbar waren.
Im Nationalpark Müritz benutzten wir die von ihm herausgegebene Karte. Auch
damals wurden wir an einigen Etappen, z.B. Sternberg—Güstrow über befestigte
Wege geführt, doch insgesamt trat dieses Problem nicht in der Schärfe wie bei
dem Küstenweg auf. Nun stellte ich fest, dass inzwischen größere Abschnitte
unserer damaligen Tour unter dem Begriff E 9a firmieren.
Erschienen
in "Mitteilungsblatt"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 8 - Oktober
2002
Wandern auf dem neuen Rheinsteig –
Lutz Heidemann berichtet
von den Erfahrungen mit dem neuen Premiumweg und macht eine kritische Analyse
der Rheinsteig-Wanderführer
Ein Bericht aus Nr.19 von
„Wege und Ziele“, der Zeitschrift von
„Netzwerk Weitwandern“
Wandern
„auf hohem Niveau“ –
Erfahrungen
vom neuen Rheinsteig
Von
Lutz Heidemann
Im
Oktober 2005 sind meine Frau und ich sechs Tage auf dem Rheinsteig unterwegs
gewesen. Wir waren anschließend voll des Lobes. Das durchwanderte Gebiet ist
keine unproblematische Gegend; es ist unzweifelhaft schön, aber auch mit
Vorurteilen verschiedenster Art belastet. Zu diesem problematischen Erbe gehört
der „Geist“ des 19. Jahrhunderts mit seiner Burgenromantik und nationalen
Tönen vom „deutschen Fluß, der nicht Deutschlands Grenze“ sei. Aber ich
weiß, auch Engländer haben an der Entstehung des in den Köpfen verankerten
Bildes von heroischer Landschaft und Rheinidyllen mitgewirkt. Selbst auf
Franzosen wie Victor Hugo oder Rimbaud hat der Fluß faszinierend gewirkt, und
in Japan scheint die Loreley noch populärer als in Deutschland zu sein. So ist
eine Rheinwanderung keine Expedition in ein Neuland; am Rhein ist schon lange
vor uns gewandert worden und es existiert ein dichtes Wegenetz. Kann man also
heute am Rhein noch etwas entdecken? Man kann.
Der
neue „Rheinsteig“ ist den Wanderinnen und Wandern im September 2005
offiziell übergeben worden. Die Planungsvorbereitungen und die Umsetzung in der
Örtlichkeit haben mehrere Jahre gedauert. Die Trasse konnte schon 2004 aus dem
Internet heruntergeladen werden. Doch 8000 Schilder anzubringen dauert seine
Zeit. An einigen Stellen werkelten im Herbst 2005 noch Handwerker an Geländern
und Brücken. Die Grundausstattung aus hergerichteten Wegen, einer perfekten
Beschilderung, einer Faltkarte, zwei Führern (einer in Nord-Süd-, der andere
in Süd-Nord-Richtung) und einem Unterkunftsverzeichnis liegt vor. Auch die
Medien-Trommel ist schon fleißig gerührt worden. andere
in Süd-Nord-Richtung) und einem Unterkunftsverzeichnis liegt vor. Auch die
Medien-Trommel ist schon fleißig gerührt worden.
Der
Weg und seine Aufbereitung hat ein Vorbild: den Rothaarsteig im Sauerland. Wie
beim Rothaarsteig ging die Initiative von den Fremdenverkehrsverantwortlichen
und staatlich-halbstaatlichen Stellen aus. Bei beiden Wegen gab es hohen
Koordinierungsaufwand, nicht zuletzt, weil jedesmal der Weg über mehrere
Bundesländer geht. Beide Wege haben gleiche „geistige Väter“; eine
wichtige Rolle spielte der Marburger Professor Rainer Brämer und das von ihm
geleitete Deutsche Wanderinstitut. Der von Brämer und seinen Mitarbeitern
konzipierte und formalisierte Qualitätsstandard führte zu dem Etikett „Premiumweg“,
das der Rheinsteig auch nach meiner „unsystematischen“ Einschätzung
verdient hat. Sprachlich wird noch eins zugelegt; der Weg wird verkauft mit dem
Slogan „Wandern auf hohem Niveau“.
 Der
Rheinsteig reicht von Bonn bis Wiesbaden; er bleibt nur auf der rechten
Rheinseite. Wie beim Rothaarsteig gibt es ein „Rückgrat“, den Hauptweg, und
dazu die auch etwas anders markierten „Zubringerwege“.
Das erlaubt das Zusammenstellen von individuellen Touren und ist hilfreich für
Tagesausflügler. Besonders die Bahnhöfe im Tal, ebenso die
Schiffsanlegestellen oder große Parkplätze in Dörfern auf der Hochebene sind
Ausgangspunkte der Zubringerwege. Der
Rheinsteig reicht von Bonn bis Wiesbaden; er bleibt nur auf der rechten
Rheinseite. Wie beim Rothaarsteig gibt es ein „Rückgrat“, den Hauptweg, und
dazu die auch etwas anders markierten „Zubringerwege“.
Das erlaubt das Zusammenstellen von individuellen Touren und ist hilfreich für
Tagesausflügler. Besonders die Bahnhöfe im Tal, ebenso die
Schiffsanlegestellen oder große Parkplätze in Dörfern auf der Hochebene sind
Ausgangspunkte der Zubringerwege.
Der
Weg ist vielseitig. Er ist deutlich für Wanderer trassiert, so trafen wir auch
kaum Mountainbiker. Der Weg fordert die Wanderer; er hat viele Steigungen. Die
Überwindung von 800 Höhenmetern pro Tag ist normal, bei der Etappe
Ehrenbreitstein Braubach standen 1200 m an. Ein bayerischer Wanderer, den wir
unterwegs trafen, lobte Weg und fand ihn sogar anstrengend. Der Weg ist nahezu
perfekt markiert, aber es heißt aufpassen. Es ist kein Weg zum Dahintrotteln,
das ist nicht angesagt oder man hat leicht die ins Grüne abgebogene Fortsetzung
verpaßt. Wenn wir vom Rheinsteig abkamen, geschah das immer dann, wenn der alte
mit einem „R“ gekennzeichnete und meist „gerade“ verlaufende
Rheinhöhenweg“ in eine befestigte Ortsstraße überging, der Rheinsteig
dagegen fast unbemerkt sich „seitlich in die Büsche schlug“. Höhenmetern pro Tag ist normal, bei der Etappe
Ehrenbreitstein Braubach standen 1200 m an. Ein bayerischer Wanderer, den wir
unterwegs trafen, lobte Weg und fand ihn sogar anstrengend. Der Weg ist nahezu
perfekt markiert, aber es heißt aufpassen. Es ist kein Weg zum Dahintrotteln,
das ist nicht angesagt oder man hat leicht die ins Grüne abgebogene Fortsetzung
verpaßt. Wenn wir vom Rheinsteig abkamen, geschah das immer dann, wenn der alte
mit einem „R“ gekennzeichnete und meist „gerade“ verlaufende
Rheinhöhenweg“ in eine befestigte Ortsstraße überging, der Rheinsteig
dagegen fast unbemerkt sich „seitlich in die Büsche schlug“.
 Zu
einen Weg dieses Anspruches gehören nicht nur eine intelligente Trassenwahl und
eine zuverlässige Markierung, sondern auch weitere Wanderhilfen wie
Informationen über mögliche Unterkünfte und das Organisieren von Führern und
Karten. So gibt es für den Rheinsteig eine gute, von den staatlichen
Vermessungsämtern mit dem Projektbüro Rheinsteig gemeinsam herausgebrachte
Karte im Maßstab 1:50.000. Sie ist zweisprachig und pfiffig aufgeteilt und
gefaltet und zeigt auch die anderen Wege im Rheintal und auf der andern
Flußseite. Das ist gut, aber bei dem „Gewimmel“ von Wegen an der „Hangkante“
kann nicht immer nachvollzogen werden, welches in der Karte dargestellte
Wegstück zu welchem Fernwanderweg gehört. In der Örtlichkeit ist das dann
kein Problem, die Markierungen vom Rheinsteig sind unübersehbar und dominieren
alle anderen Wegsysteme. Für die Markierung ist ein schönes Logo entwickelt
worden; es ist intelligent gemacht. Es kann sowohl als Abbild des Rheintales mit
dem sich Zu
einen Weg dieses Anspruches gehören nicht nur eine intelligente Trassenwahl und
eine zuverlässige Markierung, sondern auch weitere Wanderhilfen wie
Informationen über mögliche Unterkünfte und das Organisieren von Führern und
Karten. So gibt es für den Rheinsteig eine gute, von den staatlichen
Vermessungsämtern mit dem Projektbüro Rheinsteig gemeinsam herausgebrachte
Karte im Maßstab 1:50.000. Sie ist zweisprachig und pfiffig aufgeteilt und
gefaltet und zeigt auch die anderen Wege im Rheintal und auf der andern
Flußseite. Das ist gut, aber bei dem „Gewimmel“ von Wegen an der „Hangkante“
kann nicht immer nachvollzogen werden, welches in der Karte dargestellte
Wegstück zu welchem Fernwanderweg gehört. In der Örtlichkeit ist das dann
kein Problem, die Markierungen vom Rheinsteig sind unübersehbar und dominieren
alle anderen Wegsysteme. Für die Markierung ist ein schönes Logo entwickelt
worden; es ist intelligent gemacht. Es kann sowohl als Abbild des Rheintales mit
dem sich windenden Fluß gesehen wie als ein stilisiertes „R“ für „Rheinsteig“
gelesen werden. windenden Fluß gesehen wie als ein stilisiertes „R“ für „Rheinsteig“
gelesen werden.
Wie
gesagt, der Weg ist so gut ausgeschildert, daß man eigentlich auch ohne einen
Führer auskommen könnte, aber es gibt, wie erwähnt, inzwischen bereits zwei
Führer. Praktische Bedeutung haben die Führer für die Planung von Etappen.
Die Führer machen Angaben für die zu veranschlagende Dauer zwischen
Einzelstrecken. Denen kann man vertrauen und sich kürzere oder längere
Tagesetappen zusammenstellen, gerade weil das Übernachtungsangebot entlang des
Weges solche Freiheiten erlaubt.
Der
Führer in Wanderrichtung Süd ist beim Verlag Idee Media, Neuwied in der Serie
„Ein schöner Tag - kompakt“ herausgekommen (ISBN 3-934342-41-8. Preis 12.95
€). Andere Veröffentlichungen des Verlages tragen so schöne wie
unverbindliche Namen wie NaturTOUREN, BadeTOUREN, oder FamilienTOUREN. Die
Autoren des Rheinsteig-Führers sind Renate und Olaf Goebel. Sie pflegen eine
neckische muntere Sprache. Sich über ihren Aufforderungs-Tonfall zu mokieren,
ist vielleicht ein falsches und ungerechtes Urteil von mir, die Wahl eines
solchen Sprachduktus und der reichen Bebilderung und des vielfarbigen Layouts
sind heute vorausgesetzte Bestandteile beim „Werben“ für ein
Tourismus-Produkt und zum Wandern allgemein. Dieser Führer enthält auch die
GPS-Daten der Wegweiser an Kreuzungen und Wegegabelungen. Doch bei der guten
Markierung läßt mich das Mitnehmen dieses Gerätes eher an das Ausführen
eines Hundes oder teuren Pelzmantels denken.
Die
zweite Veröffentlichung mit dem Titel „Abenteuer Rheinsteig“, die den
Wanderer flußabwärts von Süden nach Norden begleitet, ist vom Görres Verlag
in Koblenz in Kooperation mit „pepper“, dem Veranstaltungsmagazin der Rhein
Main Presse Mainz, herausgebracht worden. (ISBN 3-935690-42-8. 12.80 €).
Dieser Führer enthält auch Kartenskizzen. Er ist größer und dicker und somit
auch deutlich schwerer. Drei Autoren sind im Kopf genannt; auch hier ist bei der
Sprache ihre journalistische Herkunft unüberlesbar. Unterwegs werden die
Wanderer kräftig an die Hand genommen und ihnen immer und immer wieder ihnen
gesagt, wann abgebogen werden soll oder der Weg eine Kehre macht. Das im Titel
versprochene „Abenteuer“ bleibt da fast aus. Doch zielen solche Begriffe wie
die gesamte Aufmachung eher auf Menschen ohne Wandererfahrung und sollen sie
ermuntern, eine mehrtägige Tour zu machen. Autoren sind im Kopf genannt; auch hier ist bei der
Sprache ihre journalistische Herkunft unüberlesbar. Unterwegs werden die
Wanderer kräftig an die Hand genommen und ihnen immer und immer wieder ihnen
gesagt, wann abgebogen werden soll oder der Weg eine Kehre macht. Das im Titel
versprochene „Abenteuer“ bleibt da fast aus. Doch zielen solche Begriffe wie
die gesamte Aufmachung eher auf Menschen ohne Wandererfahrung und sollen sie
ermuntern, eine mehrtägige Tour zu machen.
Es wird
viel geplaudert, wichtiges und unwichtiges („Im Kurort Schlangenbad fühlten
sich schon Adelige und Diplomaten wohl“) erwähnt und auch manches doppelt
berichtet. Verwendete Fach-Begriffe sollte man nicht auf die Goldwaage legen,
daß z.B. die Mönche von Kloster Eberbach eine „eigene Flotte von drei
Schiffen“ besaßen oder eine Burg der Herren von Scharfenstein deren „Regierungs-
und Stammsitz“ war. Ausdrücklich zu loben ist das Interesse der Autoren an
der Deutung von Namen. Sie erwähnen zum Beispiel, daß das Siebengebirge kaum
nach sieben Bergen benannt wurde, sondern der Name von den „Siefen“
herzuleiten ist, das sind tief eingeschnittene Trockentäler, in Westfalen
heißen sie „Siepen“. Bei der Namenserklärung des Lurley, so hieß der Fels
bis zum frühen 19. Jahrhundert, dessen zweiter Namens-Bestandsteil Ley = Stein,
Felsen, Schiefer am Rhein häufiger vorkommt, halten sich beide Führer zurück
und verweisen auf das Besucherzentrum mit Erlebnismuseum.
Eine
weitere Hilfe ist das kostenlos erhältliche sog. Gastgeber-Verzeichnis. Es ist
quasi die Klammer für beide Führer, für beide Veröffentlichungen gibt es
hier Anzeigen. Auf der TourNatur in Düsseldorf im September 2005 war bei den
Übernachtungsangeboten von „geprüfter Rheinsteig-Qualität“ gesprochen
worden. Wir fanden das Hotelangebot eher gemischt. Hervorzuheben war die
freundliche persönliche Stimmung in den Hotels und Gasthöfen. Die Wirte
berichteten, selbst von Resonanz des Rheinsteigs völlig überrascht zu sein.
Mir wurde berichtet, daß zu einer Info-Veranstaltung des
Rheinsteig-Projektbüros im nördlichen Abschnitt nur zwei Hoteliers gekommen
seien. Jetzt dürfte der Boden bereitet sein. Mir scheint das
Gastgeber-Verzeichnis überarbeitungsbedürftig; es sollte nicht dicker, sprich
schwerer werden, aber hinsichtlich der Informationen deutlicher auf die
Wandergäste bezogen sein. Das Verzeichnis enthält bei weitem nicht alle
Beherbergungsbetriebe am Weg; es beruht auf kostenpflichtigen Eintragungen und
Selbstdarstellungen. Nur so ist zu erklären, daß eine teure Hotellerie aus St.
Goar von der anderen Rheinseite dort ausführlich vertreten ist. überarbeitungsbedürftig; es sollte nicht dicker, sprich
schwerer werden, aber hinsichtlich der Informationen deutlicher auf die
Wandergäste bezogen sein. Das Verzeichnis enthält bei weitem nicht alle
Beherbergungsbetriebe am Weg; es beruht auf kostenpflichtigen Eintragungen und
Selbstdarstellungen. Nur so ist zu erklären, daß eine teure Hotellerie aus St.
Goar von der anderen Rheinseite dort ausführlich vertreten ist.
Was
erwartet ein Wanderer von Hotels: Ein generelles Willkommen trotz
möglicherweise schmutziger Füße; ein Abhol-Angebot, wenn man die Länge einer
Etappe unterschätzt hat? Wird mit solchen Angeboten Mißbrauch getrieben oder
ist das ein Taxi-Thema? Ein hilfreicher Service sind Möglichkeiten zum Trocknen
von nasser Kleidung und insbesondere von nassen Schuhen, Leih-Pantoffel, um ins
Restaurant zu gehen. Ansonsten sind Wanderer Menschen wie du und ich und genau
so unterschiedlich.
Ein
heikles Thema ist die Ruhe in den Hotels. Der Wanderer ist über Stunden durch
große Stille spaziert. Dann ist es ein Schock, wenn nachts der Güterzug direkt
neben dem Bett zu fahren schien. Das war nicht Nachlässigkeit der Wirte,
sondern ist ein schwieriges städtebauliches Erbe, weil im 19. Jahrhundert die
Bahnen unmittelbar an die historischen Stadtkernen vorbeigeführt wurden. Aber
auch da sind in einzelnen Häusern mit baulichen Aufwendungen erstaunliche
Ergebnisse erzielt worden.
Als
wir im Herbst 2005 unterwegs waren, sind wir von Rengsdorf bei Neuwied bis kurz
vor die Loreley gewandert. Wir sind dann von St. Goarshausen mit der Bahn über
Koblenz nach Neuwied zurückgefahren, haben den Bus bis Sayn benutzt und sind
eine knappe Tagesetappe bis zu unserem Auto in Rengsdorf zurückgewandert. Wir
hatten dabei das Vergnügen, auch einmal „rückwärts“ zu gehen, was mit der
immer wieder spannenden Erfahrung verbunden ist, an was erinnern wir uns, was
kommt demnächst, was ist andersherum eine Überraschung, ist ein „bekannter“
Weg kürzer?
Ich
wiederhole noch einmal, es machte wegen der Vielseitigkeit der Landschaft
einfach Spaß hier zu wandern. Es ist meist eine Überraschung, welches neue
Landschaftsbild auf dem Rheinsteig Tag für Tag folgt. Wir kennen nur das
Neuwieder Becken und nördliches Mittelrheintal. Über die ganze Strecke kommt
man noch durch weitere sehr unterschiedliche Landschaftstypen: das
Siebengebirge, den südlichen Abschnitt des engen Rheintales, dann die weite
Landschaft von Rheinhessen. So hat der Rheinsteig über die ganze Länge einen
„drive“, der Wanderer weiterzieht. Es ist meist eine Überraschung, welches neue
Landschaftsbild auf dem Rheinsteig Tag für Tag folgt. Wir kennen nur das
Neuwieder Becken und nördliches Mittelrheintal. Über die ganze Strecke kommt
man noch durch weitere sehr unterschiedliche Landschaftstypen: das
Siebengebirge, den südlichen Abschnitt des engen Rheintales, dann die weite
Landschaft von Rheinhessen. So hat der Rheinsteig über die ganze Länge einen
„drive“, der Wanderer weiterzieht.
Wir
trafen andere Wanderer, auch viele Tagesausflügler und das begründet mein
Urteil, daß der Weg eine gute Resonanz gefunden hat. Wir wurden auch von
Einheimischen auf unsere Wandererfahrungen angesprochen und bekamen mitgeteilt,
daß sie auch schon mehrere Etappen in ihrer Umgebung gewandert seien.
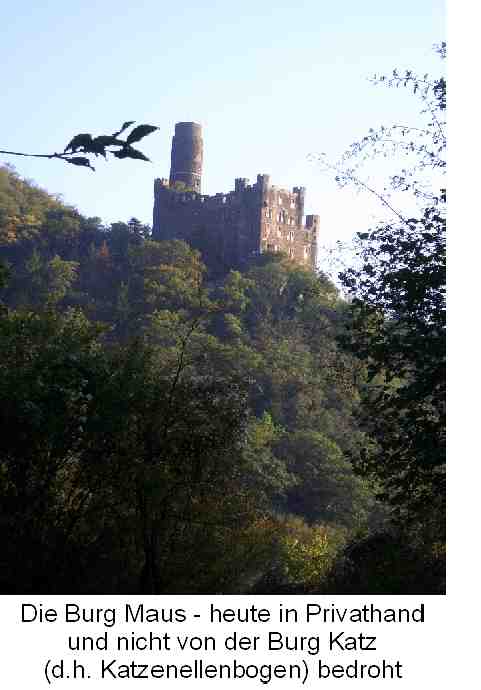 Im
mittleren Abschnitt geht es hoch und runter. Beim Abstieg hat man manchmal einen
Ort praktisch in der Vogelperspektive vor sich. Dann kommt der Aufstieg, oft an
einer Burg vorbei. Von dort wurde früher das Tal kontrolliert, bewacht und ggf.
gesperrt. Die Burgen sind gebaute Machtgesten. Die Mautstelle auf dem Weg zum
Meer auf einer französischen Autobahn sieht nicht so ästhetisch aus wie die
Pfalz auf der Rheininsel bei Kaub, und heute geht Bedrohlichkeit eher von
elektronischen Lesegeräten aus. Im
mittleren Abschnitt geht es hoch und runter. Beim Abstieg hat man manchmal einen
Ort praktisch in der Vogelperspektive vor sich. Dann kommt der Aufstieg, oft an
einer Burg vorbei. Von dort wurde früher das Tal kontrolliert, bewacht und ggf.
gesperrt. Die Burgen sind gebaute Machtgesten. Die Mautstelle auf dem Weg zum
Meer auf einer französischen Autobahn sieht nicht so ästhetisch aus wie die
Pfalz auf der Rheininsel bei Kaub, und heute geht Bedrohlichkeit eher von
elektronischen Lesegeräten aus.
Von
dem von den Wegemachern evoziertem „hohen Niveau“ blickt der Wanderer oder
die Wanderin immer wieder mit Neugier in den Talboden herunter. Die Schiffe
lenken als erste den Blick auf sich. Sie gleiten ruhig allein über das Wasser
oder sind locker zu kleinen Ketten oder enger zu Schub-Verbänden
aneinandergefügt. Die Orte am gegenüberliegenden Ufer entfalten ihre
Individualität durch Kirchen oder besondere Nutzbauten, Wohnhäuser sind groß
wie Spielzeug, die Züge gleichen schnellen Raupen. Die von der Sonne
beschienenen steilen Hänge erlaubten hier seit dem Frühmittelalter den Anbau
eines „Kultgetränkes“. (Auch westfälische Klöster bemühten, sich in den
Besitz von ein paar Weinbergen zu kommen. Auch da gibt es inzwischen Konkurrenz
vom Mittelmeerraum oder der Südhalbkugel.) entfalten ihre
Individualität durch Kirchen oder besondere Nutzbauten, Wohnhäuser sind groß
wie Spielzeug, die Züge gleichen schnellen Raupen. Die von der Sonne
beschienenen steilen Hänge erlaubten hier seit dem Frühmittelalter den Anbau
eines „Kultgetränkes“. (Auch westfälische Klöster bemühten, sich in den
Besitz von ein paar Weinbergen zu kommen. Auch da gibt es inzwischen Konkurrenz
vom Mittelmeerraum oder der Südhalbkugel.)
Der
Weg ist nicht vorrangig auf Besichtigungen von historischen Bauwerken angelegt.
Es gibt Objekte an der Strecke, die man einfach gesehen haben sollte. Die
Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz oder die Marksburg bei Braubach sind solche
Objekte. Das passen auch gut in die Etappenplanung. Andere Burgen am Weg sind
eher unzugänglich.
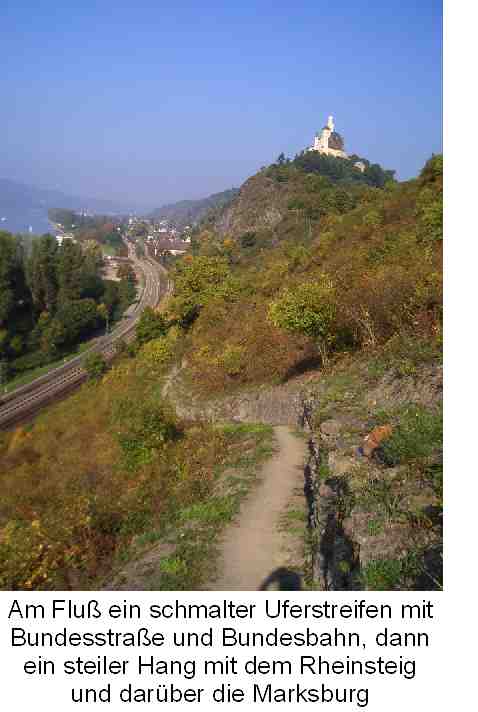 Verkehrslärm
dringt vom Talgrund herauf; meist sind es die Züge, manchmal auch von
Gewerbebetrieben. Es gibt erstaunlich stille Nebentäler. Jede Möglichkeit von
unbefestigten Wegeabschnitten wurde von den Wegemachern genutzt. Der Anteil an
befestigten Strecken vernachlässigend minimal; also wirklich: Premium! Zum Teil
wurden Wege in Form von Trampelpfaden durch Wandstücke frisch angelegt. Verkehrslärm
dringt vom Talgrund herauf; meist sind es die Züge, manchmal auch von
Gewerbebetrieben. Es gibt erstaunlich stille Nebentäler. Jede Möglichkeit von
unbefestigten Wegeabschnitten wurde von den Wegemachern genutzt. Der Anteil an
befestigten Strecken vernachlässigend minimal; also wirklich: Premium! Zum Teil
wurden Wege in Form von Trampelpfaden durch Wandstücke frisch angelegt.
Es
war viel „geholzt“ worden, d.h. an markanten Stellen Bäume und Büsche
beseitigt worden, um eine freie Sicht ins Tal zu haben. Auch das gehört zur
Landschafts- bzw. Weginszenierung. Hier wird deutlich, daß bei der „Wegemacherei“
ganz entscheidend Landschaftsplaner beteiligt waren. Aber solche „Inszenierungen“
bedürfen auch der kontinuierlichen Kontrolle und Nacharbeit. Hier wird sich
erweisen, ob der Anspruch nachhaltig aufrecht erhalten bleibt. bei der „Wegemacherei“
ganz entscheidend Landschaftsplaner beteiligt waren. Aber solche „Inszenierungen“
bedürfen auch der kontinuierlichen Kontrolle und Nacharbeit. Hier wird sich
erweisen, ob der Anspruch nachhaltig aufrecht erhalten bleibt.
Wir
kamen durch größere Buchenbestände, z.T. gemischt mit Eichen; nur wenige
Abschnitte führen durch Nadelwald. An den der Mittags- oder Nachmittagssonne
ausgesetzten Hängen stießen wir auf Robinien, z.T wild-malerisch von Lianen
überwuchert. Eßkastanien zeigen, wie klimatisch herausragend die durchwanderte
Gegend ist. Auf der Hochebene geht der Weg an Feldern vorbei. Wenn die
Rheinsteig-Werbung von „unberührter Natur“ spricht, ist das
landschaftsgeschichtlich gesehen ziemlicher Blödsinn, aber die Leute glauben
das vielleicht sogar.
Noch
ein paar grundsätzliche Bemerkungen zur Wegemacherei. Natürlich wäre eine
gründliche Überarbeitung des Rheinhöhenweges denkbar gewesen. Das wäre ein
interessantes Exempel für die Regenerationsfähigkeit von deutschen „Traditionswegen“
gewesen, denn in der Realität ist der Rheinsteig ein renovierter
Rheinhöhenweg. Die Trasse ist dort, wo es möglich war, näher an die „Hang-kante“
herangerückt worden. Es ist ein Weg „über die Höhen“, kein Weg entlang
des Flusses oder „auf halber Höhe“ parallel zum Fluß z.B. durch die
Weinberge. Einige Streckenabschnitte haben eine neue Doppelmarkierung mit dem
„ weg“. Auch der „Limeswanderweg“ des Westerwaldvereines läuft
häufiger parallel. Es ist ein neuer Weg zu den bestehenden „Themenwegen“
gekommen, es hat keine „Flurbereinigung“
zugunsten einer neuen wanderfreundlichen Haupttrasse gegeben. Haupttrasse gegeben.
Die
Raum-Verhältnisse des Mittelrheintales sind faszinierend und schwierig. Der
Fluß war seit vorgeschichtlicher Zeit eine „Verkehrs- und Entwicklungsachse“
von europäischer Bedeutung. Seit dem 19. Jahrhundert sind neue Transportformen
und Verkehrsbänder, Eisenbahnen auf beiden Uferseiten und die ebenfalls stark
ausgebauten Bundesstraßen dazugekommen. Durch technisch aufwendige
Ortsumgehungen ist in letzter Zeit den Anwohnern geholfen worden. Wir waren
angenehm überrascht, wie ruhig es in einem Hotel in Ehrenbreitstein direkt an
der Bahnlinie war. Doch anderswo sind soziale Erosionen in den kleinen
historischen Zentren unübersehbar, sind die, die es sich leisten konnten, z.B.
auf die Hochebene gezogen. Für den Wanderer sind trotz schöner Wegeabschnitte
die Bausünden der letzten Jahrzehnte unübersehbar: große ungeschlachte
Baukörper für Freizeiteinrichtungen im Außenbereich wie Reitställe oder
Schützenhallen, z.T. leerstehende Tagungszentren, der Kühlturm vom Kraftwerk
Mühlheim-Klärlich, Großbauten wie eine Wellness-Klinik auf der Hochebene bei
Koblenz oder als Seniorenresidenzen deklarierte Hochhäuser. Wie kann man da
gegensteuern?
Das
Mittelrheintal ist von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Das war
letztlich ein Hilferuf. Das Mittelrheintal ist nun mal charakterisiert durch
seine dicht im Talgrund zusammengedrängte Bebauung. Geographisch gibt es nur
wenige Vergleichsbeispiele, z.B. das Rhonetal südlich von Lyon oder noch
ähnlicher die Achse Innsbruck Brennerpaß und Eisack-Etschtal. Die Einrichtung
des Rheinsteiges war eine strukturpolitische Maßnahme, daher der hohe
öffentliche Aufwand. Der Weg und seine Popularisierung sollen dem
Mittelrheingebiet Entwicklungsimpulse geben, vordergründig ein neues Image
erzeugen und neue Besuchergruppen zuführen. Deshalb bei allem Lob trotzdem
meine neugierigen Fragen: Wie lange wird der jetzt beobachtete Aufschwung beim
Gaststättengewerbe andauern und auch darüber hinaus durch das Medienspektakel
zu Änderungen im allgemeinen Bewußtsein führen? Kann beim Mittelrhein das
Klischee von Wein, Weib, Gesang überwunden oder erweitert werden? Wie
nachhaltig war der regionale Erneuerungsimpuls im Sauerland durch den
Rothaarsteig?
Fotos:
Bettina Heidemann
Wandern in Oberbayern
Markus Mohr wanderte mit
dem Zelt von Lenggries nach Urfeld am Walchensee
Ein Bericht aus Nr.19 von
„Wege und Ziele“, der Zeitschrift von
„Netzwerk Weitwandern“
Mit
dem Zelt von Lenggries nach Urfeld am Walchensee
Von
Markus Mohr
1.Tag
Gegen
6.30 Uhr reißt mich mein Wecker aus dem Schlaf. Es geht los – die schon lang
ersehnte Tour von Lenggries nach Murnau. Nach einem ausgiebigen Frühstück
verlasse ich gegen 7 Uhr das Haus und trete eine halbe Stunde Fußweg zum
Backnanger Bahnhof an. Man merkt, dass Wanderer mit soviel Gepäck nicht zum
Alltag der Backnanger gehören. Neugierige Blicke verfolgen jeden meiner
Schritte. Als ich mit 5 Minuten Verspätung Stuttgart erreiche, wächst die
Aufregung. Wie wird er wohl sein, der Steffen aus dem Internet, mit dem ich mich
für diese Tour verabredet habe? Werden wir uns gleich finden? Ist er da? Jedoch
alle Sorgen sind umsonst. Das helle Orange von Steffens Rucksack leuchtet
unübersehbar aus dem Menschengetümmel hervor.
Ein
kurzes „guten Morgen“, und schon geht es auf die spannende Suche nach einem
Lebensmittelladen. In jedem anderen Ort hätte man gefragt, wo das Problem
liegt. Nicht aber in Stuttgarts Innenstadt. Ein Sportgeschäft nach dem anderen
reiht sich in der Königsstraße aneinander. Nur ein Lebensmittelgeschäft
fehlt. Galeria Kaufhof hat noch zu, und so machen wir uns auf den Weg in
Richtung Charlottenplatz, wo ich einen Schlecker kenne. Auf dem Weg dorthin
unterhalten wir uns kurz und tauschen Informationen aus, als uns plötzlich das
gelbe Schild eines Edeka Neukauf Supermarktes auf der anderen Straßenseite
auffällt. Und der absolute Wahnsinn, er hat auf! Also nichts wie rein und
geschwind vier Liter Apfelschorle, ein halbes Mehrkornbrot,eine1 Dose
Erbsen-Möhren, Schwarztee, Marmelade, vier Äpfel, Tütensuppe, Naturreis und
Nudeln eingekauft. Sportgeschäft nach dem anderen
reiht sich in der Königsstraße aneinander. Nur ein Lebensmittelgeschäft
fehlt. Galeria Kaufhof hat noch zu, und so machen wir uns auf den Weg in
Richtung Charlottenplatz, wo ich einen Schlecker kenne. Auf dem Weg dorthin
unterhalten wir uns kurz und tauschen Informationen aus, als uns plötzlich das
gelbe Schild eines Edeka Neukauf Supermarktes auf der anderen Straßenseite
auffällt. Und der absolute Wahnsinn, er hat auf! Also nichts wie rein und
geschwind vier Liter Apfelschorle, ein halbes Mehrkornbrot,eine1 Dose
Erbsen-Möhren, Schwarztee, Marmelade, vier Äpfel, Tütensuppe, Naturreis und
Nudeln eingekauft.
Später,
im Zug, bemerkt Steffen plötzlich einen Fleck an seinem Rucksack. Schnell wird
klar, dass die Thermoskanne dem Druck der Apfelschorle nicht stand hält. So
trinken wir etwas von der Schorle ab, um so ein weiteres Auslaufen zu
verhindern. In Ulm dann angekommen, möchte ich am Automaten das Bayernticket
kaufen, um so weiter fahren zu können. Doch was bietet mir der blöde Automat
an? Baden-Württemberg-Ticket oder Wochenendticket. Da steht man nur wenige
Meter von der bayrischen Grenze an einem Automaten und möchte einen Fahrschein
kaufen, und dies ist nicht möglich. Also kaufen wir am Schalter das Ticket, was
uns letztendlich zwei Euro mehr kostet.
Über
Augsburg geht es nun weiter nach München. Unterwegs fahren wir an einem
interessanten und auch lustigen Bahnsteig vorbei. Dieser wird gerade von zwei
Männern mit Rasenmähern gemäht. Sachen gibt’s! In München hat sich der
blaue Himmel, der uns die ganze Zeit über begleitete, hinter großen, dicken
Schauerwolken versteckt. Komischerweise regnet es jedoch noch nicht. Die Luft
scheint noch zu trocken zu sein. Nach einer fünfundvierzigminütiger Fahrt mit
der BOB erreichen wir schließlich gegen 17 Uhr Lenggries. Dort fällt mir ein,
dass wir vergessen haben, Gewürze einzukaufen. In einem gegenüberliegenden
Schlecker werden wir jedoch nicht fündig. Aber wenige Meter hinter der
Isarbrücke treffen wir auf einen Edeka, wo wir uns noch Salz und Pfeffer holen.
Nun kann es endlich losgehen!
 Könnte
es zumindest, wenn da ein Weg wäre. Da ist jedoch keiner. Verdutzt vergleichen
wir die große Wanderkarte der Brauneckbahn-Talstation mit meiner mitgebrachten
Karte. Bei beiden sind Wege hoch zum Brauneck eingezeichnet. Jedoch können wir
ihn nicht finden. Irgendwann reicht es uns, und wir nehmen den zweiten,
wenigstens ausgeschilderten und vorhandenen Weg hoch zum Brauneck. Leider
entspricht dieser überhaupt nicht unserem Geschmack. Steil geht es eine Art
Skipiste den Berg hoch. Immer weiter auf dem breiten und geschotterten Weg, bis
wir plötzlich an einem Häuschen auf einen schmalen Pfad treffen, der links
abgeht. Auch hier keine Markierung. Trotzdem entscheiden wir uns für den Pfad,
was sich auch als richtig herausstellt. Denn in kleinen Serpentinen windet er
sich den Berg hoch, bis wir weiter oben bei einem Skilift wieder auf das
Schottersträßchen treffen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als
wieder diesem zu folgen. Könnte
es zumindest, wenn da ein Weg wäre. Da ist jedoch keiner. Verdutzt vergleichen
wir die große Wanderkarte der Brauneckbahn-Talstation mit meiner mitgebrachten
Karte. Bei beiden sind Wege hoch zum Brauneck eingezeichnet. Jedoch können wir
ihn nicht finden. Irgendwann reicht es uns, und wir nehmen den zweiten,
wenigstens ausgeschilderten und vorhandenen Weg hoch zum Brauneck. Leider
entspricht dieser überhaupt nicht unserem Geschmack. Steil geht es eine Art
Skipiste den Berg hoch. Immer weiter auf dem breiten und geschotterten Weg, bis
wir plötzlich an einem Häuschen auf einen schmalen Pfad treffen, der links
abgeht. Auch hier keine Markierung. Trotzdem entscheiden wir uns für den Pfad,
was sich auch als richtig herausstellt. Denn in kleinen Serpentinen windet er
sich den Berg hoch, bis wir weiter oben bei einem Skilift wieder auf das
Schottersträßchen treffen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als
wieder diesem zu folgen.
Nach
etwa 500 Metern entdecke ich plötzlich zwei schwarze Punkte auf einer
nahegelegnen Almwiese. Bei näherem Betrachten stellen sich diese als Gämsen
dar. Steffen entdeckt kurz darauf eine dritte Gämse oberhalb der Baumgrenze.
Der Verkehr der Brauneckbahn wurde mittlerweile eingestellt, und es herrscht
absolute Ruhe. Nur noch das Knirschen von Sand unter unseren Schuhen ist
vernehmbar. Als es immer kälter wird, es zu tröpfeln anfängt und außerdem
klar wird, dass wir den Gipfel wohl nicht mehr erreichen werden, schlagen wir
etwas abseits des Sträßchens mein Zelt auf einem Hügel auf. Gut getarnt vor
Blicken anderer. Wir haben gerade den Sturmkocher angeschmissen, als ein
erneuter kurzer Schauer mit Schnee durchmischt herunterkommt. Es wird
bitterkalt, und wir wollen nur noch eins: rein in die Schlafsäcke. Zuvor essen
wir jedoch die Nudeln mit der von Steffen zu Hause zubereiteten Soße. Noch kurz
abgespült, Zähne geputzt und rein in den warmen Schlafsack. herunterkommt. Es wird
bitterkalt, und wir wollen nur noch eins: rein in die Schlafsäcke. Zuvor essen
wir jedoch die Nudeln mit der von Steffen zu Hause zubereiteten Soße. Noch kurz
abgespült, Zähne geputzt und rein in den warmen Schlafsack.
2.
Tag
Gegen
5.45 Uhr weckt uns das Piepsen meiner Armbanduhr. Es ist eisig kalt draußen,
und am liebsten möchten wir gar nicht aufstehen. Doch die unmittelbare Nähe
zur Brauneckbahn zwingt uns zum Aufbrechen. So haben wir eine Stunde später
wieder alles zusammen gepackt und machen uns auf den Weg hoch zum Gipfel. Wenige
Meter hinter unserem Schlafplatz verlassen wir endlich den Schotterweg und
betreten einen schmalen Pfad, der uns unterhalb der Brauneckbahn nach oben
bringt.
 Gegen
7.30 Uhr erreichen wir bei Sonnenschein den Gipfel. Ein breiter Schotterweg
führt nun auf gleich bleibender Höhe in Richtung Westen. Etwa 300 m vom
Brauneckhaus machen wir bei einer Bank Rast und genießen bei herrlichem Wetter
und einem tollen Panorama das Frühstück. Ich habe gerade den Kocher wieder
weggepackt, als wir von unten Motorengeräusche vernehmen. Was könnte das sein?
Ein Lkw kommt langsam den Berg hoch gekrochen, um wenige Minuten später an
unserem Platz vorbei zufahren. Daraufhin beschließen wir weiter zu gehen. Nach
500 m verlassen wir das Schottersträßchen nach rechts, um weiter oben nach
links in einen schmalen Pfad einzubiegen. Es geht nun stets am Gegen
7.30 Uhr erreichen wir bei Sonnenschein den Gipfel. Ein breiter Schotterweg
führt nun auf gleich bleibender Höhe in Richtung Westen. Etwa 300 m vom
Brauneckhaus machen wir bei einer Bank Rast und genießen bei herrlichem Wetter
und einem tollen Panorama das Frühstück. Ich habe gerade den Kocher wieder
weggepackt, als wir von unten Motorengeräusche vernehmen. Was könnte das sein?
Ein Lkw kommt langsam den Berg hoch gekrochen, um wenige Minuten später an
unserem Platz vorbei zufahren. Daraufhin beschließen wir weiter zu gehen. Nach
500 m verlassen wir das Schottersträßchen nach rechts, um weiter oben nach
links in einen schmalen Pfad einzubiegen. Es geht nun stets am Hang an
wunderschönen Bergblumen vorbei. Immer wieder sind Enziane und Trollblumen der
Bestandteil der Wiesen links und rechts. Nachdem der Pfad einen kleinen Wald
durchquert hat, geht es nun im Schatten einer Felswand steil nach unten. Die
Wegbeschaffenheit wird immer schlechter, und am Schluss hat man das Gefühl,
sich auf einem von Gämsen getrampelten Pfad zu bewegen. Hang an
wunderschönen Bergblumen vorbei. Immer wieder sind Enziane und Trollblumen der
Bestandteil der Wiesen links und rechts. Nachdem der Pfad einen kleinen Wald
durchquert hat, geht es nun im Schatten einer Felswand steil nach unten. Die
Wegbeschaffenheit wird immer schlechter, und am Schluss hat man das Gefühl,
sich auf einem von Gämsen getrampelten Pfad zu bewegen.
Immer
wieder kommen wir an Skiliften vorbei, bis wir schließlich die Stiealm
erreichen. Ein Bauer, der gerade das Tagesangebot an eine Tafel schreibt,
grüßt uns freundlich und fragt uns nach unserem Ziel. Hinter der Stiealm geht
es erst mal wieder einen breiten Schotterweg nach oben. Dieser endet jedoch bei
der Bergstation eines kleinen Skiliftes. Von nun an geht es nur noch auf einem
kleinen felsigen Pfad unterhalb des Latschenkopfes entlang. Durch das Wegtauen
der Schneereste wird vor allem dieser Teil des Weges zu einer Schlammschlacht.
So sehen wir auch eine halbe Stunde später dementsprechend aus, als wir den
Grat der Achselköpfe erreichen. Bis zu den Knien hoch sind wir voll gespritzt.
Erst
hier bemerken wir, dass wir irgendwo den ursprünglichen Weg verpasst haben,
denn von rechts kommt der eigentliche Weg vom Latschenkopf runter. Anstatt über
den Latschenkopf zu gehen, sind wir unterhalb an ihm vorbeigegangen. (Dass die
Wegführung auf der gesamten Strecke als eher miserabel einzustufen ist, stellte
sich erst am Ende der Tour heraus.) Wir haben nun die Qual der Wahl. Entweder
wieder steil ins Tal und auf der anderen Seite wieder hoch oder aber über den
Grat der Achselköpfe rüber zur Benediktenwand. Ein Schild weist jedoch darauf
hin, dass die zweite Variante nur für Geübte geeignet ist.
 Trotzdem
entschließen wir uns für den schöneren Weg über den Grat. Anfangs noch bis
zu drei Meter breit, wird der Grat immer schmäler. Gelegentlich gibt es direkt
links und rechts des Weges senkrechte Felsabbrüche. Immer wieder müssen
Passagen des Weges erklettert Trotzdem
entschließen wir uns für den schöneren Weg über den Grat. Anfangs noch bis
zu drei Meter breit, wird der Grat immer schmäler. Gelegentlich gibt es direkt
links und rechts des Weges senkrechte Felsabbrüche. Immer wieder müssen
Passagen des Weges erklettert werden. Und immer wieder geht es hoch und runter.
Stahlseile und einmal eine Leiter erleichtern das Fortkommen. Zwischendurch sind
auch einige Altschneefelder zu durchqueren. Gegen 12 Uhr haben wir den Grat
hinter uns und sind froh diesen Weg gegangen zu sein und nicht den anderen. werden. Und immer wieder geht es hoch und runter.
Stahlseile und einmal eine Leiter erleichtern das Fortkommen. Zwischendurch sind
auch einige Altschneefelder zu durchqueren. Gegen 12 Uhr haben wir den Grat
hinter uns und sind froh diesen Weg gegangen zu sein und nicht den anderen.
Nur
wenige Minuten später geht es links den Ostaufstieg zur Benediktenwand hoch.
Der Anfang dieses Weges hat es in sich. Steil im Felsen geht es mit Hilfe von
Stahlseilen den Berg hoch. Höchste Aufmerksamkeit ist hier lebensnotwendig. Ein
falscher Schritt und man stürzt ab. Doch auch diesen Teil des Weges schaffen
wir letztendlich ohne Probleme und stehen schließlich am östlichen Teil der
Benediktenwamd in riesigen Altschneefeldern. Hier machen wir erstmal wieder eine
Pause und erholen uns von dem Aufstieg. Gerade als wir wieder aufbrechen, kommt
eine kleine Gruppe ältere Leute hinter uns den Berg hoch. Vor diesen laufen wir
nun auf einer Art Hochebene in Richtung Gipfel. Bald ist sich auch schon das
Gipfelkreuz zu erkennen, das wir um 13 Uhr erreichen. Einer der Männer hinter
uns bietet uns schließlich an ein Gipfelfoto von uns aufzunehmen, was wir
dankend annehmen. Ingesamt ist sehr wenig auf dem Gipfel los, was natürlich
auch an dem Werktag liegen kann.
 Beim
Abstieg auf der Westseite der Benediktenwand wird uns klar, dass unsere
Wasservorräte nicht mehr reichen werden. Aus diesem Grund beschließen wir
einen kleinen Umweg zur Tutzinger Hütte einzulegen. Der Beim
Abstieg auf der Westseite der Benediktenwand wird uns klar, dass unsere
Wasservorräte nicht mehr reichen werden. Aus diesem Grund beschließen wir
einen kleinen Umweg zur Tutzinger Hütte einzulegen. Der Abstieg auf der
Westseite ist im Gegensatz zu Ostseite ein gemütlicher Weg, und so erreichen wir
etwas später den Abzweig zur Tutzinger
Hütte. Links geht es weiter zum Walchensee, rechts zur Tutzinger Hütte. Nach
einem Blick auf die Karte wird uns klar, dass wir bis hier wieder zurück
wandern müssen. Der Pfad zwischen Latschenkiefern führt gleichmäßig an der
Nordseite der Wand nach unten. Kurz vor der Hütte jedoch müssen wir über ca.
200 Höhenmeter in Serpentinen ein Geröllfeld durchqueren. Dementsprechend
schmerzen danach auch die Füße. Abstieg auf der
Westseite ist im Gegensatz zu Ostseite ein gemütlicher Weg, und so erreichen wir
etwas später den Abzweig zur Tutzinger
Hütte. Links geht es weiter zum Walchensee, rechts zur Tutzinger Hütte. Nach
einem Blick auf die Karte wird uns klar, dass wir bis hier wieder zurück
wandern müssen. Der Pfad zwischen Latschenkiefern führt gleichmäßig an der
Nordseite der Wand nach unten. Kurz vor der Hütte jedoch müssen wir über ca.
200 Höhenmeter in Serpentinen ein Geröllfeld durchqueren. Dementsprechend
schmerzen danach auch die Füße.
Unten
bitte ich den Hüttenwirt, unsere Flaschen wieder aufzufüllen. Drei Liter
Quellwasser bekommen wir umsonst, die drei Liter Apfelschorle dagegen
entsprechen mit ihren 16 Euro Hüttenpreisen. Kurzerhand entschließen wir uns,
auf der Hütte zu bleiben und noch eine Portion Kaiserschmarrn mit Apfelmus zu
essen. Gut gestärkt machen wir uns eine Stunde später wieder auf den Weg.
Zuerst müssen wir jedoch das blöde Geröllfeld durchqueren. Endlich erreichen
wir wieder die Abzweigung zum Walchensee, und die Tour kann weiter gehen. Es
geht nun steil in Serpentinen den Berg runter. Unten angekommen kann man bei
einem Blick nach oben gar nicht glauben, dass es an einem solchen Steilhang
überhaupt einen Weg gibt. Wir befinden uns nun in einem dichten Buchenwald auf
einer Art Passhöhe. Links geht es den Berg runter, rechts geht es den Berg
runter. Nach links ist Jachenau ausgeschildert und darüber ein abgefallenes
Schild mit dem Namen Kochel am See.
Genau
damit fängt das ganze Unheil an. Jachenau und Kochel am See liegen nämlich in
entgegen gesetzter Richtung. Da bei dem Weg nach rechts das Schild fehlt, aber
erkennbar ist, dass sich dort mal ein Schild befand, gehe ich davon aus, dass
jemand das Schild Kochel am See auf der falschen Seite abgelegt hat. So gehen
wir statt links nach rechts den Berg runter. Die ganze Zeit über leitet uns
eine rote Wegmarkierung. Nach 20 Minuten endet der Fußpfad in einem breiten
Forstweg, dem wir nach links folgen. Nach 500m auf diesem Weg werde ich erstmals
stutzig. Im Hintergrund ist die gesamte Breite der Benediktenwand erkennbar. Die
dürften wir jedoch gar nicht mehr sehen, wenn wir nach Westen gingen. Also
Kompass ausgepackt und kontrolliert. Zum Glück! Denn statt nach Westen bewegen
wir uns direkt nach Norden. Auf der Karte versuchen wir nun zu erkennen, wo wir
uns eigentlich befinden. Nachdem wir in etwa unseren Standpunkt ermittelt haben,
überlegen wir, was wir nun machen sollen. Uns auf einem anderen Weg wieder nach
Süden durchschlagen oder den ganzen Weg wieder zurückwanden? Wir entscheiden
uns für die zweite, sicherste Variante – zurück auf die bewaldete Passhöhe.
Dort angekommen, suchen wir erstmal nach einem Weg, der nach Westen führt. Da
ist jedoch nichts. Nur die Route links runter nach Jachenau. Jachenau liegt
jedoch auch nicht auf unserem Weg. Ratlosigkeit. Richtung. Da bei dem Weg nach rechts das Schild fehlt, aber
erkennbar ist, dass sich dort mal ein Schild befand, gehe ich davon aus, dass
jemand das Schild Kochel am See auf der falschen Seite abgelegt hat. So gehen
wir statt links nach rechts den Berg runter. Die ganze Zeit über leitet uns
eine rote Wegmarkierung. Nach 20 Minuten endet der Fußpfad in einem breiten
Forstweg, dem wir nach links folgen. Nach 500m auf diesem Weg werde ich erstmals
stutzig. Im Hintergrund ist die gesamte Breite der Benediktenwand erkennbar. Die
dürften wir jedoch gar nicht mehr sehen, wenn wir nach Westen gingen. Also
Kompass ausgepackt und kontrolliert. Zum Glück! Denn statt nach Westen bewegen
wir uns direkt nach Norden. Auf der Karte versuchen wir nun zu erkennen, wo wir
uns eigentlich befinden. Nachdem wir in etwa unseren Standpunkt ermittelt haben,
überlegen wir, was wir nun machen sollen. Uns auf einem anderen Weg wieder nach
Süden durchschlagen oder den ganzen Weg wieder zurückwanden? Wir entscheiden
uns für die zweite, sicherste Variante – zurück auf die bewaldete Passhöhe.
Dort angekommen, suchen wir erstmal nach einem Weg, der nach Westen führt. Da
ist jedoch nichts. Nur die Route links runter nach Jachenau. Jachenau liegt
jedoch auch nicht auf unserem Weg. Ratlosigkeit.
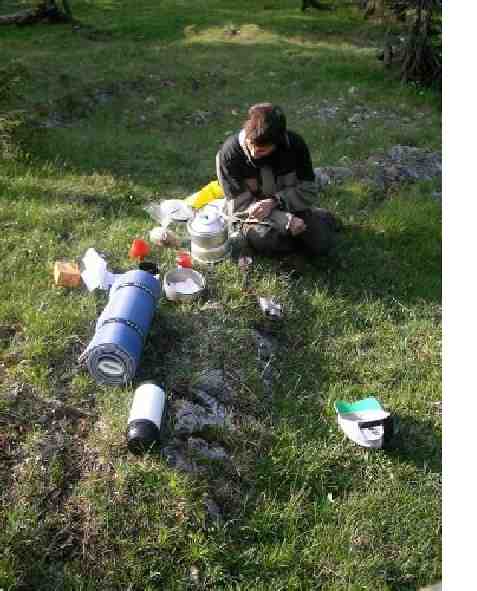 Schließlich
beschließen wir dem Wegweiser Richtung Jachenau zu folgen. Was anderes bleibt
uns ja auch nicht übrig. Als wir ca. 100 Höhenmeter abgestiegen sind, treffen
wir plötzlich auf eine neue Kreuzung. Hier ist nun auch endlich wieder der
Walchensee ausgeschildert, und die Richtung stimmt. Immer noch in einem dichten
Buchenwald geht es nun immer auf einer Höhe am Südhang der Glaswand entlang,
bis wir auf eine kleine Almwiese stoßen. Rechts wächst nun lichter
Fichtenwald. Der Boden voll mit Gräsern. Ein idealer Zeltplatz, finden wir.
Doch leider finden das auch die Ameisen. Hinter Schließlich
beschließen wir dem Wegweiser Richtung Jachenau zu folgen. Was anderes bleibt
uns ja auch nicht übrig. Als wir ca. 100 Höhenmeter abgestiegen sind, treffen
wir plötzlich auf eine neue Kreuzung. Hier ist nun auch endlich wieder der
Walchensee ausgeschildert, und die Richtung stimmt. Immer noch in einem dichten
Buchenwald geht es nun immer auf einer Höhe am Südhang der Glaswand entlang,
bis wir auf eine kleine Almwiese stoßen. Rechts wächst nun lichter
Fichtenwald. Der Boden voll mit Gräsern. Ein idealer Zeltplatz, finden wir.
Doch leider finden das auch die Ameisen. Hinter jedem Baum ein Ameisenhügel.
Schließlich finden wir etwas abseits des Weges oben am Hang ein flaches Stück
ohne Ameisen. Hier bauen wir unser Zelt auf und kochen ganz in der Nähe unseren
Reis. Leider lässt sich bei meinem Kocher die Flamme nur sehr schwer bis gar
nicht regulieren, sodass unser Reis nicht köchelt, sondern kocht. Dies machte
sich dann auf die Festigkeit des Reises bemerkbar. Aber auch dieses Essen
schmeckt ganz gut. Kaum ist die Sonne untergegangen, wird es wieder eiskalt. So
verschwinden wir erneut sehr früh in unseren Schlafsäcken. jedem Baum ein Ameisenhügel.
Schließlich finden wir etwas abseits des Weges oben am Hang ein flaches Stück
ohne Ameisen. Hier bauen wir unser Zelt auf und kochen ganz in der Nähe unseren
Reis. Leider lässt sich bei meinem Kocher die Flamme nur sehr schwer bis gar
nicht regulieren, sodass unser Reis nicht köchelt, sondern kocht. Dies machte
sich dann auf die Festigkeit des Reises bemerkbar. Aber auch dieses Essen
schmeckt ganz gut. Kaum ist die Sonne untergegangen, wird es wieder eiskalt. So
verschwinden wir erneut sehr früh in unseren Schlafsäcken.
3.Tag
Um
5.45 Uhr piepst wieder die Uhr. Doch es ist so kalt, das keiner aufstehen will.
So stelle ich den Wecker auf 6.00 Uhr. Immer noch kalt. 6.30 Uhr. Nee, lieber
liegen bleiben. Um 6.45 Uhr schließlich, also genau eine Stunde später als
geplant, überreden wir schließlich unsere Füße aus dem Sack zu kriechen und
abzubauen. Draußen nun herrlichster Sonnenschein. Kaum Wolken am Himmel. Was
mich jedoch stört, ist das fast trockene Außenzelt. Kein Kondenswasser! Aber
erstmal genießen wir wieder bei Sonnenschein unser Frühstück. Es ist einfach
herrlich in der warmen Sonne in einer blühenden Almwiese zu sitzen und das
Alpenpanorama zu genießen.
Auf
einem tollen Pfad geht es danach am Fuß der Glaswand und danach an der
Südseite des Rabenkopfs entlang. Hier kreuzen immer wieder Wasserfälle den
Weg. Und zum ersten Mal auf der Tour knallt die Sonne dermaßen runter, das wir
unsere Jacken ausziehen müssen. Mittlerweile machen wir uns schon wieder Sorgen
um Trinkwasser. Aus diesem Grund sind wir auch sehr erfreut, als wir auf der
Staffelalm einen Wasserhahn entdecken. Rucksack runter, Flaschen raus und
abfüllen. Doch Steffen hat gerade die erste Flasche halbvoll, da sind wir
aufgrund der Färbung des vermeintlichen Trinkwassers mehr als skeptisch.
Milchigweiß ist die erste Flasche gefüllt. Kann natürlich auch Kalk sein,
aber lieber kein Risiko eingehen und wieder wegkippen. entdecken. Rucksack runter, Flaschen raus und
abfüllen. Doch Steffen hat gerade die erste Flasche halbvoll, da sind wir
aufgrund der Färbung des vermeintlichen Trinkwassers mehr als skeptisch.
Milchigweiß ist die erste Flasche gefüllt. Kann natürlich auch Kalk sein,
aber lieber kein Risiko eingehen und wieder wegkippen.
Doch
schon das nächste Problem. Wo ist schon wieder der Weg? Ein ganzer
Schilderwald, doch in die gezeigte Richtung kein Weg erkennbar. Zum Glück kommt
in diesem Moment der Wirt der Hütte angelaufen und hilft uns weiter. Der Weg
fängt ganz wo anders weiter unten an. Das Schild zeigt mal wieder in die
falsche Richtung. Auf die Frage wegen Trinkwasser meint der Wirt nur lachend:
„Die oinen vertragen’s, die andern net“. Also lassen wir das erstmal
bleiben und machen uns auf den Weg zur Kochleralm. In Serpentinen führt ein
schmaler Pfad in ein schönes Tal, bis wir schließlich auf der Kochleralm
stehen. Von dort geht es nun im Tal ein Schottersträßchen weiter. Nach ca.
einem Kilometer kommen wir an einem Holzbrunnen vorbei, der mit Hilfe einer
Rohrleitung gespeist wird. Hier füllen wir nun unsere Flaschen ab.
 Weiter
folgen wir nun der Straße abwärts, bis links ein Pfad zum Jochberg abgeht.
Nach einigen Kilometern in dichtem Laubwald erreichen wir ein Stück gerodeten
Nadelwald. Hier machen wir erstmal Pause und trinken die Reste unserer
Apfelschorle. Weiter geht es nun über eine große Almwiese zur Abzweigung auf
den Jochberg. Mal wieder in Serpentinen geht es einen schmalen Pfad den Berg
hoch. Durst macht sich bei mir wieder breit. Bei Steffen offensichtlich auch,
denn er freut sich genauso wie ich, als wir in der Nähe der Jocheralm auf das
Schild „Zur Quelle“ stoßen. Doch irgendwie scheint es sich hier um einen
blöden Scherz zu handeln, denn außer an Weiter
folgen wir nun der Straße abwärts, bis links ein Pfad zum Jochberg abgeht.
Nach einigen Kilometern in dichtem Laubwald erreichen wir ein Stück gerodeten
Nadelwald. Hier machen wir erstmal Pause und trinken die Reste unserer
Apfelschorle. Weiter geht es nun über eine große Almwiese zur Abzweigung auf
den Jochberg. Mal wieder in Serpentinen geht es einen schmalen Pfad den Berg
hoch. Durst macht sich bei mir wieder breit. Bei Steffen offensichtlich auch,
denn er freut sich genauso wie ich, als wir in der Nähe der Jocheralm auf das
Schild „Zur Quelle“ stoßen. Doch irgendwie scheint es sich hier um einen
blöden Scherz zu handeln, denn außer an einer Viehtränke gibt es nichts
Quellähnliches. So erreichen wir schließlich ein wenig enttäuscht die
Jocheralm. Hier ist der Teufel los. Überall Wanderer und Spaziergänger. Mit
einem Blick auf den Gipfel beschließe ich kurzerhand den Abstieg nach Urfeld.
Denn da oben tummelt sich halb Walchensee. einer Viehtränke gibt es nichts
Quellähnliches. So erreichen wir schließlich ein wenig enttäuscht die
Jocheralm. Hier ist der Teufel los. Überall Wanderer und Spaziergänger. Mit
einem Blick auf den Gipfel beschließe ich kurzerhand den Abstieg nach Urfeld.
Denn da oben tummelt sich halb Walchensee.
Zuvor
legen wir jedoch noch eine größere Pause etwas abseits des ganzen Trubels ein.
Schuhe und Socken werden ausgezogen, und wir genießen die Sonne. Es zieht
allerdings von Westen her immer mehr zu. Außerdem fällt der Luftdruck von
Anfangs 1030hPa auf ca. 1010hPa . Weiter geht es erst noch sanft einen etwas
felsigen und mit Wurzeln duchwachsenen Pfad den Berg runter. Nachdem ein
weiterer Pfad vom Jochberg eingemündet ist, führt der Weg steil und in vielen
Kehren den Berg runter. Unterwegs treffen wir auf eine Quelle, an der wir eine
letzte Flasche auffüllen.
Auf
diesem Abschnitt kommen uns Hunderte von Leuten entgegen. Mit Kindern, ohne
Kinder, ältere Leute, junge Leute. Nach zwei Tagen Ruhe ein richtiger Schock
;-) Unterwegs treffen wir einen weiteren Wanderer mit einem noch größeren
Rucksack. Außerdem erkundigt sich ein Familienvater nach unserer Tour. Als er
wissen möchte, wo wir übernachtet haben, gebe ich ausweichend nur die Info,
dass wir draußen geschlafen haben. Man weiß ja nie, wie manche auf Wildcampen
reagieren. Als von unten die Passtrasse zu hören ist, wissen wir, dass wir es
bald geschafft haben. Gegen 15 Uhr erreichen wir die Straße und laufen die drei
bis vier Kehren nach Urfeld hinunter. Dort kaufen wir in einem uralten
Tante-Emma-Laden mal wieder drei Liter Apfelschorle. Diesmal jedoch wieder für
einen angenehmeren Preis.
An
einer Bushaltestelle schauen wir schon einmal nach der besten Verbindung nach
Kochel. Am Ufer gehen wir danach das kleine Sträßchen nach Jachenau entlang,
um uns einige Meter später auf einer Bank auszuruhen. Steffen zieht seine
Schuhe aus, um seine Füsse in den Walchensee zu halten, was ich ihm einige
Minuten später nachmache. Das Wasser ist eiskalt, und ich brauche etwas Zeit,
bis wirklich der ganze Fuß im Wasser ist. Anschließend stellt sich jedoch ein
angenehm warmes Gefühl um den Fuß ein. Ein vorbeikommender Hundebesitzer
erkundigt sich ganz genau nach unserem Vorhaben. Will alles ganz genau wissen.
„Und übernachten tut ihr dann im Wald. Stimmt’s?“ Ertappt! Steffen zieht seine
Schuhe aus, um seine Füsse in den Walchensee zu halten, was ich ihm einige
Minuten später nachmache. Das Wasser ist eiskalt, und ich brauche etwas Zeit,
bis wirklich der ganze Fuß im Wasser ist. Anschließend stellt sich jedoch ein
angenehm warmes Gefühl um den Fuß ein. Ein vorbeikommender Hundebesitzer
erkundigt sich ganz genau nach unserem Vorhaben. Will alles ganz genau wissen.
„Und übernachten tut ihr dann im Wald. Stimmt’s?“ Ertappt!
Wenig
später machen auch wir uns wieder auf den Weg. Immer die Straße entlang. Hier
vermute ich die einzige Chance auf einen ebenen Zeltplatz. In der Nähe eines
kleinen Sandstrandes verlassen wir dann auch die Straße, um weiter oben im Wald
nach einem Zeltplatz zu suchen. Aber ausgerechnet da steht plötzlich ein Mann
im Wald rum. Was der da wohl macht? Auf jeden Fall beobachtet er ganz genau
unser Vorgehen. Ich reagiere dementsprechend, ziehe meine Landkarte hervor und
tue so, als ob ich einen Weg suchen würde.
So
verlassen wir wieder den Wald und folgen noch einige Meter der Straße, bevor
wir einen neuen Versuch starten. Und tatsächlich, wir finden oberhalb der
Straße ein einigermaßen ebenes Stück Erde. Da es noch zu früh ist und wir
uns noch immer in der Nähe des unbekannten Mannes befinden, steigen wir weiter
den Berg auf, immer auf der Suche nach Alternativplätzen. Doch schnell wird
klar, dass hier oben nichts zu finden ist. Deswegen bauen wir dort oben meinen
Kocher auf und machen Tomatensuppe mit Reis. Während
dieser Zeit hat es sich immer mehr zugezogen, und Wind kommt auf. Man merkt nun
deutlich, dass das Wetter nicht mehr hält. Plötzlich wird es auch wieder kalt.
Gegen 19.30 Uhr steigen wir wieder ab und bauen vorsichtig auf dem vorher
gewählten Platz das Zelt auf. In der Nacht wache ich dann von einsetzendem
Regen auf. Das Blätterdach über uns schützt uns jedoch noch ein wenig.
4.Tag
Um
5.45 Uhr piepst wieder meine Uhr. Es regnet leicht, und es ist kalt. Doch es
hilft alles nichts. Um 8.49 Uhr fährt unser Bus ab. Also bauen wir noch im
Schutz des Außenzeltes das Innenzelt ab und nutzen eine kleine Regenpause, um
auch den Rest abzubauen. Als wir aus dem Wald treten, hängt alles in dicken
Wolken. Aber es regnet gerade nicht. Also machen wir uns auf den Weg nach Urfeld
zur Bushaltestelle. Ich meine dort eine überdachte Bushaltstelle gesehen zu
haben. Als wir ankommen, zeigt sich jedoch, dass es eine Haltestelle ohne Dach
ist. Also bauen wir den Kocher unter einer großen Kastanie am Ufer des
Walchensees auf.
 Als
der Bus der OVB anrollt, frage ich den Fahrer, ob man bereits hier das
Wochenendticket der Bahn kaufen kann. Dieser sagt mir jedoch, dass er mir nur
das Bayernticket verkaufen kann. Das bringt mir jedoch nichts, da wir ja auch in
Baden-Württemberg fahren werden. Ich möchte deshalb daraufhin zwei normale
Tickets nach Kochel kaufen. Der Fahrer meint jedoch, dass wir uns hinsetzten
sollen, und nimmt uns daraufhin umsonst nach Kochel mit. Dort kaufe ich dann am
Automaten das Wochenendticket, und wir fahren mit einer Regionalbahn nach
Tutzing, wo wir auch sogleich Anschluss nach München haben. In München müssen
wir uns aber mit einer längeren Wartezeit abfinden. Doch auch dies ist recht
bald überstanden, und so sitzen wir anderthalb Stunden später im Zug nach Ulm
sowie noch etwas später in dem nach Stuttgart. Als
der Bus der OVB anrollt, frage ich den Fahrer, ob man bereits hier das
Wochenendticket der Bahn kaufen kann. Dieser sagt mir jedoch, dass er mir nur
das Bayernticket verkaufen kann. Das bringt mir jedoch nichts, da wir ja auch in
Baden-Württemberg fahren werden. Ich möchte deshalb daraufhin zwei normale
Tickets nach Kochel kaufen. Der Fahrer meint jedoch, dass wir uns hinsetzten
sollen, und nimmt uns daraufhin umsonst nach Kochel mit. Dort kaufe ich dann am
Automaten das Wochenendticket, und wir fahren mit einer Regionalbahn nach
Tutzing, wo wir auch sogleich Anschluss nach München haben. In München müssen
wir uns aber mit einer längeren Wartezeit abfinden. Doch auch dies ist recht
bald überstanden, und so sitzen wir anderthalb Stunden später im Zug nach Ulm
sowie noch etwas später in dem nach Stuttgart. Fazit:
Fazit:
Es war
eine sehr schöne Tour. Wir sind zwar nicht so weit gekommen wie geplant, aber
das ist ja auch egal. Es war sehr kalt, aber weitgehend trocken. Die
Beschilderung war allerdings wirklich miserabel. Entweder es fehlten ganze
Schilder, oder sie zeigten in die falsche Richtung, oder aber sie waren
unleserlich
Fotos:
Markus Mohr und Steffen
Harzwanderung
Mai 2006
Von
Gerhard Wandel
Die
Eindrücke zu Goethes Faust stammen aus dem Harz. Der Aufstieg vom Torfhaus auf
den Brocken ist Goethes Weg zum Brocken im Jahre 1777 nachempfunden. Aber auch
Heine und Fontane haben früher den Harz bereist und zu seiner Berühmtheit
beigetragen. Am 3. Oktober 2003 wurde der „Harzer Hexenstieg“ anlässlich
des Tages der Deutschen Einheit eröffnet und damit wieder eine
fernwandermäßige Verbindung vom Westen in die neuen Bundesländer geschaffen.
Auch wenn der Weg unspektakulär ist, wurde von den Wirten am Wege allgemein
bestätigt, dass mehr Wanderer dadurch in den Harz gekommen sind.
Auf
dem Europäischen Fernwanderweg E 11 von Seesen nach Goslar
 Lob
möchte ich zuerst dem Harzclub für die hervorragende Markierung des E 11 in
Seesen erteilen. Diese endet jedoch abrupt an der abgebrochenen Lob
möchte ich zuerst dem Harzclub für die hervorragende Markierung des E 11 in
Seesen erteilen. Diese endet jedoch abrupt an der abgebrochenen Brücke der Bismarckstraße über die Bahnlinie.
Ich folge der Straße bis zur nächsten Brücke über die Bahnlinie und laufe
parallel zurück. Von hier ist zu erkennen: Es gibt erstens über das Parkhaus
„Kaufland“ eine Fußgängerbrücke über die Bahnlinie und zweitens: Ich
darf wieder zurücklaufen; die Straße nach Lautenthal ist der richtige Weg.
Problemlos wandere ich über „Herzog-Wilhelm-Schneise“,
Kalte Birke, Vereinsplatz, Innerstetalsperre, Wolfshagen, Granetalsperre nach
Goslar. Die sehr gute Markierung endet am Ortseingang von Goslar. Auf dem
Stadtplan von Goslar ist die Wegeführung erkennbar, innerhalb Orts jedoch keine
Markierung. Wanderzeit ca. 6 Stunden. Goslar mit seinen vielen Fachwerkhäusern,
der Kaiserpfalz, dem Weltkulturerbe Bergwerk „Rammelsberg“ und vielen
Straßencafes lädt ein zum Verweilen. Übernachtung im heimeligen „Hotel zur
alten Münze“, Münzstraße 10, Telefon: 05321/22546, eMail:
Muenzhotel@t-online.de
Brücke der Bismarckstraße über die Bahnlinie.
Ich folge der Straße bis zur nächsten Brücke über die Bahnlinie und laufe
parallel zurück. Von hier ist zu erkennen: Es gibt erstens über das Parkhaus
„Kaufland“ eine Fußgängerbrücke über die Bahnlinie und zweitens: Ich
darf wieder zurücklaufen; die Straße nach Lautenthal ist der richtige Weg.
Problemlos wandere ich über „Herzog-Wilhelm-Schneise“,
Kalte Birke, Vereinsplatz, Innerstetalsperre, Wolfshagen, Granetalsperre nach
Goslar. Die sehr gute Markierung endet am Ortseingang von Goslar. Auf dem
Stadtplan von Goslar ist die Wegeführung erkennbar, innerhalb Orts jedoch keine
Markierung. Wanderzeit ca. 6 Stunden. Goslar mit seinen vielen Fachwerkhäusern,
der Kaiserpfalz, dem Weltkulturerbe Bergwerk „Rammelsberg“ und vielen
Straßencafes lädt ein zum Verweilen. Übernachtung im heimeligen „Hotel zur
alten Münze“, Münzstraße 10, Telefon: 05321/22546, eMail:
Muenzhotel@t-online.de
Europa aus den Augen verloren
 Mein
beabsichtigtes Ziel war, weiter über den E 6 zur Romkerhalle im Okertal zu
wandern und dann zum „Torfhaus“ hochzusteigen. Ich sehe am Ortsausgang von
Goslar Markierungen des Harzvereins und Tafeln auch mit der Mein
beabsichtigtes Ziel war, weiter über den E 6 zur Romkerhalle im Okertal zu
wandern und dann zum „Torfhaus“ hochzusteigen. Ich sehe am Ortsausgang von
Goslar Markierungen des Harzvereins und Tafeln auch mit der „Romkerhalle“ ausgeschildert, jedoch keinen
Hinweis auf einen E-Weg. Die Richtung stimmt auch nicht, sodass ich wieder kehrt
mache. Ich umrunde das Berufsbildungszentrum und stoße hier auf die Markierung E
6, E 11. Bei der ersten Wegegabelung finde ich keine Markierung. Ich nehme den
ersten Weg rechts den Berg hoch, sehe eine einzige (fremde) Markierung und kehre
wieder um. Ich versuche mich am zweiten Weg weiter links und frage
sicherheitshalber einen Spaziergänger nach dem E 6. E ??? Man sollte die
Bevölkerung mit Europa nicht überfordern!! Ich frage, ob der Weg ins Okertal
führt? Ja, dorthin könnte ich kommen. Ich folge einem waldreichen Flusstal
aufwärts, quere am Talschluss und finde eine Hinweistafel, auf der neben
Schulenberg auch die Romkerhalle auftaucht. Das dumme ist nur, dass in diesem
Bereich des Harzes die großen Wegkreuzungen mit Hinweistafeln vollgestellt sind,
aber unterwegs keine weitere Markierung erfolgt. Jedenfalls bei der nächsten
Hinweistafel ist keine Romkerhalle mehr verzeichnet. Als neues Ziel gebe ich
vor: Okertalsperre. Über das Mulltal und den wiedergefundenen E 6 gelange ich
zur Talsperre, wandere ein kleines Stück auf dem Uferweg, steige über das Lange
Tal hoch zum Waldjugendheim Ahrensberg, leichter Abstieg ins Kalbetal, dem ich
dann bis zum Torfhaus (rotes Kreuz) folge. Ab der Bundestrasse 4 betritt man den
Nationalpark Harz und hat vom Torfhaus einen schönen Blick auf den Brocken.
Wanderzeit ca. 7 ½ Stunden (abzu-ziehen ca. 1 Stunden für Herumirren und Pause).
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten hier derzeit leider bescheiden.
„Romkerhalle“ ausgeschildert, jedoch keinen
Hinweis auf einen E-Weg. Die Richtung stimmt auch nicht, sodass ich wieder kehrt
mache. Ich umrunde das Berufsbildungszentrum und stoße hier auf die Markierung E
6, E 11. Bei der ersten Wegegabelung finde ich keine Markierung. Ich nehme den
ersten Weg rechts den Berg hoch, sehe eine einzige (fremde) Markierung und kehre
wieder um. Ich versuche mich am zweiten Weg weiter links und frage
sicherheitshalber einen Spaziergänger nach dem E 6. E ??? Man sollte die
Bevölkerung mit Europa nicht überfordern!! Ich frage, ob der Weg ins Okertal
führt? Ja, dorthin könnte ich kommen. Ich folge einem waldreichen Flusstal
aufwärts, quere am Talschluss und finde eine Hinweistafel, auf der neben
Schulenberg auch die Romkerhalle auftaucht. Das dumme ist nur, dass in diesem
Bereich des Harzes die großen Wegkreuzungen mit Hinweistafeln vollgestellt sind,
aber unterwegs keine weitere Markierung erfolgt. Jedenfalls bei der nächsten
Hinweistafel ist keine Romkerhalle mehr verzeichnet. Als neues Ziel gebe ich
vor: Okertalsperre. Über das Mulltal und den wiedergefundenen E 6 gelange ich
zur Talsperre, wandere ein kleines Stück auf dem Uferweg, steige über das Lange
Tal hoch zum Waldjugendheim Ahrensberg, leichter Abstieg ins Kalbetal, dem ich
dann bis zum Torfhaus (rotes Kreuz) folge. Ab der Bundestrasse 4 betritt man den
Nationalpark Harz und hat vom Torfhaus einen schönen Blick auf den Brocken.
Wanderzeit ca. 7 ½ Stunden (abzu-ziehen ca. 1 Stunden für Herumirren und Pause).
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten hier derzeit leider bescheiden.
 Für
meinen Weiterweg wähle ich die Alternative durch das Bodetal über Susenburg,
Rübeland, Neuwerk, Talsperre Wendefurth. Der Weg ist hier teilweise identisch
mit dem „Fernwanderweg deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz“.
Zwischen Wendefurth und der Einmündung der Alternativstrecke bei Altenbrak ist
der Weg nicht als Hexenstieg markiert. Markierung ist hier Für
meinen Weiterweg wähle ich die Alternative durch das Bodetal über Susenburg,
Rübeland, Neuwerk, Talsperre Wendefurth. Der Weg ist hier teilweise identisch
mit dem „Fernwanderweg deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz“.
Zwischen Wendefurth und der Einmündung der Alternativstrecke bei Altenbrak ist
der Weg nicht als Hexenstieg markiert. Markierung ist hier Harz-Eichsfeld-Thüringen-Weg (blaues
Dreieck). In Altenbrak Übernachtung im Hotel „Weißes Roß“. Gesamtwanderzeit ca.
6 Stunden.
Harz-Eichsfeld-Thüringen-Weg (blaues
Dreieck). In Altenbrak Übernachtung im Hotel „Weißes Roß“. Gesamtwanderzeit ca.
6 Stunden.
 Von
Altenbrak führt die Wanderung weiter über Treseburg durchs Bodetal nach Thale.
Das Teilstück Treseburg-Thale, der sogenannte Bodekessel, im Reiseführer etwas
übertrieben mit dem „Grand Canyon von Deutschland“ beschrieben, ist von
Tagesausflüglern gut begangen. Ich steige nach der Teufelsbrücke (weißes Kreuz
auf schwarzem Grund, E 11) links hoch zum Roßtrappenfelsen und wandere dann im
Zick-Zack wieder hinunter ins Bodetal, wo ich Thale nach ca. 4 ½ Stunden
erreiche. Dort Übernachtung im vorzüglichen Hotel „Alte Backstube“,
Rudolf-Breitscheid-Str. 15, Telefon: 03947/772490, dem Ende meiner Wanderung. Von
Altenbrak führt die Wanderung weiter über Treseburg durchs Bodetal nach Thale.
Das Teilstück Treseburg-Thale, der sogenannte Bodekessel, im Reiseführer etwas
übertrieben mit dem „Grand Canyon von Deutschland“ beschrieben, ist von
Tagesausflüglern gut begangen. Ich steige nach der Teufelsbrücke (weißes Kreuz
auf schwarzem Grund, E 11) links hoch zum Roßtrappenfelsen und wandere dann im
Zick-Zack wieder hinunter ins Bodetal, wo ich Thale nach ca. 4 ½ Stunden
erreiche. Dort Übernachtung im vorzüglichen Hotel „Alte Backstube“,
Rudolf-Breitscheid-Str. 15, Telefon: 03947/772490, dem Ende meiner Wanderung.
Bis auf den letzten Tag, an dem es ein paar Schauer
gab, und einem kurzen Gewitter in Goslar, hatte ich nur strahlenden
Sonnenschein; die 300 Nebeltage am Brocken erscheinen mir etwas übertrieben!
Wanderführer:
Harzer-Hexen-Stieg,
Kartographische Kommunale Verlagsgesellschaft mbH, Am Alten Tor 7, 99734
Nordhausen, Tel.: 03631-902595, Internet: www.Harzwanderung.de
Den
Mitgliedern des Netzwerks Weitwandern e. V. wird gemäß eMail vom 29.3.2006 ein
Rabatt von 25 % auf den Verkaufspreis der Artikel eingeräumt.
Stein,
Conrad: Harz: Hexenstieg, Reihe: OUTDOOR - Der Weg ist das Ziel, Band
163, Conrad Stein Verlag, 2005, ISBN 3-89392-563-5, 124 Seiten, 9,90 €
Karten:
Harzer
Hexenstieg, 1:30.000, Schmidt-Buch-Verlag, Die Winde 45, 38855 Wernigerode,
Tel.: 03943-23246, Email: info@schmidt-buch-verlag.de,
Internet: www.schmidt-buch-verlag.de
„Wandern
im Westharz“, 1:50.000 Landesvermessung Niedersachsen
Fotos:
Gerhard Wandel
Erschienen
in
"Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 20 - August
2006
Der Hunsrück – Terra incognita
Auf dem Ausoniusweg und dem Moselhöhenweg von Bingen nach Trier
Von Werner Hohn
Beatus
ille, qui procul negotiis.
Schon lange hat es mir der Hunsrück angetan. Die
nicht besonders ausgeprägte touristische Infrastruktur, das Fehlen von bekannten
Wanderwegen (wenn der Moselhöhenweg außen vor bleiben darf), nicht zuletzt die
weite Hochfläche dieser Landschaft, geben - einmal wieder - den Ausschlag für
eine Mehrtagestour. Diese Ecke Deutschlands - durch Edgar Reitz’ Filmreihe
„Heimat“, vor etlichen Jahren kurzzeitig ins Bewusstsein einer breiteren
Öffentlichkeit geraten - befindet sich immer noch in einem wandertouristischen
Dornröschenschlaf.
Für eine Überquerung des Hunsrücks bietet sich der
Ausoniusweg geradezu an. In beinahe gerader Linie geht es vom Rhein an die
Mosel. Ein „Manko“ hat der Weg allerdings: schmale Pfade wird man vergebens
suchen. Im Gegenteil. Der Ausoniusweg hat das, was bei der Planung andere
Weitwanderwege tunlichst vermieden wird: eine an die 10 Kilometer lange Gerade!
Breite und gerade Wirtschaftswege sind die Regel. Wo es anders nicht möglich
ist, wird dieser Weitwanderweg gnadenlos über wenig befahrene Landstraßen
geführt. Für Erlebnisräume und Inszenierungen muss die Landschaft sorgen. Fürs
sinnliche Erleben ist man selber zuständig. Bauwerke oder Naturwunder die man
unbedingt gesehen haben muss, gibt es weit und breit auch nicht. Es sei denn,
man zählt die Täler von Rhein und Mosel und die älteste Stadt Deutschlands,
Trier, zum Hunsrück. Das Beste am Weg: Stunden- oder sogar tagelanges Wandern
durch monotone Fichtenwaldkulturen fällt aus! Der Weg bleibt überwiegend in der
freien Hunsrücklandschaft zwischen Idarkopf und Mosel und lässt so die großen
Hunsrückwälder, wie den Soonwald, südlich liegen. Für freie Sicht über die
hügelige Hochebene ist also zu Genüge gesorgt.
Es ist genau die Landschaft, die mir seit einiger
Zeit zusagt. Beste Voraussetzungen für eine geruhsame und einsame Wanderung.
Noch! Denn langsam kommt Bewegung in diese Wandergegend. Neben neuen Routen, wie
dem „Sponheimer Weg“ (Bad Kreuznach – Traben-Trarbach), ist ein
„Saar-Hunsrück-Steig“ in Sicht.
 Der
römische Hofdichter Decimus Magnus Ausonius musste für diesen Weg seinen Namen
hergeben. Die Beschreibung einer Kutschfahrt von Bingen nach Trier, die er im
Jahr 371 nach Christus unternahm, liefert die Begründung für diesen
Weitwanderweg. Die Ausoniusstraße verband schon im 3. Jahrhundert nach Christus
den Rhein mit der römischen Kaiserresidenz in Trier. Bis ins späte Mittelalter –
auf Teilstrecken sogar bis in die Neuzeit - wurde diese alte Handels- und
Kriegsstraße von den Einwohnern der Region genutzt. Bis auf kleine Abschnitte
ist diese historische Trasse heute unter den Bundesstraßen und Feldwegen
verschwunden Der
römische Hofdichter Decimus Magnus Ausonius musste für diesen Weg seinen Namen
hergeben. Die Beschreibung einer Kutschfahrt von Bingen nach Trier, die er im
Jahr 371 nach Christus unternahm, liefert die Begründung für diesen
Weitwanderweg. Die Ausoniusstraße verband schon im 3. Jahrhundert nach Christus
den Rhein mit der römischen Kaiserresidenz in Trier. Bis ins späte Mittelalter –
auf Teilstrecken sogar bis in die Neuzeit - wurde diese alte Handels- und
Kriegsstraße von den Einwohnern der Region genutzt. Bis auf kleine Abschnitte
ist diese historische Trasse heute unter den Bundesstraßen und Feldwegen
verschwunden
Weitwanderwege dieser Länge wecken in mir meist den
sportlichen Ergeiz. Nach drei Tagen will ich unter dem Torbogen der Porta Nigra
stehen, nehme ich mir vor. Die Legionen Roms, die diesen Weg genutzt haben
mögen, waren auch nicht auf einer Kaffeefahrt. Hinzu kommt, dass ich für das
obige Motto nur drei Tage zur Verfügung habe. Wer ist schon frei von allen
Verpflichtungen? Besonders in den Zeiten einer Fußball-WM! Eine weitere
Vorplanung ist nicht nötig. Die Wanderkarten für das durchwanderte Gebiet stehen
noch im Regal. Ab damit in den neuen Rucksack (der soll auf den Prüfstand) zu
Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kocher und ein paar Klamotten. Fertig! Wandern kann
so einfach sein.
I.
Citius, altius, fortius.
Die Nomenklatur der Deutschen Bahn soll einer verstehen. Nach
der Durchsage „Nächster Halt Bingen-Hauptbahnhof.“, stehe ich nun auf dem
Bahnsteig des besagten Hauptbahnhofs. Leider ist der in Bingerbrück. Der
Ausoniusweg fängt bei der Burg Klopp in Bingen-Stadt an. Was soll’s. Die B9 hat
auch ihre Reize. Der römische Poet wird es mir nachsehen, wenn ich erst an der
Drususbrücke auf den Weg treffe, der nach ihm benannt ist.
„Warum beginnen die meisten Wanderungen immer mit einer Steigung?“, denke ich
mal wieder, als es durch die sehr kurze Mühestraße (hoffentlich ist der Name
nicht Programm für die nächsten Tage) vom Rheintal nach Weiler hinauf geht. Bis
Weiler geht es über einen schmalen und schattigen Pfad. Danach übernimmt eine
wenig befahrene Landstraße den Ausoniusweg. Das mit der Landstraße wird ab hier
noch mehrfach vorkommen. Beim Dahintrotten zum ehemaligen Bergwerk Amalienhöhe,
mache ich mir Gedanken über diese Wegführung. Wollten die Macher, so weit es die
heutigen Verhältnisse erlauben, den Weg an die Originalroute aus der Römerzeit
halten? In den nächsten Tagen habe ich noch mehrmals die Gelegenheit darüber
nachzudenken.
Als Entschädigung gibt es von der Amalienhöhe zum ersten Mal einen weiten Blick
in den Hunsrück und zurück in die Rheinebene. Im Waldalgesheimer Wald gibt es
keinen Fernblick mehr, dafür Schatten (seit Beginn der Beckenbauer-WM gibt es
nur noch heiße, sonnige Tage) und die Asphaltstrecke wird von einem breiten,
geschotterten Waldweg abgelöst. Irgendwo hier kreuzt der Europäische
Fernwanderweg E8 die Strecke. Eine Markierung oder ein Hinweisschild suche ich
vergebens. Schade. Auch der Ausoniusweg ist hier keiner Erwähnung wert, dafür
der Sandweg. Dieser führt zu einer breiten Schneise mit nicht zu übersehenden
Hochspannungsleitungen. Eine zeitlang begleitet mich das Knistern der
Stromleitungen. Danach ist mal wieder eine Autostraße fällig. Bei etwas anderer
Wegführung, Alternativen gibt es, bliebe einem beides erspart.
 Beim
Blick vom Ohligsberg (608 m), dem höchsten Punkt dieser Wandertour, sind diese
ketzerischen Gedanken hinfällig. Es hat sich mal wieder gelohnt. Bei fast klarem
Wetter kann ich bis ans Ende der bekannten Welt sehen. Die Gewissheit nun oben
auf dem Hunsrückplateau zu sein, macht die Pause noch schöner.Die ehemalige
US-Raketenabschussbasis vor Dichtelbach böte einige gute
Übernachtungsmöglichkeiten. Das Tor steht offen und überdachte, frei zugängliche
Gebäude, die Platz für eine Isomatte bieten, gibt es auch. Punktabzug gibt es
für die Büsche, die den Tennisplatz hier und da beleben. Nach 16 Kilometer schon
Feierabend? So wird das nie was mit den drei Tagen. Höher? Heute nicht mehr!
Schneller? Nicht unbedingt. Weiter! Also runter in den Ort und gemeinsam mit dem
Europäischen Fernwanderweg E3 (ein kleines Schild auf freiem Feld weist darauf
hin) nach Rheinböllen. Beim
Blick vom Ohligsberg (608 m), dem höchsten Punkt dieser Wandertour, sind diese
ketzerischen Gedanken hinfällig. Es hat sich mal wieder gelohnt. Bei fast klarem
Wetter kann ich bis ans Ende der bekannten Welt sehen. Die Gewissheit nun oben
auf dem Hunsrückplateau zu sein, macht die Pause noch schöner.Die ehemalige
US-Raketenabschussbasis vor Dichtelbach böte einige gute
Übernachtungsmöglichkeiten. Das Tor steht offen und überdachte, frei zugängliche
Gebäude, die Platz für eine Isomatte bieten, gibt es auch. Punktabzug gibt es
für die Büsche, die den Tennisplatz hier und da beleben. Nach 16 Kilometer schon
Feierabend? So wird das nie was mit den drei Tagen. Höher? Heute nicht mehr!
Schneller? Nicht unbedingt. Weiter! Also runter in den Ort und gemeinsam mit dem
Europäischen Fernwanderweg E3 (ein kleines Schild auf freiem Feld weist darauf
hin) nach Rheinböllen.
Hinter Rheinböllen wurde der Weg verlegt. Ich frage
mich dann schon mal nach den Ursachen. Hat ein Waldbesitzer gemault? Bekommt der
Jäger kein Wild mehr vor die Flinte? Ist die neue Strecke schöner? Oder stecken
wirtschaftliche Gründe dahinter? Keine Ahnung. Hier führt der Ausoniusweg jetzt
nicht mehr durch den Wald, sondern am Waldrand vorbei. Mir soll es recht sein,
zumal die neue Strecke freie Sicht über den Hunsrück bietet. Bis Dichtelbach
führte die Route meist durch schattigen Wald. Ab Rheinböllen geht es überwiegend
durch die nun offene, weit einsehbare Landschaft. Meist durch Wiesen und Felder,
oft an einem Waldrand vorbei, immer nach Westen. Einem Sonnenbrand steht nichts
mehr im Wege.
Seit Rheinböllen habe ich den Pegelstand meiner
Trinkwasserflasche im Auge. Am Wahlbacher Friedhof soll der wieder steigen. Ein
Blick in das Wassersammelbecken und ich vertröste mich auf Simmern. Vorbei an
den seit einigen Jahren auch im Hunsrück unvermeidlichen Windkraftanlagen,
geht’s ins Simmerner Industriegebiet. Die Supermärkte lasse ich links
(eigentlich rechts) liegen. In der Innenstadt wird es auch noch was geben. In
der Fußgängerzone das altbekannte Problem – gähnende Leere; und ich sehe mich
plötzlich ohne Trinkwasser dastehen. Zum Glück gibt es einen russischen
Lebensmittelladen. Obwohl Simmern ein nettes, unaufgeregtes Städtchen ist, hält
mich nichts. Nach kurzer Pause gehe ich Richtung Krankenhaus aus der Stadt
hinaus. Hier, am Stadtrand, lauert die eigentliche Versuchung des heutigen
Tages. Beruflich war ich schon oft in der Gegend. Und dass es dort ein gutes und
bezahlbares Hotel gibt, ist mir nicht entgangen ...
An der B50 hat der innere Schweinehund verloren. Und
meine Augen und Ohren freuen sich über die Verlegung des Weges. Über Jahre
führte die Trasse des Ausonisweges direkt an der stark befahrenen Bundesstraße
vorbei. Jemand hat wohl endlich ein Einsehen gehabt. Auch wenn sie jetzt nicht
mehr ganz so historisch ist, die neue Wegführung ist um vieles besser. Prompt
verpasse ich die Abzweigung, die von Ohlweiler nach Schönborn führt. Die kaum
sichtbare weiße Markierung auf einer Bordsteinkante an einem Garten ist schon
überwachsen. Über einen schönen Wiesenweg geht es in den Ellergrund, der langsam
nach Schönborn hinauf ansteigt.
Im kleinen Wald - zwischen Schönborn und Rödern -
ist Pause angesagt. Es geht auf den Spätnachmittag zu und ich mache mir langsam
Gedanken, wo die „Ren-nerei“ heute enden soll. Einerseits ist das Wäldchen ideal
(ruhig, weit ab vom Schuss, Abendsonne und sehr wichtig: eine Bank), anderseits
überzeugt mich ein Blick in die Wanderkarte, dass es bis zum Feierabend noch was
dauern kann. Ein Drittel der Strecke liegt hinter mir. Eigentlich sollte das für
diesen Tag reichen. Erfahrungsgemäß kommt morgen oder übermorgen der große
Durchhänger. Es kann nicht schaden, wenn ich noch einige Kilometer dranhänge.
Wasser brauche ich auch wieder. Kirchberg ist ab jetzt das neue Ziel.
 Von
Rödern bis Kirchberg habe ich erneut Gelegenheit über die Verbindung von
Wanderweg und Kreisstraße nachzudenken. Die älteste Stadt im Hunsrück hat nur
4000 Einwohner, da hält sich der Verkehr zum Glück in Grenzen. Die
Trinkflasche ist mal wieder leer. Zusätzlich will ich mir einen
Trinkwasservorrat für den Abend und den morgigen Tag besorgen. Am Stadtrand
gibt es einen großen Supermarkt. Leider nicht genau auf meiner Wanderroute. Im
Gedenken an Simmern, frage ich einen Mann auf der Straße nach einem Geschäft
im Zentrum. Ja, gibt es. Über das Woher und Wohin kommen wir ins Gespräch.
Dass ich zu Fuß von Bingen nach Trier unterwegs bin, will ihm nicht in den
Kopf, aber dass ich im Wald schlafen werde, findet er völlig normal. „Haben
wir früher auf unseren Wanderungen auch immer gemacht. Oder beim Bauern in der
Scheune.“, meint er. Tipps für einen guten Schlafplatz kann er mir auch nicht
geben. Nach dem Einkauf hat sich mein Gepäck um fünf Kilo erhöht.
Hauptsächlich Getränke. Bis zum nun feststehenden Ziel des heutigen Tages sind
es noch 5 Kilometer. Die Ausoniushütte mit „Römerspielen“ oberhalb Dill
soll es sein. Kurz vorher fängt die 10 Kilometer lange Gerade an. Von
Rödern bis Kirchberg habe ich erneut Gelegenheit über die Verbindung von
Wanderweg und Kreisstraße nachzudenken. Die älteste Stadt im Hunsrück hat nur
4000 Einwohner, da hält sich der Verkehr zum Glück in Grenzen. Die
Trinkflasche ist mal wieder leer. Zusätzlich will ich mir einen
Trinkwasservorrat für den Abend und den morgigen Tag besorgen. Am Stadtrand
gibt es einen großen Supermarkt. Leider nicht genau auf meiner Wanderroute. Im
Gedenken an Simmern, frage ich einen Mann auf der Straße nach einem Geschäft
im Zentrum. Ja, gibt es. Über das Woher und Wohin kommen wir ins Gespräch.
Dass ich zu Fuß von Bingen nach Trier unterwegs bin, will ihm nicht in den
Kopf, aber dass ich im Wald schlafen werde, findet er völlig normal. „Haben
wir früher auf unseren Wanderungen auch immer gemacht. Oder beim Bauern in der
Scheune.“, meint er. Tipps für einen guten Schlafplatz kann er mir auch nicht
geben. Nach dem Einkauf hat sich mein Gepäck um fünf Kilo erhöht.
Hauptsächlich Getränke. Bis zum nun feststehenden Ziel des heutigen Tages sind
es noch 5 Kilometer. Die Ausoniushütte mit „Römerspielen“ oberhalb Dill
soll es sein. Kurz vorher fängt die 10 Kilometer lange Gerade an.
Um
19 Uhr ist Schluss für heute. Die Schutzhütte liegt am Waldrand, ist groß,
sauber, hat Tische und Bänke und freie Sicht nach Westen auf den Hunsrück bei
Sohren. Das Zelt bleibt im Rucksack. Weil der Tagesproviant noch weg muss, kommt
der Kocher auch nicht zum Einsatz. Als Nachhut einiger spätabendlicher Jogger
zieht ein Jäger mit der Flinte auf der Schulter vorbei. Keine Panik! Ich zelte
ja nicht. Er grüßt freundlich. Schon nach wenigen Metern habe ich den aus den
Augen verloren. Wo der wohl steckt? Dass ich den Waidmann heute Abend noch mal
sehen werde, ist wohl klar.
Der
stetig wehende Westwind hat den ganzen Tag für erträgliche Temperaturen
gesorgt, durchgeschwitzt bin ich aber doch. Schade, dass meine Frau nicht dabei
ist. Die will mir auch nach vielen Jahren nicht glauben, dass man sich mit einem
Liter Wasser von Kopf bis Fuß waschen kann. Danach rein in frische, saubere
Klamotten und der Abend ist perfekt. Als es stockduster ist, rolle ich meinen
Schlafsack auf der schmalen Bank aus. Eingeklemmt zwischen Hüttenwand und Tisch
kann ich nicht runterfallen. Kurz bevor ich einschlafe, höre ich Schritte
näher kommen. Auf Höhe des Hütteneingangs dann Stille. Nach einigen Sekunden
entfernen sich die Schritte wieder. Eine Autotür schlägt zu, ein Anlasser
rasselt und weg ist der Jäger.
II.
Errare humanum est.
Um
halb fünf holt mich der Wecker aus dem Schlaf. In dem Fall das Handy. Die
übliche Morgenroutine, dann geht’s im Morgengrauen los. Eine Dose Cola muss
den Kaffee ersetzen. Frühstück gibt es erst nach zwei, drei Stunden. Die 300
Meter bis zum Römerturm komme ich ohne Regenkleidung aus. Dann ist Schluss.
Regenjacke und Regenhose raus. Der Rucksack schreit ebenfalls nach der
Regenhülle. Regenschirm nicht vergessen. Ich hasse das! Der Himmel hängt grau
und schwer bis auf die Felder herab. Das totale Kontrastprogramm zum gestrigen
Tag. Zum Glück klart sich der Himmel kurze Zeit später etwas auf. Ich kann aus
den ungeliebten Regenklamotten raus. Der Regenschirm muss nur noch gelegentlich
ran.
Um
halb fünf holt mich der Wecker aus dem Schlaf. In dem Fall das Handy. Die
übliche Morgenroutine, dann geht’s im Morgengrauen los. Eine Dose Cola muss
den Kaffee ersetzen. Frühstück gibt es erst nach zwei, drei Stunden. Die 300
Meter bis zum Römerturm komme ich ohne Regenkleidung aus. Dann ist Schluss.
Regenjacke und Regenhose raus. Der Rucksack schreit ebenfalls nach der
Regenhülle. Regenschirm nicht vergessen. Ich hasse das! Der Himmel hängt grau
und schwer bis auf die Felder herab. Das totale Kontrastprogramm zum gestrigen
Tag. Zum Glück klart sich der Himmel kurze Zeit später etwas auf. Ich kann aus
den ungeliebten Regenklamotten raus. Der Regenschirm muss nur noch gelegentlich
ran.
 Beim
Turmnachbau gibt es noch einige Meter der originalen Römerstraße, auf denen man
aber nicht gehen kann. Dafür gibt es einen einige hundert Meter langen Nachbau
eines römischen (?) Trampelpfades. Beim
Turmnachbau gibt es noch einige Meter der originalen Römerstraße, auf denen man
aber nicht gehen kann. Dafür gibt es einen einige hundert Meter langen Nachbau
eines römischen (?) Trampelpfades.
Irgendwann wird mit bewusst, dass ich auf der 10
Kilometer langen Geraden unterwegs bin. Hätt’ ich doch beinahe verschwitzt.
Vielleicht weil diese Gerade mal als Feldweg, dann wieder als Waldweg oder als
klitschnasser Wiesenweg daher kommt. Das leichte Auf und Ab hier oben auf dem
Hunsrück verhindert im Augenblick eh’ einen Blick ins Unendliche. Mag es an der
frühen Stunde, am grauen, tief hängenden Himmel oder an der einsamen Landschaft
liegen – dieser frühe Morgen hat was. Trotz grauem Himmel und Gerade. Vielleicht
ist es das alles zusammen.
Hinter Krummenau wird es auch wieder kurviger, als
Zugabe wird der Weguntergrund auch wieder fester. Asphalttreten ist bis
Hochscheid unterhalb des Idarkopfs angesagt. Das Wetter hat sich
zwischenzeitlich auch wieder an die Fußballweltmeisterschaft erinnert – also
wieder Kaiserwetter.
Ganz in der Nähe wurde 1939/40 eine Tempelanlage mit
Brunnenanlage und allem Pi Pa Po ausgegraben. Vom Quellenheiligtum ist heute
nichts mehr zu sehen. Die Funde befinden sich im Landesmuseum in Trier. Die
Ausgrabungsstätte wurde zugeschüttet. Einen Besuch kann ich mir ruhigen
Gewissens ersparen. Das sieht im Archäologiepark Belginum anders aus. Der Besuch
lohnt schon eher. Das Beste an diesem Museum ist die Lage. Weit geht der Blick
über die Dörfer und Wiesen bis in die Eifel. Die Kelten, wie auch deren
Nachfolger, die Römer, wussten schon, warum das der geeignete Ort für eine
Siedlung mit Grabanlage war. Auf der Museumsmauer sitzend ändere ich meine
Planung. Ich werde nicht mehr der Hauptroute folgen, sondern nehme die Variante,
die hinab nach Neumagen-Dhron und an die Mosel führt. Diese Strecke folgt dem
historischen Verlauf der Römerstraße. Dass ich für einen kurzen Abschnitt keine
Wanderkarte habe, nehme ich in Kauf. Bisher war der Weg sehr gut markiert. Wird
schon gehen!
Vom Museum oberhalb Wederath zieht sich der Weg ins
Unendliche. Steigungen, die diesen Nahmen verdient haben, gibt es die nächsten
Kilometern nicht. Ab der Bundesstraße zwischen Morbach und Gonzerath (wird zum
Glück nur überquert) gibt es endlich wieder Panoramablicke. Richtige
Hochstimmung will bei mir trotzdem nicht aufkommen. Erstens geht es über eine
Landstraße weiter und zweitens ist der Panoramablick einem endlosen Wald
gewichen. Und der befürchtete Durchhänger ist da. Beinnahe endlos führt die
Straße in einer geraden Linie nach Westen. Als ein Autofahrer anhält und mich
freundlich zum Mitfahren bis zum Abzweig nach Elzerath auffordert, brauche ich
für das „Nein“ schon einige Sekunden. Irgendwann ist das Stück Landstraße
geschafft. Es geht allerdings, wenn auch über einen breiten Waldweg, immer noch
ohne Biegung weiter geradeaus. Die superlange Gerade heute Morgen empfand ich
als sehr angenehm (das lag wohl am steten Wechsel zwischen Wald, Feld und
Wiesen), die viel kürzere hier bringt mich in Rage. Frust kommt auf. Einfacher
gesagt: Im Augenblick finde ich Wandern zum Kotzen!
Am Abzweig der Hauptroute steht endgültig fest, dass
ich auf der historischen Strecke bleiben werde. Am Weinplatz, nach einer
ausgiebigen Pause, hat sich meine Stimmung wieder deutlich gebessert. Also
weiter dem weißen „AU“ hinterher. Wegen fehlender Wanderkarte muss ich nun der
Markierung und einer etwas ungenauen Wegbeschreibung aus dem Wanderführer
vertrauen. Prompt verlaufe ich mich. Irgendwann bleiben die Markierungen ganz
aus. Was tun? Die Wegbeschreibung bleibt für diesen Abschnitt etwas kryptisch:
„... Durch das Päseler Wäldchen folgen wir der ausgeschilderten (AU), aber
dennoch etwas komplizierten Streckenführung ...“ So ist es. Weitergehen
bringt nicht viel. Alles wieder zurück bis beinnahe an den Weinplatz. Irren ist
menschlich! Als „Preis“ muss ich runter vom Ausoniusweg und auf den
Moselhöhenweg wechseln. Von dem habe ich noch eine vage Erinnerung von einer
lange zurückliegenden Wanderung. Auf alle Fälle jedoch die passenden Wandkarten.
Also, auf an die Mosel! Vom Honrather Sportplatz runter zur Pulvermühle und
durch ein Seitental wieder hinauf zum Dhrönschen, wo die ersten Weinberge der
Mosel auftauchen. Von hier oben gibt es einen fantastischen Weitblick ins
Moseltal. Weinberge und Winzerdörfer so weit das Auge reicht. Leider ist auch
ein Hotel zu sehen. Nur wenige Meter neben dem Moselhöhenweg. Es geht schon
wieder auf 18 Uhr zu. Soll ich? Nein! Ich gehe runter nach Trittenheim. Dort,
direkt an der Mosel, gibt es einen kleinen Campingplatz.
 Zelt
aufbauen, Duschen und ab ins Dorf zum Italiener. Touristenorte haben nicht nur
Nachteile. Als ich auf den Platz zurückkomme, hat sich neben meinem Zelt ein
Ehepaar aus Holland niedergelassen. Die sind mit dem Fahrrad unterwegs.
Gestartet sind sie in Nordholland und wollen in drei Wochen in Florenz sein. Wie
viele Holländer kommen die beiden bei der Beschreibung der Eifelstrecke aus dem
Schwärmen nicht mehr raus. Akustisch wird unsere Unterhaltung von einem
Hubschrauber untermalt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit werden die Weinberge am
anderen Moselufer ausgiebig mit dessen Hilfe gespritzt. Im Zelt liegend höre ich
der Fernsehübertragung eines Fußballspiels zu. Wie jämmerlich sind die
Kommentare der Fernsehreporter, wenn man das Bild nicht sieht! Geradezu ein
Schlafmittel. Zelt
aufbauen, Duschen und ab ins Dorf zum Italiener. Touristenorte haben nicht nur
Nachteile. Als ich auf den Platz zurückkomme, hat sich neben meinem Zelt ein
Ehepaar aus Holland niedergelassen. Die sind mit dem Fahrrad unterwegs.
Gestartet sind sie in Nordholland und wollen in drei Wochen in Florenz sein. Wie
viele Holländer kommen die beiden bei der Beschreibung der Eifelstrecke aus dem
Schwärmen nicht mehr raus. Akustisch wird unsere Unterhaltung von einem
Hubschrauber untermalt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit werden die Weinberge am
anderen Moselufer ausgiebig mit dessen Hilfe gespritzt. Im Zelt liegend höre ich
der Fernsehübertragung eines Fußballspiels zu. Wie jämmerlich sind die
Kommentare der Fernsehreporter, wenn man das Bild nicht sieht! Geradezu ein
Schlafmittel.
III.
Perfer et obdura!
Um sieben Uhr bin ich wieder unterwegs, es ist
wieder Kaiserwetter angesagt. Wieder geht’s den Berg hinauf, zum Dhrönschen.
Nach einer Stunde komme ich an dem Campingplatz vorbei, der oben auf dem Berg
direkt am Weg liegt. In der Wanderkarte hatte ich den auch gestern Abend schon
gesehen. Ganz sicher war ich mir nicht, ob es den immer noch gibt. Und im Hotel
fragen? Der innere Schweinehund ...
Als wollte mir das Moseltal beweisen, dass es auch
anders möglich ist. Die Wegführung geht von nun an immer wieder bergauf und
bergab. Beim Fünfseenblick steht ein neuer Aussichtsturm an der Hangkante. Der
stand vor acht Jahren noch nicht hier. Also rauf. Bei dem Blick, der sich mir
von der obersten Plattform bietet, ist eine längere Pause angesagt. Danach kommt
die Autobahn in Sicht. Was viel schlimmer wiegt, ist der Lärm. Da gibt nicht nur
der Autofahrer Gas, auch ich drücke aufs Tempo. In Riol ist das alles wieder
vergessen.
Mir fallen die Rosenstöcke an den Weinstöcken auf.
Wozu mögen die gut sein? Werden damit die Weinberge untereinander abgegrenzt?
Fragen hat noch nie geschadet. Na dann mal los. Leider weiß ich es bis heute
nicht. Von den sechs ArbeiternInnen, die ich im Weinberg anspreche, kommen vier
aus Polen und zwei aus Rumänien. Über den Wein hier können die mir einiges
erzählen, sie kommen seit Jahren im Frühling und bleiben bis zur Weinlese, aber
die Rosen sind ihnen noch nicht sonderlich aufgefallen.
Hinter Riol ist es dann soweit: Der letzte Anstieg
dieser Wanderung steht an. Das bringt mir die zweite Luft. Die Motivation könnte
besser nicht sein. Dann also hinauf in den Longuicher Wald. Ab dem Sauerbrunnen
in diesem Wald ist dann auch der Ausoniusweg wieder mit von der Partie. Das
läuft jetzt wie von selbst. Rüber über die B 52 und dann nur noch abwärts bis
nach Ruwer. Bei den Häusern oben am Dorfrand kommt endlich das Ziel in Sicht. Im
Mittagsdunst kann ich die Türme der Trierer Kirchenlandschaft erkennen. Nix wie
runter ins Dorf zur Bushaltestelle. „Bus?“, höre ich jetzt schon die erstaunte
Frage meiner Frau, „Das gab es ja noch nie!“ Da lasse ich den Bus nach Trier Bus
sein; und beschließe die letzten 6 Kilometer bis zur Porta Nigra auch noch zu
gehen. Schon bei der Kläranlage der Stadt zweifele ich an meinen Verstand. Die
letzten Kilometer bis zum Bahnhof hätte ich mir ersparen sollen. Nicht nur dass
die Strecke öde ist, mittlerweile gehe ich auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch.
Den Satz „Quäl dich du Sau!“, den sich Jan Ulrich mal anhören musste, hilft mir
über die letzen Innenstadtkilometer. Etwas eleganter: Halte durch und sei hart!
Nun ja. Seitdem kenne ich eine Ecke in Trier, in der ich auf keinen Fall wohnen
möchte.
 Am
frühen Nachmittag bin ich am Bahnhof. Platt, geschafft und bar jeglicher Lust
auf einen Stadtbummel. Die Innenstadt mit ihren historischen Gebäuden und
Plätzen kann mir gestohlen bleiben. Die Besichtigungstour kann ich im Juli, dann
werde ich wohl wieder in Trier sein, noch nachholen. Hinzu kommen erhebliche
Rückenschmerzen. Der neue Rucksack - obwohl ein Markenprodukt und nicht
preiswert - ist nicht für mich geschaffen. Für die nächsten Touren wird wieder
einer von den alten Rucksäcken herhalten müssen.Eine Stunde später sitze ich im Zug, der mich zurück
ins Rheinland bringt. Der Rücken tut nicht mehr weh und nach zwei Tassen Kaffee
ist von der Erschöpfung nicht mehr viel geblieben. Zeit und Muße um über neue
Wanderungen nachzudenken. Mal wieder die Eifel? Oder Jakobsweg? Oder doch besser
nach Frankreich? Zum Glück gibt es beinahe überall Weitwanderwege. Am
frühen Nachmittag bin ich am Bahnhof. Platt, geschafft und bar jeglicher Lust
auf einen Stadtbummel. Die Innenstadt mit ihren historischen Gebäuden und
Plätzen kann mir gestohlen bleiben. Die Besichtigungstour kann ich im Juli, dann
werde ich wohl wieder in Trier sein, noch nachholen. Hinzu kommen erhebliche
Rückenschmerzen. Der neue Rucksack - obwohl ein Markenprodukt und nicht
preiswert - ist nicht für mich geschaffen. Für die nächsten Touren wird wieder
einer von den alten Rucksäcken herhalten müssen.Eine Stunde später sitze ich im Zug, der mich zurück
ins Rheinland bringt. Der Rücken tut nicht mehr weh und nach zwei Tassen Kaffee
ist von der Erschöpfung nicht mehr viel geblieben. Zeit und Muße um über neue
Wanderungen nachzudenken. Mal wieder die Eifel? Oder Jakobsweg? Oder doch besser
nach Frankreich? Zum Glück gibt es beinahe überall Weitwanderwege.
Epilogus
Es war schön! Das Wetter war klasse. Der verregnete
Morgen war das Salz in der Wettersuppe. Die Landschaft unspektakulär. Bis auf
die üblichen Spaziergänger und Jogger ist mir kein Wanderer über den Weg
gelaufen. Das mag daran gelegen haben, dass ich unter der Woche unterwegs
gewesen bin (Mi. – Fr.) und die Fußball-WM wird auch den Einen oder die Andere
vom Wandern abgehalten haben.
Mal ehrlich! Nerven die breiten und oft geraden Wege
da oben nicht? Nö, ist halt ’ne alte Kulturlandschaft. Die Land- und
Forstwirtschaft hat hier für das äußere Erscheinungsbild gesorgt. Dafür gibt es
unverbaute Blicke ins Land. Okay, okay – die Etappen über die Landstraßen... Der
Verkehrslärm hat es an ein paar Stellen auch bis hinauf in den Hunsrück
geschafft, aber nur an wenigen Stellen. Ein zwar oft gerader, vielleicht deshalb
auch ehrlicher Weg. Sofern es so etwas gibt.
Und? Geht es wieder auf den Hunsrück? Ja! Da warten
noch einige Weitwanderwege. Fast alles „kurze“, so um die 100 Kilometer. Ideal
fürs lange Wochenende oder für einen kleinen Leistungs- oder Materialtest ...
Die großen Wälder da oben, die zwischen dem Rhein und dem Saarland, in die zieht
es mich nicht, die versuche ich zu umgehen, aber in die offenen Landschaften und
die kleinen, von keinem Dorf- und Stadtplaner berührten Dörfer. Nicht zu
vergessen die „Großstädte“ Simmern, Kirchberg, Morbach und Hermeskeil. Auch weil
hier das Leben nicht pulsiert. Oder gerade deshalb.
Appendant
Beatus
ille, qui procul negotiis. – Glücklich der, der fern von Pflichten ist.
Citius,
altius, fortius. - Schneller, höher, weiter.
Errare
humanum est. – Irren ist menschlich.
Perfer et
obdura! - Halte durch und sei hart!
Gewanderte Strecke:
1. Tag: Bingen – Dichtelbach – Rheinböllen –
Simmern - Kirchberg – Ausonius-hütte ca. 49 km
2. Tag: Ausoniushütte – Belginum – Weinplatz
– Sportplatz Horath (ab hier Moselhöhenweg) – Papiermühle – Dhrönschen –
Trittenheim ca. 48 km
3. Tag: Trittenheim – Dhrönschen –
Fünfseenblick – Riol – Ruwer – Trier ca. 37 km
Wegbeschreibung:
Berthold Staudt, „Die Ausoniusstraße – Eine römische
Wanderstraße im Hunsrück“, erhältlich im Archäologiepark Belginum „www.belginum.de“
und bei der Gemeindeverwaltung in Morbach/Hs.
Mehr Infos zum Weg bei
www.wanderbares-deutschland.de
PS: Nur
damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich bin weder ein alter noch ein neuer
Lateiner. Die Zitate haben mir das Internet geliefert, meist die Wikipedia. Die
Freundinnen und Freunde dieser alten Sprache mögen mir die Fehler nachsehen.
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
21 - Dezember 2006
220 km unterwegs auf Forstautobahnen
und anderen Schotterwegen – manchmal auch auf
Fußpfaden
Eindrücke von 10 Tagen Westweg-Wanderung Pforzheim – Steinen
Text und Fotos von Hartmut
Hermanns
 Glaubt man der
Schwarzwaldwerbung, so wandern jährlich Tausende den Westweg zwischen Pforzheim
und Basel, den Königsweg aller Weitwanderwege im Schwarzwald, sehr gut markiert
mit der berühmten roten Raute auf weißem Feld. Glaubt man der
Schwarzwaldwerbung, so wandern jährlich Tausende den Westweg zwischen Pforzheim
und Basel, den Königsweg aller Weitwanderwege im Schwarzwald, sehr gut markiert
mit der berühmten roten Raute auf weißem Feld.
Sie wissen in den meisten Fällen
nicht, was sie erwartet: Nach einer Statistik des Deutschen Wanderverbandes sind
nur ca. 20% der Wegstrecke naturbelassen, ca. 5% asphaltiert, der Rest sind
befestigte Forstwege und –straßen. Wir wussten dies auch nicht. Man lernt durch
Gehen. Von diesem Lernprozess mit durchaus positivem Gesamtergebnis soll im
folgenden berichtet werden.
Der Wanderweg von
Pforzheim bis Basel durchläuft alle Landschaftsformen des hohen Schwarzwaldes,
in einer Höhe zwischen 720m (Dobel) bis 1495m (Feldberg). Im Norden (von
Pforzheim bis Hausach) dominiert der Buntsandstein, gefolgt vom Granit des
Triberger Stocks (Hausach bis Karlstein), um dann in die Mischgneise und Granite
des mittleren und südlichen Schwarzwaldes einzutreten (vom Karlstein bis Kandern).
Den Abschluss bilden wieder Sedimentgesteine des Buntsandsteins und des Tertiärs
(Kandern bis Basel).
Größere Siedlungen
werden nach Verlassen der Alb-Pfinz-Hochfläche (Straubenhardt und Dobel) nur
noch in Forbach, Hausach, Titisee und Kandern durchquert, in den beiden ersten
Fällen verbunden mit heftigen Ab- und Aufstiegen von über 700 m, die in der
Literatur über den Westweg als besonders beeindruckend beschrieben werden,
warum, dazu später.
Die Einteilung der
Etappen orientiert sich an den Übernachtungsmöglichkeiten und an den
herausragenden Einschnitten im Wegeverlauf. So wird Forbach als Station zwischen
Abstieg ins Murgtal (700 m) und Aufstieg aus dem Murgtal auf die Badener Höhe
800m) gewählt; Hausach als Etappe bei der Überschreitung des Kinzigtales sowie
Titisee (bzw. Bärental) vor dem Aufstieg auf den Feldberg.
Im Regelfall sollen
die insgesamt 265 km bis Basel in elf Etappen bewältigt werden, was dazu führt,
dass mehrfach Tageslängen von knapp 30 km zu überwinden sind, eine Strecke, die
bei entsprechenden Höhenunterschieden zu einer echten Herausforderung werden
kann.
Zusammen mit einem
Freund bin ich den Weg in der zweiten Septemberhälfte 2006 in zehn Tagen
gewandert, davon an sieben Tagen mit Sonne, Wolken, Nebel und teilweise heftigem
Ostwind. Die zwei Etappen zwischen Karlstein und Titisee waren durch Regen und
Nebel beeinträchtigt.
Nützlich für die
Planung und Durchführung der Wanderung war der Wanderführer von Walz, Rudolf:
Schwarzwald-Westweg.
(Wandern ohne Gepäck), Walz Wanderferien Verlag, Neckartenzingen, 2006, ISBN
3-88650-022-5, 8. Auflage, mit präzisen Wegbeschreibungen, nützlichen Hinweisen
zu Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, vor allem aber mit vielfältigen
landes- und naturkundlichen Informationen. Die Broschüre der
Tourismusinformation Pforzheim zum Westweg enthält eine Etappengliederung mit
entsprechenden Übernachtungsvorschlägen. Wir hatten die Übernachtungsquartiere
schon Wochen vorher telefonisch reserviert. Dies ist nach unseren Erfahrungen
allerdings nicht notwendig, schränkt im übrigen die Flexibilität ein. Es ist
durchaus möglich am Morgen das nächste Quartier zu reservieren. Die Zahl der
Wanderer, die zur gleichen Zeit auf dem Weg ist, hält sich sehr in Grenzen. In
unserem Fall waren es von Pforzheim bis zur Alexanderschanze 3 Personen, von
Hausach bis Kandern kamen zwei weitere hinzu.
Zur Orientierung
dienten uns die Karten des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg Maßstab 1:
50 000: Nr. 502 (Pforzheim), Nr. 501 (Baden-Baden) Nr. 503 (Offenburg), Nr. 506
(Titisee) und Nr. 508 (Lörrach). Die Markierung des Wanderweges ist durchgehend
präzise, ein Dank an die Wegwarte des Schwarzwaldvereins.
Die
erste Etappe
begann in
Birkenfeld bei
Pforzheim, wo wir nach der
Anreise mit der Bahn (Baden-Württemberg-Ticket) von Steinen (Kreis Lörrach) über
Basel , Karlsruhe und Pforzheim gegen 12.40 Uhr eintrafen. So war die Strecke
von 18 km bis zum ersten Etappenziel
Dobel
gut zu bewältigen. Nach vier Stunden Wanderzeit erreichten wir unseren
Etappenort und unser erstes Quartier: Gästehaus Helene Bott (Tel.: 07083 1624),
direkt an der Wanderstrecke gelegen Wir waren die einzigen Westwegwanderer an
diesem Abend.
Am nächsten Tag
lernten wir unterwegs die übrigen drei Westwegwanderer kennen. Die Wirtin klagte
über geringe Übernachtungszahlen von Wanderern, eine Information, die mich zum
ersten Mal in Erstaunen versetzte: Wir waren doch auf dem meist begangenen
Wanderweg des Schwarzwaldes?
Der Weg von Birkenfeld
bis Dobel folgt bis auf zwei kurze Wegstrecken ausgebauten Forststraßen, Typus:
Zwei Spuren, in der Mitte leichte Erhebung, manchmal mit Gras bewachsen,
Schotteruntergrund von grob bis fein, aber immer hart, teilweise ausgeprägte
Bogenform des Wegeprofils, so kann das Regenwasser gut in die beidseitig
vorhandenen Gräben abfließen, der Wanderer ist gezwungen häufig
die Seiten zu wechseln, um eine einseitige
Druckbelastung der kleinen Zehen zu vermeiden.
 Mit der guten
forstwirtschaftlichen Erschließung des Schwarzwaldes, vor allem in den Gebieten,
in denen Staatswaldungen dominieren, wurde ein dichtes Netz von Forststraßen
geschaffen, die für Lastkraftwagen und schwere Vollerntemaschinen tauglich sind,
so dass praktisch in allen Höhenlagen ausreichende Wegeverbindungen zwischen den
einzelnen Punkten vorhanden sind, nur ob sie für die Bedürfnisse von
Fußwanderern mit empfindlichen Fußsohlen tauglich sind, bezweifle ich. Es reicht
nicht (mehr) aus, Forststraßen als Wanderwege für Fußwanderer zu markieren; eher
sind diese Wege für Radfahrer geeignet, deren Zahl auf dem Weg bei weitem die
der Fußwanderer übertrifft – folgerichtig. Mit der guten
forstwirtschaftlichen Erschließung des Schwarzwaldes, vor allem in den Gebieten,
in denen Staatswaldungen dominieren, wurde ein dichtes Netz von Forststraßen
geschaffen, die für Lastkraftwagen und schwere Vollerntemaschinen tauglich sind,
so dass praktisch in allen Höhenlagen ausreichende Wegeverbindungen zwischen den
einzelnen Punkten vorhanden sind, nur ob sie für die Bedürfnisse von
Fußwanderern mit empfindlichen Fußsohlen tauglich sind, bezweifle ich. Es reicht
nicht (mehr) aus, Forststraßen als Wanderwege für Fußwanderer zu markieren; eher
sind diese Wege für Radfahrer geeignet, deren Zahl auf dem Weg bei weitem die
der Fußwanderer übertrifft – folgerichtig.
Wir lernten schnell
mit hoher Aufmerksamkeit nach hinten zu lauschen, um Fahrgeräusche von
Fahrrädern auf Schotter rechtzeitig zu orten und durch beherztes Verlassen einer
Spur einem Zusammenstoß zu entgehen, lästig übrigens dann, wenn man sich
nebeneinander laufend unterhalten möchte. Dass die Radfahrer auch die wenigen
Fußpfade gerne benutzen und so den Nutzungskonflikt auf die Spitze treiben, sei
nur angemerkt.
Verschärft wird die
Wegesituation dort, wo der Forststraßenbau dazu übergeht, die Wege auch noch
tauglich für Loipen zu machen: Verbreiterung und Rodung eines Streifens rechts
und links des Weges berauben diese Strecken jeglicher Raumdimension, die das
Wandern zu einem Genuss machen kann.
Für den Fußwanderer
kann die Schlussfolgerung nur lauten solche Wege zu meiden – was allerdings im
Falle des Westweges bedeutet, erst ab Alexanderschanze loszulaufen, da bis dort
der Anteil der „Forstautobahnen" besonders hoch ist.
Zweite Etappe
Dobel bis
Forbach,
345 m Aufstieg, 730 m Abstieg, Übernachtung im Naturfreundehaus Holderbronn
oberhalb von Forbach (Tel.: 07228 600), das ist das Programm des nächsten Tages.
Im Nebel verlassen wir
Dobel, nach einem guten Frühstück bei Frau Bott, an Resopaltisch, vor
Orchideenfenster und mit Berichten zur Lage des Übernachtungswesens. Der
Aufstieg auf den örtlichen Aussichtsturm entfällt wegen Nebels, dafür hat der
Wald – und die Schotterwege – uns schnell wieder. In mäßigem Aufstieg gewinnen
wir die nebelfreie Zone und den Blick auf die Berge um Baden-Baden und vor allem
auf Bad Herrenalb.
Die Wanderstraße ist
breit, die Aussichten sind prächtig, wir bewegen uns durchgängig im Höhenbereich
900m. Da die Sonne kräftig scheint, wird es Zeit für eine größere Pause. Dabei
machen wir zwei für den Westweg typische Erfahrungen:
 In den Höhenlagen gibt
es keine Brunnen und Quellen, eine für uns Südschwarzwälder neue Erkenntnis; bis
wir allerdings diese Tatsache wirklich verinnerlicht haben – und die
Trinkflaschen ausreichend füllen – dauert es noch bis zur Alexanderschanze, wo
uns der Durst die um das Hotel Alexanderschanze aufgebauten Zugangshindernisse
überwinden lässt, um an eine Flasche Bier zu kommen. In den Höhenlagen gibt
es keine Brunnen und Quellen, eine für uns Südschwarzwälder neue Erkenntnis; bis
wir allerdings diese Tatsache wirklich verinnerlicht haben – und die
Trinkflaschen ausreichend füllen – dauert es noch bis zur Alexanderschanze, wo
uns der Durst die um das Hotel Alexanderschanze aufgebauten Zugangshindernisse
überwinden lässt, um an eine Flasche Bier zu kommen.
Zweite Erfahrung:
Staatlicher Forststraßenbau ist begleitet von einer für müde Wanderer
segensreichen Ausstattung des Waldes mit Rast- und Schutzhütten. Allerdings
mussten wir feststellen, dass die verschiedenen zuständigen Forstämter durchaus
unterschiedlich intensiv die Möblierung des Waldes betreiben, vorbildlich im
Bereich des Staatsforstes Kaltenbronn, dürftig im Bereich zwischen Furtwangen
und Titisee (eine Hütte auf 25 km, und ich hätte sie bei dem Regen so gut
brauchen können !).Die dichteste Ausstattung mit Schutzhütten war im übrigen im
Bereich des Forstamtes Kandern zu beobachten (10. Etappe).
Auf dem Hohloh-Gipfel
beim Kaiser-Wilhelm-Turm (wir kommen am Sand auch noch zu einer
Bismarck-Gedenkstätte - die Preußen hatten offensichtlich ein Faible für den
Nordschwarzwald) befindet sich eine besonders luxuriös ausgestattete
Schutzhütte, gerade frisch errichtet. Erfahrene Wanderer und
Schwarzwaldvereinsmitglieder, die ich bei ihrem Gespräch über die Zukunft dieser
Hütte belauschte, waren voller Sorge, wie lange die Hütte dem Vandalismus von
Jugendlichen standhalten werde. Die Gefahr ist hier besonders groß, da der Turm
und die Hütte nur wenige Schritte von der Landstraße Gernsbach-Wildbad entfernt
liegen.
Am Hohloh-Turm ist ein
weiteres, für den Nordschwarzwald typisches Gestaltungselement der
Landschaftsplanung zu bewundern: Riesige geteerte Parkplätze, die den
winterlichen Ansturm von Skifahrern, hier vor allem Langläufer, bewältigen
sollen. Eine wahre Orgie von Parkplatzbauten können wir an den nächsten beiden
Tagen erleben, wenn wir entlang der Schwarzwaldhochstraße von Sand bis
Alexanderschanze laufen. Jeder Hang, auf dem man abfahren kann, ist hier
gerodet, mit einem Skilift ausgestattet und von Riesenparkplätzen umgeben. Das
Ensemble wird jeweils mit einem Hotel abgerundet. Zum Trost für die
Naturliebhaber muss allerdings gesagt werden, dass wir auf Skilifte gestoßen
sind, die zum Verkauf standen, und auf Hotels, die geschlossen waren. Die
Vermarktung einer ganzen Region erstickt schließlich an ihrer eigenen
Unersättlichkeit
An der Prinzenhöhe
verlassen wir die Forststraße und biegen in den Weg zum Murgtal ein, 700 m
Abstieg erwarten uns. Doch die Wegführung ist fuß- und wadenfreundlich, die
Wegewarte haben bei der Auswahl des Weges berücksichtigt,
dass durch den Einbau von Serpentinen ein Gefälle
entschärft werden kann, eine Erkenntnis, die wir nicht überall auf der Strecke
verwirklicht sahen. Allerdings kann die schönste Wegführung die Tatsache nicht
aus der Welt schaffen, dass der
Höhenunterschied ins
Murgtal hinunter 700 m beträgt. Müde sind wir schon, als wir in das freundliche
Städtchen Forbach, natürlich stilbewusst über die längste gedeckte Holzbrücke
Deutschlands, einlaufen. Dass der Weg zum Naturfreundehaus noch einmal 2 km
beträgt, mit Aufstieg zur Marienkapelle, ist zwar unerfreulich, jedoch trösten
wir uns, dass am nächsten Morgen weniger Höhenmeter im Aufstieg zu überwinden
sein werden.
 Freundlicher Empfang
durch die Hütteneltern (Mutter und Tochter aus dem Erzgebirge), Schnitzel mit
Kartoffelsalat und einige Schnäpse auf das Wohl der Mutter, die heute Geburtstag
hat. Ab 20 Uhr sind wir allein im Haus, erst am nächsten Morgen werden wir zum
Bezahlen wieder begrüßt. Freundlicher Empfang
durch die Hütteneltern (Mutter und Tochter aus dem Erzgebirge), Schnitzel mit
Kartoffelsalat und einige Schnäpse auf das Wohl der Mutter, die heute Geburtstag
hat. Ab 20 Uhr sind wir allein im Haus, erst am nächsten Morgen werden wir zum
Bezahlen wieder begrüßt.
Nach improvisiertem
Frühstück aus Resten in der Selbstkocherküche treten wir die
dritte Etappe an:
Forbach
- Badener Höhe - Unterstmatt -
Ochsenstall,
25 km, 800 m Aufstieg, 350 m Abstieg; Übernachtung im Wanderheim
Ochsenstall
(Tel. 07226 - 920911).
Stetig geht es bergan –wie immer
auf Schotterwegen - zur Schwarzenbach-Talsperre und an ihr entlang nach Westen
zum Seebachtal, aus diesem heraus mit heftigem Aufstieg zum Seekopf, unterwegs
den Herrenwieser See passierend, einen der vielen Karseen, die wir auf dem Weg
nach Süden sehen werden. Die Nebel, die anfangs noch um die Vorherrschaft
kämpften, haben sich aufgelöst, strahlender Sonnenschein begleitet uns.
Am Zweiseenblick ist
der Aufstieg geschafft, es geht auf angenehmen Fußpfaden, vorbei am Denkmal für
Philipp Bussemer, dem Schöpfer des Westweges, Richtung Badener Höhe mit dem
Großherzog-Friedrich-Turm, an dessen Fuß in 1000 m Höhe eine größere Pause
angesagt ist.
Gemeinsam mit drei
weiteren Westwegwanderern, darunter einem älteren Herrn, der von mehrfachen
Jakobswegerfahrungen in Spanien erzählt, werden am schönen Rastplatz mit Tisch
und Bänken Essen und Trinken herausgeholt - Wasser, Vollkornbrot in der
praktischen Frischhaltebox sowie ein Stück Edelsalami (Aldi) und ein Paar
Landjäger.
 Auf der Hochfläche der
Badener Höhe begegnen wir zum ersten Mal der Waldzerstörung, wie sie uns immer
wieder begegnen wird bis zur Alexanderschanze, weite Kahlflächen als Folge von
Sturm „Lothar“ und dem
Waldsterben infolge des sauren Regens, der von Westen kommend auf die Höhenzüge
des Nordschwarz-waldes trifft. Ein gespenstischer Anblick. Auf der Hochfläche der
Badener Höhe begegnen wir zum ersten Mal der Waldzerstörung, wie sie uns immer
wieder begegnen wird bis zur Alexanderschanze, weite Kahlflächen als Folge von
Sturm „Lothar“ und dem
Waldsterben infolge des sauren Regens, der von Westen kommend auf die Höhenzüge
des Nordschwarz-waldes trifft. Ein gespenstischer Anblick.
Weit schweift der
Blick hinüber zur Hornisgrinde mit Fernsehturm, Windrädern, Fernmeldeturm und
Aussichtstürmen, wir werden am nächsten Tag den höchsten Berg des
Nordschwarzwaldes erklimmen. Auf breiten, z.T. sandigen Forstwegen erreichen
wir vorbei am Naturfreundehaus Badener Höhe - sicher eine gute
Übernachtungsmöglichkeit - beim Sand die Schwarzwaldhochstraße, an der entlang
wir am nächsten Tag bis Alexanderschanze wandern werden.
Wir treten ein in eine
Landschaft, die aufgrund ihrer grandiosen Fernsichten in die westliche
Vorbergzone des Schwarzwaldes, die Rheinebene, die Vogesen und den Pfälzer Wald
sowie nach Osten auf die Buntsandsteinhochflächen um Freudenstadt immer wieder
zum Verweilen und Schauen anregt.
Zugleich ist die
Strecke ein Paradebeispiel für die Nutzung der Natur für Zwecke des
Wintersportes und des Ausflugsverkehrs, bei der die natürlichen Gegebenheiten
bis zur Unkenntlichkeit verändert werden, um den eher reduzierten Bedarf der
Urlauber an wirklichem Kontakt mit der Natur zu befriedigen – also breite
Skiabfahrten mit Liften, Spazierwege, die entweder breiten Schotterwegen folgen
oder aber, wo Fußpfade angelegt sind, mit Feinschotter aufgefüllt sicherstellen,
dass der Besucher weder nasse Füße noch schmutzige Schuhe bekommt.
Der Wanderweg folgt,
bis auf die löbliche Ausnahme Hochkopf und Anstieg zum Wanderheim Ochsenstall,
durchgehend breitesten Forststraßen, die sich entlang der Schwarzwaldhochstraße
über kahle Hänge ziehen, der Sonne ausgesetzt, ohne Wasserstellen und überzogen
vom Lärm der Motorradfahrer, die vor allem an den Wochenenden die Straße mit
einer Rennstrecke verwechselnd röhrend ihren Sound in den Bergen erschallen
lassen.
 Da diese Art von
Freizeitbeschäftigung einen durchaus ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor für das
notleidende Beherbergungsgewerbe der Schwarzwaldhochstraße darstellt - man
findet häufiger Hinweise an Gasthöfen mit „Bikers welcome“ als solche, die
Wanderer ausdrücklich willkommen heißen - kann der Wanderer nur die Ohren
anlegen und versuchen, diese unwirtlichen Stätten so schnell wie möglich hinter
sich zu lassen. Da diese Art von
Freizeitbeschäftigung einen durchaus ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor für das
notleidende Beherbergungsgewerbe der Schwarzwaldhochstraße darstellt - man
findet häufiger Hinweise an Gasthöfen mit „Bikers welcome“ als solche, die
Wanderer ausdrücklich willkommen heißen - kann der Wanderer nur die Ohren
anlegen und versuchen, diese unwirtlichen Stätten so schnell wie möglich hinter
sich zu lassen.
Ich schlage vor, ab
Unterstmatt den öffentlichen Bus bis Alexanderschanze zu nehmen, vielleicht
unterwegs am Ruhestein auszusteigen, den Sessellift auf den Seekopf zu nehmen,
von der Bergstation auf garantiert trockenen Wegen zum Wildseeblick zu laufen
und wieder zurück, anschließend das Informationszentrum des Naturparks
Schwarzwald Mitte Nord am Ruhestein zu besuchen um sich über den Schutz der
Naturlandschaft zu informieren, wie er von den Mitarbeitern des Naturparks
praktiziert wird.
Zunächst aber
erreichen wir in steilem Aufstieg über Wurzeln und Betonstufen das Wanderheim
Ochsenstall, kurz unterhalb der Hornisgrinde. Wieder sind wir die einzigen
Übernachtungsgäste, das Gastwirtsehepaar schließt um 18 Uhr die Küche und
verlässt das Haus gegen 19 Uhr. Wir haben das Haus für uns alleine.
Der folgende
vierte Tag
führt uns entlang der Schwarzwaldhochstraße über den „Grinden-Schwarzwald“,
baumlose Höhen als Ergebnis von Beweidung und Moorbildung von der
Hornisgrinde über Ruhestein,
Schliffkopf, Zuflucht zur
Alexanderschanze:
26 km, 420 m Aufstieg, 500 m Abstieg. Übernachtung Naturfreundehaus Kniebis
(Tel.: 07442 - 3294).
Die Überquerung des
Gipfelplateaus der Hornisgrinde zeigt uns alle denkbaren Nutzungen eines hohen
Berges im Schwarzwald: Ein 200 m hoher Fernsehturm, drei Windräder, zwei
Aussichtstürme, ein Fernmeldemast, ein Kinderspielplatz, eine Vesperstube, eine
Bushaltestelle, eine Bergwachthütte, Bauten aus der Zeit der französischen
Besetzung des Gipfels - heute leerstehend.
Wir umgehen den Rummel um den
Mummelsee und wählen den direkten Abstieg zum Seibelseckle - hier natürlich auch
Skipiste, Parkplatz und Skilift sowie Vesperstube. Es folgt eine körperlich und
seelisch zermürbende Strecke auf breitem Forstweg durch eine apokalyptische
Waldlandschaft - vorbei am Lothar-Denkmal, das an den verheerenden Sturm von
1999 erinnert. Bei der Darmstädter Hütte betreten wir ein Hochmoorgebiet, das
sich bis zum Ruhestein erstreckt. Vorbei am Wildseeblick, durch eine
gespenstische Landschaft von Baumleichen erreichen wir die Bergstation des
Ruhestein-Sesselliftes. Jetzt verstehen wir auch die deutliche Zunahme von
Rentnern auf den letzten zwei Wegkilometern: Auf- und Abstiegshilfen machen es
möglich, trockenen Fußes bis zur Darmstädter Hütte zu laufen, wo schon
Schwarzwälder Kirschtorte zur Stärkung für den Rückweg wartet.
Den Ruhestein mit
seinem Informationszentrum des Naturparks Schwarzwald Mitte Nord lassen wir
schnell hinter uns, überwinden einen robusten Anstieg auf die Höhe des
Schweinkopfes. Der Weg führt angenehm weiter über moorige Höhen zum Schliffkopf,
auf dessen Gipfel wir zu Füßen des Denkmals für die Gefallenen des Schwäbischen
Schneeschuhverbandes rasten. Vorbei am hochpreisigen Schliffkopfhotel und in
Hörweite der Bundesstraße 500 verlassen wir den Schliffkopf um die letzte Etappe
bis zur Alexanderschanze anzutreten, ein Wegstück, dass wegen seiner Wegführung,
seiner Wegequalität und seiner fehlenden, bzw. völlig unzulänglichen
Einkehrmöglichkeiten zu einer schweißtreibenden Angelegenheit wird. Das
ehemalige Hotel Zuflucht, heute Jugendherberge, steht laut deutlichem
Hinweisschild nur Gästen der Jugendherberge offen, am Hotel Alexanderschanze ist
der Eingang mit einem Absperrband verbarrikadiert. Wir lassen uns nicht
abschrecken, klopfen den Wirt heraus und bestellen ein Bier. Gott sei Dank fährt
um 17.10 Uhr der Bus nach Kniebis ab, wo wir erschöpft das Naturfreundehaus
aufsuchen, freundlicher Empfang, solides Abendessen und lange Gespräche mit
anderen Gästen.
Am folgenden
fünften Tag
verlassen wir das Reich von Waldzerstörung, Riesenparkplätzen und
Forstautobahnen und wandern
von Kniebis
zum
Brandenkopf:
25 km, Aufstieg 450 m, Abstieg 350 m, Übernachtung im Wanderheim Brandenkopf
(Tel.:07831-6149).
Der Weg bietet immer
wieder grandiose Fernsichten vor allem ins Renchtal, nach SW auf Mooskopf und
Brandenkopf sowie in das obere Wolftal im Osten. Einziger Wermutstropfen an
diesem Tag ist ein Abstieg von der Höhe See-Ebene beim Glaswaldsee hinunter zum
Freiersbergsattel, Höhendifferenz 210 m auf einem schnurgeraden Grobschotterweg
steil abwärts. Zwei älteren Personen, die am Fuß dieses „Büßerweges“ nach dem
Weg zum Glaswaldsee fragen, raten wir dringend von dem Aufstieg ab, diese
Strecke ist nur für Hochleistungssportler geeignet.
Sonnenschein, wunderschöne
Landschaftsausblicke und ein sanft auf– und absteigender restlicher Weg lassen
uns beschwingt den Harkhof erreichen. Wir machen eine kurze Vesperpause, mitten
im Trubel von Tagesausflüglern, Fernreitern, Motorradfahrern und Spaziergängern
- das Gasthaus mit angeschlossenem Bauernhof ist über eine schmale Teerstraße
vom Harmersbacher Tal erreichbar. Der Kampf um Plätze an den Biertischen im
Garten ist hart, nach drei Anläufen dürfen wir uns zu einem einzelnen Herrn an
den Biertisch hinzusetzen, nachdem er sein Getränk, das er zum Wärmen in die
Sonne gestellt hatte, an sich genommen hat – so Platz schaffend weitere zwei
Personen an seinem Sechsertisch. Die Bedienung war jedoch flink und freundlich,
so dass wir nach kurzer Zeit diesen Ballungsort verlassen konnten. 200 m
Aufstieg zum Wanderheim auf den Brandenkopf stellten eine beachtliche
Schlussherausforderung dar. Keuchend und schwitzend erreichen wir das Tagesziel,
umgeben von Schweizer Motorradfreunden und einer Kleinbus-Wandergruppe aus dem
Schwäbischen.
Der
sechste Tag sah uns auf dem
Weg vom
Brandenkopf über Hausach zum Karlstein: 24 km, 780 m Abstieg, 1000 m
Aufstieg. Übernachtung auf dem Bauernhof der Familie Kaltenbach in
Hinterhauenstein (Tel.:07833-354).
Die Querung des
Kinzigtales wird in der Literatur über den Westweg als besonders eindrucksvoll
geschildert, insbesondere der Aufstieg von Hausach auf den Farrenkopf (789 m).
Nach vollbrachter Tat wurde dies begreiflich: Der Weg führt ab dem Haseneckle
die letzten 300 Höhenmeter auf einem Schleifweg in der Falllinie den Berg
hinauf, so als wären alle Kenntnisse über die Wegführung in steilem Gelände noch
nicht bis ins Kinzigtal gedrungen. Ärgerlich auch, weil die Mühe des Anstiegs
nicht etwa durch eine grandiose Rundumsicht auf die Täler und Berge belohnt
würde: lediglich eine schmale Sichtschneise Richtung Gutach ist der Mühe Lohn.
Ab Haseneckle bietet
sich eine wunderschöne Ausweichstrecke direkt zum Büchereck an unter Umgehung
des unsinnigen Aufstiegs auf den Farrenkopf. Das Prinzip der Falllinie für die
Anlage von Wanderwegen ist allerdings, wie wir bald erfahren konnten, beileibe
nicht auf den Anstieg zum Farrenkopf beschränkt: Munter ging es den restlichen
Tag weiter in der Falllinie bergauf, bergab. Als topographisch-historische
Begründung mag die Tatsache gelten, dass dieser Weg der alten Schanzenlinie auf
den Höhen zwischen Elztal und Gutachtal folgt; das Wegenetz diente schließlich
nicht der Erbauung, sondern der kürzest möglichen Verständigung zwischen zwei
Schanzen.
 Man muss uns die
Erschöpfung angesehen haben, denn unterwegs trafen wir auf Spaziergänger, die
uns tröstend zuriefen, wir sollten nur durchhalten, bald würden wir auf eine
Waldwirtschaft der Kolpingfamilie Hornberg treffen, wo wir uns mit Wurst und
Bier stärken könnten. Und tatsächlich, kurz vor der Hirschlachschanze waren
Tische und Bänke vor einer Hütte über den Weg gestellt, frohe Lieder schallten
durch den Wald. Wir wurden freudig von den Kolpingjüngern begrüßt und schnell
mit dem gewünschten Bier versorgt. Gemeinsam sangen wir zur Gitarrenbegleitung
einige altbekannte Wanderlieder, wie z.B. „Mein Vater war ein Wandersmann“, oder
„Das Wandern ist des Müllers Lust“. Nur zu bald mussten wir uns von diesem
angenehmen Ort trennen, nicht ohne das Liederbuch zu kaufen, das die Grundlage
des fröhlichen Gesanges gebildet hatte. Man muss uns die
Erschöpfung angesehen haben, denn unterwegs trafen wir auf Spaziergänger, die
uns tröstend zuriefen, wir sollten nur durchhalten, bald würden wir auf eine
Waldwirtschaft der Kolpingfamilie Hornberg treffen, wo wir uns mit Wurst und
Bier stärken könnten. Und tatsächlich, kurz vor der Hirschlachschanze waren
Tische und Bänke vor einer Hütte über den Weg gestellt, frohe Lieder schallten
durch den Wald. Wir wurden freudig von den Kolpingjüngern begrüßt und schnell
mit dem gewünschten Bier versorgt. Gemeinsam sangen wir zur Gitarrenbegleitung
einige altbekannte Wanderlieder, wie z.B. „Mein Vater war ein Wandersmann“, oder
„Das Wandern ist des Müllers Lust“. Nur zu bald mussten wir uns von diesem
angenehmen Ort trennen, nicht ohne das Liederbuch zu kaufen, das die Grundlage
des fröhlichen Gesanges gebildet hatte.
Nach einem letzten
heftigen Anstieg zum Karlstein erreichten wir unser Etappenziel, den Bauernhof
der Familie Kaltenbach in Hinterhauenstein, wo eine große Metzgete des Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverbandes gerade zu Ende ging. Wir profitierten davon
in Form von Blut– und Leberwurst mit Sauerkraut und Brot. Bald sanken wir müde
in die Betten.
Wie schon in den
letzten Tagen angekündigt, zogen am Morgen der
siebten Etappe
düstere Wolken von Westen heran, das gute Wetter verschwand gegen Osten. Wir
machten uns auf den Weg vom
Karlstein zum
Ortsteil Raben
(Furtwangen):
22 km, Aufstieg 200 m, Abstieg 200 m, Übernachtung im Hotel Goldener Rabe
(Tel.:07723– 7397).
Ohne große
Höhenunterschiede, auf sehr abwechslungsreichen Wegen ging es über die weite
Hochfläche oberhalb von Schonach, im Schnittpunkt von Rhein- und Donausystem,
vorbei an den Quellen von Elz (zum Rhein und zur Nordsee) und Breg (zur Donau
und zum Schwarzen Meer). Den Formen der nach Osten gerichteten Täler sieht man
an, dass die Bäche einen weiten Weg vor sich haben. Sie können sich mit der
Abtragung Zeit lassen. Sanft geschwungen sind die Talhänge, ideales Gelände für
nordische Skiathleten, deren Hochburgen folgerichtig um Brend und Rohrhardsberg
zu finden sind.
Nachdem wir den
heimelig wirkenden Gasthof Wilhelmshöhe nach einer kurzen Aufwärm-Einkehr
verlassen haben, beginnt der Regen, in dieser Höhenlage von 1000 m mit Nebel
verbunden. Jetzt muss unser Regenschutz zeigen, was er kann. Von außen bleiben
wir trocken, von innen sind Hose und Hemd total nass, vom Schweiß. Da muss
nachgebessert werden.
Im Gasthaus
Martinskapelle finden wir Wärme, Speis‘ und Trank. Nur ungern verlassen wir das
gemütliche Wirtshaus, aber der Weg ruft, über den Brend - im Nebel nichts zu
sehen - erreichen wir heftig durchnässt –wie gesagt von innen - unser Tagesziel,
das Hotel „Goldener Rabe“ oberhalb von Furtwangen, ein Haus, das seine besseren
Tage schon hinter sich hat. Das Wichtigste scheint in dieser Herberge, noch vor
allem Ankommen, das Ausfüllen des Meldescheins, was ich mit nassen Händen und
klammen Fingern hinter mich bringe. Da es noch früh am Nachmittag ist, haben wir
genügend Zeit den Charme dieses Goldenen Rabens auf uns wirken zu lassen. Wir
sind froh, dass uns am nächsten Tag nichts übrig bleibt, als weiter zu wandern,
trotz fortgesetzten Regens.
Die
achte Etappe soll von
Raben
bis
Berghäusle,
oberhalb von Hinterzarten, führen: 23 km, 320 m Aufstieg, 200 m Abstieg,
Übernachtung im Wanderheim Berghäusle (Tel.:07652 982065)
Wir trotten ohne viele Worte
durch den Regen, konzentrieren unsere Kräfte darauf, das Zwischenziel Gasthaus
„Kalte Herberge“ zu erreichen, wo wir gegen 11 Uhr ankommen. Hier treffen wir
auf das Schwarzwälder Ruhetags-Phänomen: Am Dienstag geschlossen. Am gleichen
Tag sollte ich noch einmal Opfer dieses Phänomens werden - am Feldberg. Man kann
sich leicht vorstellen, mit welcher Freude wir den weiteren Weg angegangen sind,
noch fast 10 km bis zum Thurner.
 Unterwegs teilte mir mein
Wanderkamerad mit, dass er am Thurner aufhören und aussteigen werde. Die
Motivation ist auf dem Nullpunkt angekommen. Nun denn. Unterwegs teilte mir mein
Wanderkamerad mit, dass er am Thurner aufhören und aussteigen werde. Die
Motivation ist auf dem Nullpunkt angekommen. Nun denn.
Der Wanderweg zwischen Neueck
und Thurner teilt sich, der Topographie wegen, notgedrungen den Platz mit der
Bundesstraße 500, die als Verlängerung der Schwarzwalhochstraße von Furtwangen
nach Hinterzarten führt. Angesichts von Wochentag und Regen hält sich der
Verkehr und damit der Lärm auf dieser Straße in Grenzen. Die Wegewarte des
Schwarzwaldvereins, die für dieses Wegstück verantwortlich zeichnen, haben gute
Arbeit geleistet, immer wieder entfernt sich der Weg von der Straße, sucht
Punkte auf, an denen durch den Nebel herrliche Aussichten sowohl zum Feldberg
und Kandel hin wie nach Osten in die Täler um Neustadt zu ahnen sind.
Gegen 14 Uhr sind wir
am Thurner, ein Bus fährt von hier nach Hinterzarten. Verabschiedung, den Rest
des Tages mit dem Regen allein. Ich ändere das Programm: Statt zum Berghäusle
laufe ich nach Titisee, über die Weißtannenhöhe zum Rastplatz Fürsatzhöhe. Hier
findet sich auf der langen Etappe von Furtwangen die erste Schutzhütte,
allerdings wild mit Grafitti verziert. Der Weg hinunter zur Fürsatzhöhe ist ein
besonders schlimmes Beispiel für Forststraßenbau - über 2 km geht es abwärts auf
einem frisch mit Grobschotter aufgefüllten Forstweg, angesichts der Wölbung der
Oberfläche und der tiefen Seitengräben und aufwändigen Entwässerungsbauten weiß
man überhaupt nicht, wie man ohne Sturz dieses Wegstück bewältigen soll.
Am Wanderheim des
Schwarzwaldvereins „Berghäusle“ vorbei führt der Weg, die letzten Kilometer auf
Asphalt, nach Titisee. Durch die Massen von Tagestouristen, zwischen
Andenkengeschäften und Schnellverpflegungsstationen hindurch, umgeben von einem
Wirrwarr der unterschiedlichsten Sprachen, Geräusche und Gerüche, erreiche ich
den Bahnhof, wo gerade ein Bus zur Abfahrt zum Feldberg bereit steht.
Alle Prinzipien
hintanstellend nehme ich den Bus und lasse mich zum Feldbergpass fahren, in der
Hoffnung dort oben Quartier in der Emmendinger Hütte finden zu können -
Fehlanzeige, wie sich herausstellte: geschlossen. Auch die anderen Unterkünfte
auf der Passhöhe haben geschlossen, offensichtlich wird hier während der
Skisaison genug verdient. Also den nächsten Bus ins Tal und am nächsten Tag
wieder hoch.
Der
neunte Tag soll mich,
verstärkt um einen neuen Wanderkameraden,
vom Feldberg zum
Belchen
führen: 24 km, 300 Aufstieg, 600 m Abstieg, Übernachtung im Gasthaus Hotel
Jägerstüble in Multen (Tel.: 07673-7255).
Das gute Wetter ist
zurückgekehrt, allerdings nur bis zur Mittagszeit, dann gewinnen die Nebel und
Wolken aus dem Rheintal die Oberhand. Leichten Fußes wandern wir entlang der
Südhänge des Feldbergs über den Stübenwasen, einen langgezogenen Höhenrücken im
Höhenbereich 1300m Richtung Notschrei. Unterwegs phantastische Fernsichten ins
obere Wiesental, ins Dreisamtal, zum Schauinsland und nach Osten zum
Herzogenhorn. Wie gut, dass heute die Nebel gewichen sind. Was wäre dieser Weg
ohne die Aussicht!
Die Strapazen des
vorangegangenen Tages verlangen nach Ausgleich, also machen wir an jedem
Gasthaus halt und stärken uns, sei es zum zweiten Frühstück (Gasthaus
Stübenwasen), zum Mittagessen (Hotel Notschrei) oder zum Nachmittagstee (Hotel
Wiedener Eck). Zusammen mit dem Hotel Jägerstüble in Obermulten, am Fuß des
Belchens, das unser Etappenziel ist, haben wir so im Laufe des Tages einen guten
Überblick über die Leistungsfähigkeit des Gastronomie in diesem Teil des
Schwarzwaldes gewinnen können, das Urteil lautet: vorzüglich! Die Qualität der
Verpflegungsstationen korrespondiert auf das Erfreulichste mit der Qualität der
durchwanderten Landschaft und der vorzüglichen Wegeführung - endlich überwiegen
die schmalen Fußwege, die weichen, den Sohlen schmeichelnden moosigen Pfade.
Leider übernehmen am
Nachmittag wieder die Nebel aus dem Rheintal die Macht, wir laufen durch
nebligen Wald, über weite Weidflächen, ahnen die dort weidenden Rinder, und
freuen uns auf die Ankunft in Multen. Dass das Hotel Jägerstüble über ein
Wohlfühl-Hallenbad verfügt, macht den letzten Abend der Wanderung zu einem
wahren Entspannungsvergnügen, nach all den Strapazen.
Den Abend verbringen
wir im Gespräch mit einem Bremer Ehepaar, das zur gleichen Zeit den Weg von
Pforzheim aus gelaufen ist - der Westweg verbindet.
Die
zehnte Etappe soll uns vom
Belchen
nach Hause führen,
nach Steinen im
Wiesental,
28 km, 1000 m Abstieg, 250 m Aufstieg.
Am Morgen nehmen wir
bei strahlendem Sonnenschein die Gondelbahn zum Belchenhaus und genießen die
phantastische Fernsicht rings über den Südschwarzwald. Rheintal, Vogesen und
Alpen liegen im Dunst, das Wetter ist noch nicht stabil.
 Am Hohkelchsattel beginnt der
Abstieg, der uns in verschiedenen Etappen über 1000 Meter nach unten führen wird
- am Ende des Tages werden unsere Knie und Waden die entsprechende Rückmeldung
geben. Am Hohkelchsattel beginnt der
Abstieg, der uns in verschiedenen Etappen über 1000 Meter nach unten führen wird
- am Ende des Tages werden unsere Knie und Waden die entsprechende Rückmeldung
geben.
Nach dem gestrigen
Schlemmertag ist Diät angesagt. Studentenfutter, Schokolade und Quellwasser
erfreuen heute unseren Gaumen. Es geht auch.
Als wir gegen 13 Uhr
am Platz Stühle (1043 m) Mittagsrast machen - die Schutzhütte mit ihren Bänken
und Tischen ist leider unsäglich mit menschlichen Exkrementen beschmiert -,
zeigt der Wegweiser noch 20,2 km bis Steinen. Ob wir das wohl schaffen? Wir
versuchen so weit wie möglich zu kommen. Vom Westweg nehmen wir hier Abschied,
er führt weiter nach Westen über den Blauen nach Kandern und Basel.
Wir ziehen nach Süden
über die Höhenrücken zum Lipple mit vorzüglicher Quelle, weiter über Hohe
Stückbäume und Endenburg zur Passhöhe Scheideck (541 m), die wir gegen 17 Uhr
erreichen. Den Gedenkstein für die gefallenen Soldaten der Schlacht von 1848
anlässlich der badischen Revolution nehmen wir nur beiläufig wahr, unser Streben
geht heimwärts.
Auf den wohlbekannten
Forststraßen, wieder auf Buntsandstein, laufen die Füße fast wie von selbst,
lediglich die Schmerzen in den Füßen und im Rücken erinnern daran, dass über 200
km Wegstrecke hinter mir liegen.
Gegen 18 Uhr werden
wir in Hägelberg (457 m) oberhalb von Steinen abgeholt. Geschafft.
 Fazit: Fazit:
Die Strecke ist eine
beeindruckende Herausforderung für Gehwerkzeuge und Motivation. Als Fußwanderung
empfehle ich den Weg ab Alexanderschanze, oder, wie es die Schwarzwald-Tourismus
GmbH als Teilstrecke (mit Gepäcktransport) anbietet, ab Hausach. Die Strecke von
Pforzheim bis Alexanderschanze überlässt man besser den Radfahrern.
Besonders positiv in
Erinnerung bleiben die Begegnungen mit Menschen, die sich ebenfalls auf den Weg
gemacht haben - und die überwältigend schönen Landschaftsbilder.
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
23 - August 2007

Dieser Beitrag ist erschienen in der Zeitschrift des Schwarzwaldvereins und wird
hier mit freundlicher Genehmigung des Verfassers und des Schwarzwaldvereins
noch einmal abgedruckt.
Die Qualitätsoffensive
Westweg hat den bekanntesten Fernwanderweg des Schwarzwaldvereins deutlich
verändert. Die Grösselbach�Furt (Trittsteine), das Schloss Neuenbürg, der Hohloh�See
und die Weißtannenhöhe liegen jetzt direkt am Westweg. Dies sind nur einige
wenige Beispiele für die Streckenveränderungen, die den Westweg für Wanderer
attraktiver machen.
Mehr als zwei Jahre
war der Schwarzwaldverein damit beschäftigt, für die weniger attraktiven
Strecken des Westweges neue Alternativen zu finden, Maßstab waren dabei die
Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbandes für Wanderwege (vgl.: DER
SCHWARZWALD 1/2006). Die Mühe hat sich gelohnt. Im Januar 2007 hat der Westweg
auf der Reisemesse CMT in Stuttgart das Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares
Deutschland“ erhalten (www.wanderbares-deutschland.de).
Auf fast allen Etappen
hat es im Jahre 2006 zum Teil deutliche Streckenänderungen gegeben, und auch in
diesem Jahr werden noch weitere Veränderungen durchgeführt. Am wichtigsten ist
wohl die Verlegung des Trennungspunktes der östlichen und der westlichen
Variante nach Titisee .... Doch halt: Immer hübsch der Reihe nach. Hier nun �
von Nord nach Süd � eine Übersicht über die wichtigsten Streckenverlegungen:
Pforzheim
Der Kupferhammer ist
und bleibt der Startpunkt des Westweges. Seit Herbst 2006 jedoch beginnt er als
schmaler Pfad durch den Laubwald. Damit erfüllt der Westweg bereits auf den
ersten Metern die Erwartungen der Wanderer an einen Prädikatswanderweg. Zum
Vergleich: Vorher musste der Wanderer zunächst die vielbefahrene Bundesstraße
überqueren und dann kilometerlang auf Asphalt laufen. Der Westweg folgt nun auf
den ersten Kilometern bis zur Ruine Hoheneck dem Mittelweg und führt dann über
die Höhen des Hämmerlesberges nach Dillstein hinab.
Neuenbürg
 Ab dem Unteren Enzsteg
begleitet der Westweg die Enz flussaufwärts bis nach Neuenbürg. Ein großer Teil
dieser neuen Strecke verläuft auf naturbelassenen, pfadigen Wegen. Über den
Grösselbach gelangt der Wanderer mit Hilfe von Trittsteinen, wie man sie sonst
nur aus südlichen Ländern kennt. Ab dem Unteren Enzsteg
begleitet der Westweg die Enz flussaufwärts bis nach Neuenbürg. Ein großer Teil
dieser neuen Strecke verläuft auf naturbelassenen, pfadigen Wegen. Über den
Grösselbach gelangt der Wanderer mit Hilfe von Trittsteinen, wie man sie sonst
nur aus südlichen Ländern kennt.
Auf dem anschließenden
Pionierweg geht es immer dicht an der klaren Enz entlang bis zur Eisenbahnbrücke
Neuenbürg. Von dort folgt ein Anstieg bis zum Schloss, dem ersten kulturellen
Höhepunkt am Westweg. Am Buchberg schließlich mündet der neue Westweg wieder auf
die bekannte Strecke ein. Der bisherige Westweg vom Unteren Enzsteg über
Birkenfeld und Neuenbürg�Wilhelmshöhe bleibt als sogenannte Höhenvariante für
den Wanderer ebenfalls mit der roten Raute ausgeschildert.
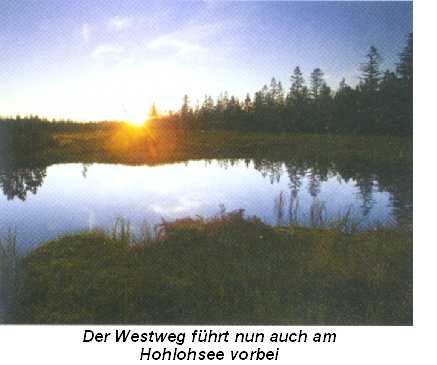 Kaltenbronn Kaltenbronn
Der Kaltenbronn ist
schwieriges Terrain für eine Alternativensuche, sind doch die Wege dort breit
und gut ausgebaut. Trotzdem konnte eine Strecke gefunden werden, die etwas
naturnahere Wege benutzt und zugleich die attraktivsten Stellen des Kaltenbronn
einbindet. Zwischen Langsmartskopf�Hütte und Kreuzlehütte verläuft der Weg
anstatt auf der breiten und häufig von Holztransportern befahrenen Alten
Weinstraße nun am Rand zum Murgtal. Und
durch den Schlenker
zum Infozentrum Kaltenbronn und dem dortigen Gasthaus kommt der Wanderer auch
noch am Hohloh�See vorbei.
Weißtannenhöhe
Die Weißtannenhöhe
oberhalb von Breitnau ist beliebtes Wanderziel der örtlichen Gäste. Von dort hat
man einen hübschen Blick auf Breitnau und zum Feldberg. Seit Sommer 2006
verläuft der Westweg direkt über die Höhe und nutzt dabei überwiegend die bei
Wanderern so beliebten naturbelassenen Pfade.
Trennungspunkt Titisee
Die wichtigste
Änderung für den Westweg ist die Verlegung des Trennungspunktes der östlichen
und westlichen Variante nach Titisee. Auf der westlichen Variante steigt der
Westweg�Wanderer nun zunächst über den Höhenrücken zwischen Titisee und
Hinterzarten bis nach Oberzarten. Dort beginnt mit dem so genannten
Emil�Thoma�Weg einer der schönsten Anstiege auf den Feldberg. Im oberen Teil
führt der Weg ab dem Rufenholzplatz auf schmalen Pfaden, die mit Baumwurzeln und
Steinen durchsetzt sind, zum Grüblesattel zwischen Seebuck und Feldberg hinauf,
wo er wieder auf die bisherige Strecke trifft. Durch die neue Streckenführung
bleibt der Westweg�Wanderer vom touristischen Rummel am Feldberger Hof
verschont. Denn auch die östliche Variante, die von Titisee der bisherigen
Strecke über Bärental und Zweiseenblick zum Caritashaus folgt, bleibt ab dem
Caritashaus südlich der Bundesstraße und führt über die Menzenschwander Hütte
und den Feldberg�Pass direkt in Richtung Herzogenhorn.
Östliche Variante: Herzogenhorn
Den Gipfel des
Herzogenhorns berührt der Westweg auch nach der Verlegung noch immer nicht. Aber
anstatt auf breitem Forstweg um den Gipfel herum zu laufen, kann der Wanderer
nun von der Schwedenschanze in nur 50 Höhenmetern und 300 Metern Wegstrecke den
Gipfel erklimmen.
Westliche Variante: Kandern
Südlich von Kandern
erwartet den Westweg-Wanderer nun ein landschaftliches Glanzlicht: die enge
Wolfsschlucht. Der Weg verläuft auf schmalen, teils ausgesetzten Pfaden bis nach
Hammerstein. Von dort geht es über Egerten und die Baselblickhütte nach
Wollbach. Sämtliche oben aufgeführten Streckenverlegungen konnte der
Schwarzwaldverein gemeinsam mit den Gemeinden im Jahr 2006 realisieren. Hinter
jeder Einzelmaßnahme stehen viele Stunden ehrenamtliches Engagement. Allen
Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Für das Jahr 2007 stehen noch
weitere Wegeverbesserungen an, beispielsweise in Dobel, Forbach, Hausach, am
Weißenbachsattel und am Dinkelberg. Am Westweg gibt es immer wieder etwas Neues
zu entdecken. Lassen Sie sich verführen von einem der schönsten Wanderwege
Deutschlands.
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
23 - August 2007
Wandern wo andere Rad fahren
Weitwanderwege auf Normal Null
Von Werner Hohn
- Wandern in Norddeutschland? Hast du kein Rad? - so die ersten Reaktionen
meiner Kollegen. Meine Frau war von der Idee begeistert. Endlich mal eine
Wanderung ohne Höhenmeter, denn die mag sie überhaupt nicht. Ein Novum für mich
als Wanderer: In den Wanderkarten findet sich vor vielen Höhenangeben ein
Minuszeichen. Wandern unterm Meeresspiegel!
 Bis dahin
hatte ich das Norddeutsche Flachland nicht unbedingt mit Wandern in Verbindung
gebracht, mit Weitwandern erst recht nicht. Der Continental Divide Trail, der
quer durch die USA (Ostküste - Westküste) führt, hatte bei mit die Idee einer
Wanderung von Küste zu Küste in Deutschland ins Rollen gebracht. Bis zum
Nord-Ostsee-Wanderweg waren es dank Internet nur noch ein paar Klicks. Der ist
zwar einige Nummern kürzer, mehr aber gibt unser Land für eine direkte
Küste-zu-Küste Wanderung nicht her. Dafür ist solch ein Unternehmen für
Normalsterbliche realisierbar und muss nicht aus Zeitgründen bis zum irgendwann
anstehenden Ruhestand verschoben werden. Der Norddeutsche Wanderverband hat den
Weitwanderweg, der mitten durch Schleswig-Holstein führt, schon viele Jahre im
„Angebot“. Bis dahin
hatte ich das Norddeutsche Flachland nicht unbedingt mit Wandern in Verbindung
gebracht, mit Weitwandern erst recht nicht. Der Continental Divide Trail, der
quer durch die USA (Ostküste - Westküste) führt, hatte bei mit die Idee einer
Wanderung von Küste zu Küste in Deutschland ins Rollen gebracht. Bis zum
Nord-Ostsee-Wanderweg waren es dank Internet nur noch ein paar Klicks. Der ist
zwar einige Nummern kürzer, mehr aber gibt unser Land für eine direkte
Küste-zu-Küste Wanderung nicht her. Dafür ist solch ein Unternehmen für
Normalsterbliche realisierbar und muss nicht aus Zeitgründen bis zum irgendwann
anstehenden Ruhestand verschoben werden. Der Norddeutsche Wanderverband hat den
Weitwanderweg, der mitten durch Schleswig-Holstein führt, schon viele Jahre im
„Angebot“.
Im Herbst 2003 war es dann so weit. Zusammen mit meiner Frau ging es in vier
Tagen von Meldorf nach Kiel. Mit dem Westwind im Rücken, immer stur nach Osten.
Es war eine überraschend schöne und abwechslungsreiche Wanderung. Schiffe,
Moore, Hebewerke, eine fliegende Fähre und zum Abschluss dann doch noch ein paar
Hügel. Gewürzt wurde das alles mit einem steten Wind, der für frische Luft
sorgte. Der meist blaue Himmel, aufgelockert mit Schönwetterwolken, war gut für
die Stimmung.
Auch wenn ich es nicht an die große Glocke hänge: hin und wieder finde auch ich
Gefallen an einer Mehrtageswanderung ohne das „Abarbeiten“ von Höhenmetern.
Zwei Jahre später (Osterwochenende 2005) war es dann wieder so weit. Diesmal
sollte es der Ostfrieslandwanderweg sein, diesmal alleine. Der
Ostfrieslandwanderweg führt am ersten Tag an der Ems entlang und endet immerhin
an der Nordseeküste. Fehnsiedlungen, Hochmoore, Entwässerungskanäle sowie
Bauernhöfe die auf flachen, kaum wahrnehmbaren Aufschüttungen aus der
unendlichen Ebene ragen, bestimmen das Bild dieses Weges. Der überwiegende Teil
verläuft ab Aurich bis Bensersiel auf der Trasse einer ehemaligen
Kleinbahnstrecke - leider entgegen der Beschreibung, über weite Strecken
befestigt.
Es gibt Wanderungen die halten bereits bei der Planung einige Überraschungen
parat.. Bei beiden Touren in Norddeutschland sollte das der Fall sein. Bei der
in Ostfriesland war es dank Internet schon keine mehr - die Wanderkarten waren
die positive Überraschung.
Bei dem Weg quer durch Schleswig-Holstein rieben wir uns schon beim ersten Blick
in die Wanderkarten die Augen. Da haben die Kartographen bestimmt etwas
vergessen, vermuteten wir. Wenn auch bis zum ersten Wandertag die Hoffnung am
Leben blieb. Aber wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Auf die genaue Vorplanung wurde bei beiden Touren, bis auf die Beschaffung der
Wanderkarten, bewusst verzichtet. Das Wandern über mehrere Tage hat für uns auch
etwas mit einer kleinen Flucht aus dem verplanten Alltag zu tun. Als
Alleinwanderer oder zu zweit ist es meist kein Problem eine Unterkunft zu
finden. Allen Widrigkeiten wie: Großveranstaltungen und „Eigentlich sind wir
voll“ zum Trotz, für eine Nacht haben wir noch immer was gefunden. Wenn ich
alleine unterwegs bin, lege ich mich zum Übernachten (wenn es nicht anders geht)
auch schon mal in das Schutzhäuschen einer Bushaltestelle. Das fällt, wenn meine
Frau dabei ist, mit Sicherheit aus.
Nord-Ostsee-Wanderweg
- Mit
Rückenwind von Küste zu Küste
Dank Internet war die Beschaffung der nötigen Karten kein Problem. Überrascht
war ich über die Tatsache, dass es für diese Region Wanderkarten gibt. Mit
Radwegekarten hatte ich schon eher gerechnet.
Was sich schon beim Blick in die Karten gezeigt hatte, wurde vor Ort bestätigt:
Völlig unverständlich beginnt der Nord-Ostsee-Wanderweg in Meldorf und endet in
Kiel-Schulensee. Beides weitab vom Wasser. Die Kartographen hatten sich also
doch nicht geirrt. Aus verständlichen Gründen fangen viele Weitwanderwege in
Deutschland an einem Bahnhof an, oder sie enden da. Ganz klar, für Wanderer ist
das von Vorteil. Es gibt einige Wege, da sollte das nicht so sein, zumindest
sollte es eine Alternative geben. Der Nord-Ostsee-Wanderweg zählt mit Sicherheit
zu diesen Wegen. In diesem Fall verpflichtet der Name. Wir wollten jedenfalls
nicht von Meldorf (auch wenn es reizvoll ist) nach Kiel-Schulensee (weniger
reizvoll) gehen. Wir wollten von der Nordsee zur Ostsee gehen! Das haben wir
gemacht. Auch wenn es nur das Hafenbecken in Kiel geworden ist, Ostseewasser war
es allemal.
 1.
Tag: Meldorf (Hafen) - Albersburg 1.
Tag: Meldorf (Hafen) - Albersburg
Was tun, wenn der markierte Wanderweg nicht da anfängt wo man es gerne hätte?
Erst recht wenn der Anfang nicht da ist wo er unserer Meinung nach hingehört.
Das fragten wird uns, nachdem wir einen passablen Abstellplatz für das Auto
gefunden hatten. Wohlgemerkt in Meldorf und das liegt bekanntlich nicht an der
Nordsee. Jedenfalls nicht direkt. Die Entfernung zum Meer bot in früheren,
deichlosen Zeiten einen gewissen Schutz vor den Gewalten des Meeres. Das
Trockenlegen der Polder, verbunden mit den Eindeichungen, hat dafür gesorgt,
dass die beschauliche Kleinstadt im Westen von Schleswig-Holstein heute weiter
von der Küste entfernt ist denn je.
Am Strand (Deichkrone tut‘s auch) der Nordsee, so hatten wir uns vorgenommen,
wollten wir unsere Wanderung von Küste zu Küste starten. Das konnte nur eins
bedeuten: Ein Fahrt mit dem Taxi zum gut 7 Kilometer weiter westlich gelegenen
neuen Meldorfer Hafen.
Auf der Deichkrone, an der Schleuse, die den kleinen Fischer- und Freizeithafen
vor dem ewigen Kommen und Gehen der Gezeiten und wohl auch deren Hauptzweck, vor
den gewaltigen Kräften der Stürme schützt, konnte es endlich losgehen. Wie
gehofft mit Wind aus Westen. Wenn der die vier Tage anhält, so unser Kalkül,
gibt es Schiebewind bis zur Ostsee. Er sollte anhalten. Genau wie der
Sonnenschein. Der blaue Himmel. Das Fehlen von Regen. Kurz, goldener Oktober in
Norddeutschland. Ideale Wetterbedingungen für die Kiter auf den geschützten
Wasserflächen des Kronenlochs am Fuß des Deiches und für Wanderer auf dem Weg
nach Osten ebenfalls.
Bis Meldorf ging‘s über die so gut wie autoleere Straßen. Erst ab den ersten
Häusern am Stadtrand merkten wir die Nähe der Kleinstadt. In der fanden wir dann
auch die erste Markierung (gelber Keil mit der Spitze nach Osten). Schnell ein
Schlenker zum Auto, um die Rucksäcke zu holen und ohne Pause weiter nach Osten.
Mal fehlte die Wegmarkierung, mal verloren wir sie aus den Augen, mal wurde der
Weg verlegt (und wir gingen nach Wanderkarte auf dem alten Weg weiter). Egal,
mit Hilfe der Wanderkarten fanden wir immer wieder zum eigentlichen Weg zurück.
Meist ging es über Feld- und Wiesenwege durch die offene und dank klarem Wetter
weit einsehbaren Landschaft des Nordens. Unterbrochen wurde das alles nur von
wenigen kleinen Wäldern, Hecken und der unvermeidlichen Autobahn
(A 23) kurz vor Albersdorf.
Albersdorf, ein uns gänzlich unbekanntes Nest, irgendwo im Norden der Republik,
hat neben einigen Hügelgräbern eine Jugendherberge. Gründe genug, den ersten Tag
hier zu beenden. Da standen wir mal wieder ohne Voranmeldung vor der
verschlossenen Tür einer Jugendherberge in der Provinz. Die Klingel klingelte
sich einen Wolf, aber weder die Tür noch sonst jemand ließ sich davon
erweichen. Aber wir leben ja in modernen Zeiten. Handy raus, Nummer der JH
wählen, siehe da, es ging jemand ran. Wenig später war die Tür offen. Es gab mal
wieder den obligatorischen aber sehr freundlichen Anschiss betreffs
Voranmeldung. Wenigstens morgens anrufen! Man sei schließlich auf dem Land und
könne nicht den ganzen Tag auf eventuelle Gäste warten (unsere Methode hat bis
auf eine Ausnahme immer funktioniert), so die Herbergsmutter. Versehen mit Tipps
fürs Abendessen, dem Hinweis, dass wir die einzigen Gäste seien und dem
Schlüssel der Herberge, wurden wir ins Haus eingeladen. Was will man mehr?
2.
Tag: Albersburg - Rendsburg
Wenn wir auch die einzigen Gäste waren, am Frühstück hatte man es nicht gemerkt.
Wie immer, wenn wir in einer Jugendherberge übernachten, musste auch hier das
Frühstücksbüffet für den Tagesproviant herhalten - diesmal sogar mit
ausdrücklichem Zuspruch der Küchenfrau.
Welch eine Überraschung, draußen dichter Nebel. Nach einigem Umherirren fanden
wir dann doch noch den Weg in Richtung Nord-Ostsee-Kanal. Und welch eine
Enttäuschung für mich, der Schiffsverkehr war wegen dichtem Nebel eingestellt.
Dabei war genau der zu erwartende Verkehr auf dem Kanal einer der Gründe für die
Wahl dieser Strecke gewesen. Ein einsamer Motorsegler der mit kahlen Masten eine
Kanalfahrt versuchte, wurde durch lautstarkes Anpreien der Signalstation
gestoppt. Glücklicherweise schaffte es die Sonne schon weit vor Mittag den Nebel
zu vertreiben. Zum blauen Himmel gesellten sich nun endlich die heiß erwarteten
Frachtschiffe. Die Riesenpötte der weiten Ozeane können zwar nicht durch den
Kanal, aber auch so war es eindrucksvoll genug, wenn sich nur wenige Meter vor
unserer Nase die rote Stahlwand eines Frachters vorbei schob. Man war versucht
mal mit der Hand hinzulangen.
Um der Monotonie des Kanalwegs zu entfliehen, biegt der Nord-Ostsee-Wanderweg
nach Passieren der Gieselauschleuse kurz nach Norden ab und führt dann wieder
nach Osten durch das Hinterland, um kurz vor Rendsburg wieder auf den Kanal zu
treffen. Jetzt wo endlich Betrieb auf dem Wasser war, entschieden wir uns für
den direkten Weg nach Rendsburg, trotz langweiligem Uferweg. Die Monotonie des
Kanalweges wurde noch durch die in regelmäßigen Abständen stehenden Masten der
Kanalbeleuchtung verstärkt. In unserem Fall sorgten die Schiffe für eine
abwechslungsreiche Etappe.
Zusätzliche Unterhaltung boten einige Mitarbeiter des NDR. Kamerastellungen
wurden aufgebaut, Transparente angebracht und Ü-Wagen in Stellung gebracht. Am
nächsten Tag fand auf diesem Teilstück des Kanals eine traditionelle
Ruderregatta statt. Startpunkt Rendsburg, unser heutiges Etappenziel! Das war
dann auch der Zeitpunkt, an dem wir uns ernsthafte Gedanken um ein Bett für die
Nacht machten. Im ersten Hotel in der Stadt schienen sich unsere Befürchtungen
zu bestätigen. Laut Auskunft der Dame an der Rezeption wäre es aussichtslos an
dem Regattawochenende in Rendsburg ein Bett zu ergattern. Aber wie schon so oft,
ein freundlicher Taxifahrer hatte noch seinen Geheimtipp. Nur wenige Meter neben
dem ausgebuchten Hotel fand sich ein kleines Mittelklassehaus mit mehr als einem
freien Bett.
 3. Tag
Rendsburg - Westensee 3. Tag
Rendsburg - Westensee
Auch dieser Tag sollte mit Nebel beginnen (war schnell wieder weg). In der
Hoffnung auf dessen baldige Auflösung gingen wir runter zum Kanal. Hier hatte
man ein gar nicht so kleines „Fahrerlager“ für die Ruderer und die Zuschauer aus
dem Boden gestampft. Hektische Betriebsamkeit an allen Ecken. Wir wollten zur
Schwebefähre, dem technischen Höhepunkt dieser Wanderung. Nur an langen
Drahtseilen befestigt, die von der Eisenbahnbrücke herab hängen, überquert diese
Fähre den Kanal ohne Kontakt zum Wasser, und beschaffte uns das komische Gefühl
des weder Fliegens noch Schwimmens.
Am anderen Ufer hatten Straßenbauarbeiten für eine Neubausiedlung mal wieder
dafür gesorgt, dass die Wegmarkierung fehlte. Den Weg zum Wilden Moor fanden wir
auch so. So wild war das Wilde Moor dann doch nicht, aber schön, so schön, dass
ich unbedingt einem Trampelpfad folgen wollte. Mit Schauergeschichten über
Moorleichen, von denen nur noch eine Hand aus dem Wasser ragt und ähnlichem,
konnte mich meine Frau überzeugen, auf dem offiziellen Weg zu bleiben.
 Der
wurde schon nach wenigen Minuten von einer Kuh versperrt, die offensichtlich ein
Loch im Zaun gefunden hatte. So eine Kuh läuft einem schon mal übern Weg und
stört nicht. Diese hatte leider die Angewohnheit, immer vor uns her zugehen und
sich damit von der Herde zu entfernen. Links Stacheldraht, rechts Stacheldraht,
vorbei konnten wir auch nicht. Um den Abstand zu Herde nicht noch weiter zu
vergrößern, entschlossen wir uns, dass an der nächsten Weggabelung die Kuh
unseren Weiterweg bestimmen sollte. An der Gabelung blieb das Tier auf dem
Nord-Ostsee-Wanderweg, wir bogen also in die andere Richtung ab. Ohne unsere
Anwesenheit, so konnten wir noch beobachten, trottete die Kuh gemütlich zur
Herde zurück, und wir kamen nach Kamerun, etwas abseits der Wanderroute, die wir
nach einem kurzen Schlenker wieder erreichten. Der
wurde schon nach wenigen Minuten von einer Kuh versperrt, die offensichtlich ein
Loch im Zaun gefunden hatte. So eine Kuh läuft einem schon mal übern Weg und
stört nicht. Diese hatte leider die Angewohnheit, immer vor uns her zugehen und
sich damit von der Herde zu entfernen. Links Stacheldraht, rechts Stacheldraht,
vorbei konnten wir auch nicht. Um den Abstand zu Herde nicht noch weiter zu
vergrößern, entschlossen wir uns, dass an der nächsten Weggabelung die Kuh
unseren Weiterweg bestimmen sollte. An der Gabelung blieb das Tier auf dem
Nord-Ostsee-Wanderweg, wir bogen also in die andere Richtung ab. Ohne unsere
Anwesenheit, so konnten wir noch beobachten, trottete die Kuh gemütlich zur
Herde zurück, und wir kamen nach Kamerun, etwas abseits der Wanderroute, die wir
nach einem kurzen Schlenker wieder erreichten.
Der Weiterweg, oft über breite Waldwege, bis nach Westensee sollte ereignislos
bleiben. Westensee glänzt mit einer alten Wehrkirche, schönen, alten mit Reed
gedeckten Häusern und einer relativ neuen Jugendherberge. Im Gegensatz zur
Herberge in Albersdorf, war die hier jedoch voll. Wir ergatterten das letzte
freie Zimmer, sehr zum Leidwesen einer kurz nach uns eingetroffenen Familie.
Duschen und dann raus zur Orts- und Kirchbesichtigung mit anschließendem
Abendessen in einer Gaststätte. Kirche zu, Gaststätte zu, Essen könnt ihr in der
Jugendherberge, so ein Einheimischer. Im Spurt zurück bevor deren Küche schließt
(bei der Anmeldung hatten wir die Frage nach dem Abendbrot verneint). Glück
gehabt! Es war nix Tolles, aber reichlich.
Spät abends probte noch eine Seniorenmusikgruppe in einem der unteren Räume.
Deren Niveau war immerhin so hoch, dass wir ohne Kopfschmerzen einschliefen.
4.
Tag Westensee - Kiel (Hafen)
An diesem Tag gab es zu Abwechslung mal keinen Nebel, dafür eine halbe Stunde
Regen. Immer am Südufer des Westensees entlang, mal dicht am Wasser, mal weiter
weg, ging es durch kleine Dörfer in Richtung Landeshauptstadt. Vielen Häusern
konnte man ansehen, dass die ursprünglichen Bewohner schon lange nicht mehr
darin wohnen. Mit viel Geld und Arbeit wurden hier einige Schmuckstück
geschaffen. Zu unserem Leidwesen versteckten sich die meisten Anwesen hinter
alten Bäumen oder hohen Hecken.
Ein Novum gab es auf dieser Schlussstrecke dann auch noch. Höhenmeter! Bis auf
gut 70 Meter mussten wir hinauf. Solche Steigungen fordern ihren Tribut, mit der
Folge, dass sich die Pausen häuften.
Bis zum Autobahnzubringer folgten wir noch der hier schon sehr lichten
Markierung des NOW. Zu dessen offiziellem Ende am Schulensee, im gleichnamigen
Kieler Stadtteil, wollten wir nicht. Warum auch? Ein Wanderweg, der die beiden
Meere verbindet, die unsere Küstenlinie bestimmen, sollte auch am Meerwasser
enden. Für uns hieß das, dass wir die restlichen Kilometer der Wanderung bis zum
Hafenbecken an der Ostsee auf den Bürgersteigen der kleinen Ostseemetropole
verbringen würden. Schön war die Schlussetappe durch das Stadtzentrum nicht,
aber das Ziel war es wert. Wir hatten schon schlechtere Stadtetappen.
 Fazit: Fazit:
Wie das manchmal so ist: Man fragt sich, warum es einem gefallen hat und hat
dann doch keine richtige Antwort parat.
Für uns war natürlich der Weg von Küste zu Küste das Ausschlaggebende. Hinzu
kommt, dass ich der Seefahrt zugetan bin. Diese Leidenschaft wurde auf dem
Nord-Ostsee-Kanal gefüttert. Der Schiffsverkehr auf dem Kanal sorgte dafür, dass
es nicht langweilig wurde. Vielleicht lag es auch an der Landschaft - besser an
den Landschaften. Der rauhe, von Wind und Wasser geformte Küstenstrich an der
Nordsee. Die Agrarregion im Landesinneren, die mit ihren auch im Herbst noch
grünen Wiesen und den schwarz-bunten Kühen jedes Klischeebild bestätigte. Ebenso
das Wilde Moor. Verträumte Dörfer mit alten Kirchen und Reetdachhäusern,
eingebettet in die sanfte Hügellandschaft rund um den Westensee, waren das
Sahnehäubchen
auf der Schlussetappe.
Kiel, die Landeshauptstadt? Na ja, wir mussten halt durch, um an die Ostsee zu
kommen.
Höchstwahrscheinlich lag es jedoch am guten Wetter, das trügt die Wahrnehmung
und lässt einen leichter über die Unzugänglichkeiten hinwegsehen.
Ostfrieslandwanderweg - Ein Osterspaziergang
Die positive Überraschung gab es schon bei der Planung. Die Wanderkarten hatte
ich beim Wiehengebirgsverband Weser-Ems bestellt. Wanderkarten ist übertrieben.
Es kamen die bekannten Topographischen Karten in der Normalausgabe. Keine
einzige touristische Info, kein Wegenetz, nur das, was die Kartografen so
interessiert. Beim zweiten Blick (der erste ist an den ungezählten
Entwässerungskanälen hängen geblieben) fiel mir dann doch auf, dass jemand die
Weitwanderwege liebevoll mit einem roten Stift eingezeichnet hat. Wenn das mal
nicht aktuell ist!
1.
Tag Karfreitag: Papenburg - Hesel 41 km
In Papenburg, der Stadt die aus einer alten Moorsiedlung entstanden ist - noch
heute sorgen die vielen Kanäle für trockenen Füße - ist der Startpunkt des
Ostfrieslandwanderweges. Vom Rathaus im beschaulichen Zentrum führt der immer in
Richtung Norden bis zur Nordseeküste.
 Mit
Papenburg verbinde ich aber auch (und das mehr als Wandern) die Meyer-Werft. Im
Stillen hatte ich die Hoffnung, dass mal wieder eine spektakuläre Überführung
eines Kreuzfahrtschiffes über die Ems zur Nordsee anstehen würde. Ja das
Internet, Überraschungen gibt es da schon lange nicht mehr. Auf der Homepage der
Werft war weit und breit nix von einer solchen Fahrt, welche die Deiche und
Wiesen am Ufer der Ems regelmäßig in einen Ameisenhaufen verwandelt, zu sehen.
Dann wenigstens ein kleiner Frachter, so war meine Hoffnung. Schon bald nach dem
Start am Bahnhof der Kleinstadt löste sich diese Hoffnung beim Blick in den
leeren Werfthafen in Luft auf. Na ja, es war ja Ostern. Mit
Papenburg verbinde ich aber auch (und das mehr als Wandern) die Meyer-Werft. Im
Stillen hatte ich die Hoffnung, dass mal wieder eine spektakuläre Überführung
eines Kreuzfahrtschiffes über die Ems zur Nordsee anstehen würde. Ja das
Internet, Überraschungen gibt es da schon lange nicht mehr. Auf der Homepage der
Werft war weit und breit nix von einer solchen Fahrt, welche die Deiche und
Wiesen am Ufer der Ems regelmäßig in einen Ameisenhaufen verwandelt, zu sehen.
Dann wenigstens ein kleiner Frachter, so war meine Hoffnung. Schon bald nach dem
Start am Bahnhof der Kleinstadt löste sich diese Hoffnung beim Blick in den
leeren Werfthafen in Luft auf. Na ja, es war ja Ostern.
 Meine
Vorstellung von einer Wanderung über die Deichkrone war schon an der Seeschleuse
(trennt das Hinterland von Ebbe und Flut) nur noch eine Wunschvorstellung. Nicht
die vielen Zäune störten, da steht an jedem Zaun eine fest montierte
Übersteighilfe, es waren die Schafe, die das Gras auf dem Deich kurz halten, die
ein vernünftiges Fortkommen zu eine Farce werden ließen. Entweder Schafsch...
bis zu den Knöcheln, oder die Tiere standen so dicht, dass an ein zügiges
Durchkommen nicht zu denken war. Nun ja, dann eben weiter auf dem hinter dem
Deich verlaufenden betonierten Deichsicherungsweg. Links der Deich, rechts die
platte Landschaft Ostfrieslands, die in einem diesigen Zwielicht wenig Reize
bot. Es fehlte der weite ungehinderte Blick ins Land. Der graue Himmel tat das
Seine. Er sollte bis zum Ende der Wanderung überwiegend grau bleiben. Der
Nebel, mal dicht, mal als Hochnebel, sorgte für eine Lichtstimmung die ich mit
dem typischen norddeutschen Schmuddelwetter in Verbindung bringe. Immerhin hörte
der Nieselregen Meine
Vorstellung von einer Wanderung über die Deichkrone war schon an der Seeschleuse
(trennt das Hinterland von Ebbe und Flut) nur noch eine Wunschvorstellung. Nicht
die vielen Zäune störten, da steht an jedem Zaun eine fest montierte
Übersteighilfe, es waren die Schafe, die das Gras auf dem Deich kurz halten, die
ein vernünftiges Fortkommen zu eine Farce werden ließen. Entweder Schafsch...
bis zu den Knöcheln, oder die Tiere standen so dicht, dass an ein zügiges
Durchkommen nicht zu denken war. Nun ja, dann eben weiter auf dem hinter dem
Deich verlaufenden betonierten Deichsicherungsweg. Links der Deich, rechts die
platte Landschaft Ostfrieslands, die in einem diesigen Zwielicht wenig Reize
bot. Es fehlte der weite ungehinderte Blick ins Land. Der graue Himmel tat das
Seine. Er sollte bis zum Ende der Wanderung überwiegend grau bleiben. Der
Nebel, mal dicht, mal als Hochnebel, sorgte für eine Lichtstimmung die ich mit
dem typischen norddeutschen Schmuddelwetter in Verbindung bringe. Immerhin hörte
der Nieselregen
schon
kurz nach dem Start auf.
 Die
einzigen Farbtupfer in der noch wintergrauen Landschaft waren die backsteinroten
Häuser, die hin und wieder am Wegrand auftauchten. Nicht viel Abwechslung boten
die wenigen Dörfer hinterm Deich. Die sehenswerte alte Hallenkirche in Esklum,
schon an der Mündung der Leda in die Ems, war leider verschlossen. Die geplante
Besichtigung fiel leider ins Wasser. Übers Wasser der besagten Leda führt eine
Brücke, und schon stand ich in Leer mit seinem Hafen und den vielen stattlichen
Bürgerhäusern. Hier sollte für diesen Tag Schluss sein. Nach einem kleinen
Stadtrundgang fiel die Entscheidung, dass heute noch ein paar Kilometer drin
sind. Das flache Land lässt einen nicht richtig müde werden. In Leer beginnt die
Trasse der ehemaligen Kleinbahn die bis zur Küste reicht. Über diese, viel öfter
jedoch über Wirtschaftswege, ging es über Brinkum und Holtland noch bis nach
Hesel. Eines der wenigen Hotels am Weg hatte nach einigem Suchen doch noch ein
Zimmer für mich frei - das letzte. Der Haus ist voll belegt. Wer hätte das in
dieser Ecke der Welt erwartet? Osterfeiertage sind hier Familientage, so wurde
mir beschieden. Wer sein Eigenheim voll hat, der lagert seine große
Verwandtschaft ins Hotel aus. Die
einzigen Farbtupfer in der noch wintergrauen Landschaft waren die backsteinroten
Häuser, die hin und wieder am Wegrand auftauchten. Nicht viel Abwechslung boten
die wenigen Dörfer hinterm Deich. Die sehenswerte alte Hallenkirche in Esklum,
schon an der Mündung der Leda in die Ems, war leider verschlossen. Die geplante
Besichtigung fiel leider ins Wasser. Übers Wasser der besagten Leda führt eine
Brücke, und schon stand ich in Leer mit seinem Hafen und den vielen stattlichen
Bürgerhäusern. Hier sollte für diesen Tag Schluss sein. Nach einem kleinen
Stadtrundgang fiel die Entscheidung, dass heute noch ein paar Kilometer drin
sind. Das flache Land lässt einen nicht richtig müde werden. In Leer beginnt die
Trasse der ehemaligen Kleinbahn die bis zur Küste reicht. Über diese, viel öfter
jedoch über Wirtschaftswege, ging es über Brinkum und Holtland noch bis nach
Hesel. Eines der wenigen Hotels am Weg hatte nach einigem Suchen doch noch ein
Zimmer für mich frei - das letzte. Der Haus ist voll belegt. Wer hätte das in
dieser Ecke der Welt erwartet? Osterfeiertage sind hier Familientage, so wurde
mir beschieden. Wer sein Eigenheim voll hat, der lagert seine große
Verwandtschaft ins Hotel aus.
 2. Tag
Ostersamstag: Hesel - Aurich 27 km 2. Tag
Ostersamstag: Hesel - Aurich 27 km
Am nächsten Morgen
stand der Nebel wieder dicht überm Land. Bis zum Mittag löste der sich jedoch
auf, aber nur um einem weiteren grauen Tag Platz zu machen.
Von der „Anhöhe“ (um
die 10 m über N.N.) in Hesel ging es zügig abwärts zum Bagbander Tief (ca. 2 m
über N.N), einem der vielen kleinen Bäche dieser Region über die das Wasser, das
in unzähligen Entwässerungskanälen, Siele, Gräben und Rinnsalen gesammelt wird,
abfliest.
Seit der Stadtgrenze
von Leer dominiert das Blau dieser überwiegend von Menschenhand geschaffenen,
meist aber schon lange nicht mehr als solche zu erkennenden
„Trockenlegungshilfen“, die Farbe der Wanderkarte. Sogar jetzt, im zeitigen
Frühjahr, waren viele Kanäle unter den Büschen und Bäumen kaum als solche zu
erkennen, so dicht ist der Bewuchs. Einige dieser Bauwerke halten schon seit
Menschengedenken das hier alles bestimmende Grundwasser auf einem für die
Anwohner erträglichen Pegel. Heute sorgen zusätzlich unzählige Pumpen dafür,
dass das Wasser den Anwohnern nicht in die Häuser und den Landwirten nicht in
die Felder steigt.
Später, ab dem aus
einer alten Moorsiedlung hervorgegangen Ostgroßefehn, zogen immer wieder große
Nebelschwaden über die Wiesen und tauchten die alten Bäume in ein Dämmerlicht,
das mich eher an einen späten Herbstnachmittag denken lies als an einen hellen
Frühjahrsmorgen. Pünktlich zur großen Pause an der Windmühle in Wrisse wurde es
endlich heller. Einige Männer und Kinder aus dem Ort schichteten auf der
Nachbarwiese Reisig für das Osterfeuer auf. Ihre freundliche Aufforderung zur
Mitarbeit mit anschließendem Umtrunk, musste ich dann doch ablehnen. Im nächsten
Ort erhielt ich von einigen Jugendlichen, die mit der gleichen Arbeit
beschäftigt waren, ein beinahe gleich lautendes Angebot. Da sage mal einer die
Ostfriesen seinen ein verschlossener Menschenschlag. Bis Aurich war es zwar
nicht mehr weit, aber wenn ich hier hängen geblieben wäre, um Osterfeuer
aufzuschichten, hätte ich die Stadt wohl erst mit Einbruch der Dämmerung
erreicht. So reichte es noch für einen gemütlichen Bummel durch die Stadt,
inklusive Besuch einer Buchhandlung. Der Besuch einer Buchhandlung ist an und
für sich nicht erwähnenswert, wenn der Name Heinrich Heine erst der dritten
Angestellten etwas sagt, dann schon.
Die Übernachtung in
der Jugendherberge war ereignislos, bis auf den Umstand, dass eine schwedische
Fußballmannschaft ihr Trainingslager (neben der Jugendherberge befindet sich ein
Stützpunkt der DFB) mit einem standesgemäßen Umtrunk abschloss. Gehört habe ich
von dem Gelage nichts. In welcher schwedischen Liga der Verein spielt, blieb mir
ein Rätsel, wenn der Alkoholkonsum dieser Nacht ein Maßstab sein sollte (der
Flur war übersät mit leeren Flaschen), dann war‘s mit Sicherheit die Erste Liga.
 3. Tag
Ostersonntag: Aurich - Nordseeküste (Bensersiel) 29 km 3. Tag
Ostersonntag: Aurich - Nordseeküste (Bensersiel) 29 km
Zur Feier des Tages
gab es an diesem Morgen keinen Nebel, nur dunkle Regenwolken die sich aber nicht
entladen sollten. Erst mal zur Trasse der ehemaligen Kleinbahn zum Anfang der
letzten Etappe. Und dann raus aus der Stadt, die sich noch im verdienten Schlaf
befand. Wie meist an einem Feiertagmorgen in einer beliebigen Kleinstadt: die
Männer der Stadtreinigung, ein paar Frühaufsteher, die zum einzigen Bäcker
eilen, der an diesem Tag um diese Uhrzeit geöffnet hat, die unvermeidlichen
Herren in Jogginghose mit Hund oder Hündchen, nicht zu vergessen der Jogger, der
noch hastig seine Puls-Stopp-Kalorien-Uhr auf Null bringt, sind oft die
Einzigen, die das städtische Leben an solchen Tagen am Leben halten. Aurich
machte an diesem Morgen auch keine Ausnahme.
Die leider befestigte
Kleinbahntrasse war wieder mein ständiger Begleiter. Links Wiesen. In der Mitte
der gepflasterte, geteerte, oder sonstwie befestigte Weg. Rechts Wiesen.
Aufgelockert wurde das Gesamtbild durch vereinzelt stehende Bauernhöfe, kleine
Weiler, gelegentlich durch einen Wald.

Der Höhenpunkt an
diesem frühen Morgen war zweifellos der Ostfrieslandäquator. Ein Balkentor quer
über den Weg sorgte dafür, dass ich den nicht übersehen konnte. Ein
unbefestigter Wiesenweg wäre mir lieber gewesen. Eine kleine Entschädigung für
die endlose Pflaster- und Asphalttreterei waren die wunderschönen Ortsnamen wie Middels-Westerloog oder Ogenbargen. Ab hier, auf den letzten Kilometern zur
Nordsee, fehlte endlich der künstliche Belag. Endlich Wiesen-, Feld- und
Wirtschaftswege. Und endlich zeigt sich die Sonne. Dass es durch die Esenser
Siedlungen dann wieder normale Straßen waren, machte den Bock auch nicht mehr
fett. Den Deichweg entlang des Benser Tief, musste ich mir bis Bensersiel mit
Osterspaziergängern teilen. Die verwunderten Blicke der Entgegenkommenden, an
die ich mich in den letzten Tagen gewöhnt hatte, wurde hier oft um ein Lächeln
erweitert. Aus Gewohnheit war ich mit schweren Wanderschuhen unterwegs, in
Küstennähe eine eher unübliche Fußbekleidung.
Am Fähranleger für die
Schiffe zu den Ostfriesischen Inseln, war das Ende der Wanderung erreicht.
 Fazit: Fazit:
Im Voraus hatte ich
damit gerechnet mir den Ostfrieslandwanderweg mit Radfahrern teilen zu müssen.
Ob es am Wetter lag oder daran, dass in Norddeutschland das Fahrrad ein
Alltagsgegenstand ist und somit weniger für Ausflüge genutzt wird, Radfahrer
habe ich bis auf einen (und natürlich den obligatorischen Innerortsverkehr)
nicht getroffen.
Es war eine
interessante Wanderung durch eine Region, die zu Unrecht (trotz der
nachstehenden Kritik) nicht nur geographisch weit abseits der bekannten und oft
überlaufenen Wanderziele liegt - trotz der Längen die die Streckenführung
aufweist.
Zwei Punkte haben mich
sehr gestört: einmal die Etappe von Pappenburg nach Leer. Immer hinterm Deich
entlang ist auf Dauer langweilig. Das Ausweichen auf die Deichkrone mag Abhilfe
schaffen, man kommt da oben aber oft nur langsam voran. Am meisten haben mich
die beinahe durchgehend befestigten Wege gestört. Egal ob geteert, betoniert,
gepflastert, geplattet oder was auch immer. In Verbindung mit den meist
schnurgeraden Wegen und oftmals gleich bleibender Landschaft (es fehlen die „Boah-Effekte“),
war es manchmal zermürbend.
Bei strahlend blauem
Himmel, einem leichten Nordwestwind und angenehmen Temperaturen wären mir die
Negativpunke überhaupt nicht aufgefallen.
Markierung und Wanderkarten (beide Wege)
Alles für den Nord-Ostsee-Wanderweg (Wanderkarten, Infos und mehr) gibt es im
Internet
beim Wanderverband Norddeutschland e.V.
www.norddeutscher-wanderverband.de
und beim Deutschen Wanderverband
www.wanderbaresdeutschland.de
Wanderkarten, eine sehr gute Wegbeschreibung und ein Unterkunftsverzeichnis für
den Ostfrieslandwanderweg, gibt es beim betreuenden Verband:
www.wgv-weser-ems.de.
Die Wanderkarten sollten aus den oben erwähnten Gründen unbedingt beim
Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V. -
www.wgv-weser-ems.de
- bestellt werden. Die Wegbeschreibung enthält ausführliche Informationen zur
Geschichte und Geographie der durchwanderten Region.
Das Wandern ohne Wanderkarten ist auf beiden Wegen nicht zu empfehlen. Die
Markierung ist zwar ausreichend bis gut, hin und wieder fehlt aber eines der
kleinen Schildchen. Wer von den so genannten Premiumwanderwegen kommt, wird
feststellen, dass nicht an jeder Kreuzung eine Markierung angebracht ist. Im
Zweifel muss eben die Wanderkarte konsultiert werden.
Auf dem Ostfrieslandwanderweg ergibt sich die Wegführung meist durch den
Verlauf der Ems und der alten Bahntrasse.
Fotos und
Titelfoto von Werner Hohn
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
24 - Dezember 2007
In 6 Tagen 109 km auf der Via Alpina -
dem Violetten Weg - von Oberstdorf bis Garmisch
Von Hans Diem
„...Bei heftigem Dauerregen fahren wir nach Hause. Nach zwei Tagen bin ich
wieder zurück in Oberstdorf und gehe zum Abschluss des Sommers 2006 noch auf dem
Violetten Weg der Via Alpina nach Garmisch-Partenkirchen, 38 Std., 109 km,
6 Tage. Für den Sommer 2007 bietet sich der violette Weg durch Österreich an,
von Slowenien hinauf zum Königsee und dann noch nach Garmisch-Partenkirchen, das
wäre doch was für den Diem und seine Evelyn...“
Die Redaktion:
So endete der Artikel von Hans Diem in der Ausgabe 22 von
Wege und Ziele.
Hier die Fortsetzung und der Abschluss von 2006. Ein Bericht der
Sommerwanderung 2007 auf dem Violetten Weg folgt in einer der nächsten Ausgaben.
Via Alpina - Violetter Weg - von Oberstdorf nach Garmisch-P.
Nach Via Alpina Etappenliste von 06.2005.
Die
Route ist beschildert mit Wegweisern und Zusatzschildern der Via Alpina.
39. Tag: Dienstag, 22.08.06
Karte f&b WK 351. Anreise per Bahn.
Oberstdorf (813 m),
Auffahrt mit der Nebelhorn-Seilbahn bis zur
Edmund Probst
Hütte (1932 m), Schild VAv (Via Alpina violett).
Wegweiser [Laufbacher Eck 2 h, Prinz Luitpold Haus 4:30 h], bei Regen, Wind und
Nebel gehe ich los in Anorak, Überhose und Poncho, quere auf einem Bergweg in
Flanke mit Blumenwiese zum
Laufbacher Eck
(2178 m, 2 Std.). Bergweg abwärts in Wiese, teils in Schotter zur Schönberg Alm
(1688 m). Bergweg kurz abwärts bis 1591 m, dann aufwärts in Gras und
Erlengebüsch zum
Prinz Luitpold
Haus (1846 m, 2 Std.). VA Infotafel
im Eingang der Hütte, 30 Gäste sind hier. Eintrag im Hüttenbuch: 19.8.,
Jean-Paul Thiercelin und Bernadette Mattieu, France, auf Via Alpina von Triest
nach Monaco. Auskunft vom Hütten-Personal: zwei Amerikaner waren hier und
ebenfalls auf VA.
39. Tag: 4:00 Std., 9 km, + 501 m, - 587 m.
40. Tag: Mittwoch, 23.08.06
Karten f&b WK 351 und BLV: UK L 10
Das Wetter ist heiter bei 8°C, das macht richtig Lust auf den Weg. Wegweiser [Bockkarscharte
0:50 h, Schrecksee 4 h]. Kurz auf Bergweg abwärts zum See, Bergweg aufwärts in
Blumenwiese zur
Bockkar Scharte
(2164 m, 50 Min.). Rückblick zu Hütte, Himmeleck und Laufbacher Eck.
 Wegweiser
[Schrecksee], Bergweg abwärts in Schotter, queren in einer Flanke mit Gras,
durch Schrofen drahtseilversichert, in Gras und Latschen zur Lahner Scharte
(1974 m). Ich überhole die Jugendgruppe aus dem Zimmerlager der letzten Nacht,
sie sind ohne Frühstück abgegangen um ihr Tagesziel gut zu erreichen. Dass ich
als Grauschopf mit großem Rucksack sie einhole und sogar Luft habe zu einer
Unterhaltung, wundert sie sehr. Im Gegenverkehr kommt eine Altherrengruppe sehr
vereinzelt daher, sie sind schlecht gelaunt wegen des vielen Regenwetters in
ihrer knappen Woche. Wegweiser
[Schrecksee], Bergweg abwärts in Schotter, queren in einer Flanke mit Gras,
durch Schrofen drahtseilversichert, in Gras und Latschen zur Lahner Scharte
(1974 m). Ich überhole die Jugendgruppe aus dem Zimmerlager der letzten Nacht,
sie sind ohne Frühstück abgegangen um ihr Tagesziel gut zu erreichen. Dass ich
als Grauschopf mit großem Rucksack sie einhole und sogar Luft habe zu einer
Unterhaltung, wundert sie sehr. Im Gegenverkehr kommt eine Altherrengruppe sehr
vereinzelt daher, sie sind schlecht gelaunt wegen des vielen Regenwetters in
ihrer knappen Woche.
Bergweg abwärts in Blumenwiese, queren oberhalb des
Schrecksees (1802 m, 2:15 Std.,
3:05 Std. ab Hütte). In der Grasflanke richte ich mir einen Pausenplatz ein,
sitze gut auf der Zeltunterlage, der Kocher macht Wasser heiß für einen Kaffee,
schaue über den See hinweg ins Gebirge. Einzelne Leute tummeln sich am Wasser,
einige kommen und gehen auf meinem Weg. Das ist ungewohnt für mich, typisch
Allgäu, da ist viel Volk unterwegs.
Bergweg aufwärts in Gras, queren in Schrofenflanke zur Hinteren Schafwanne (1985
m). Bergweg abwärts, queren und aufwärts in Flanke mit Gras, Schotter und
Schrofen zum
Geißhorn
(2249 m, 2:15 Std. ab Schrecksee, 5:20
Std. ab Prinz Luitpold Haus). Der Gipfel ist leider in Wolken, keine Aussicht.
Gehe kurz zurück zu Weggabelung mit Wegweiser [Älpele Alp], der Normalweg 57
geht über das Zirleseck nach Tannheim. Ich nehme den 58er Weg, steil auf einem
Steig in Fels, dann in Schotter abwärts 40 Min. lang. Bergweg in Gras abwärts
zur
Älpele Alpe
(1526 m, 1:25 Std.), Almgasthaus. Auf Fahrweg oder auf schlechtem Bergweg in
Wald bergab zum Dorf
Tannheim
(1097 m, 55 Min.), Hotels, Gasthäuser,
Laden, Brunnen.
Prinz Luitpold Haus > Tannheim: 7:40 Std., 20 km, + 765 m, - 1514 m.
Einkauf im Supermarkt, das Obst waschen am Dorfbrunnen, Pause auf einer Parkbank
sitzend, das Geschehen im Dorf beobachten, um 18:30 Uhr weiter. Von Tannheim
Richtung N auf Straße durch den Ortsteil Berg zum Gasthaus Schäfer Hütte. Nach
Wegweiser [Höhenweg Grän] auf Fahrweg Richtung O, ein Balkonweg in Wald und
Wiese zu Campingplatz, auf Straße Richtung N zum Parkplatz der Bad Kissinger
Hütte [Bad Kissinger Hütte 1:45 h], kurz zum Ort
Enge
(1160 m, 1:10 Std.), weiter zum Zelten am Waldrand mit Blick auf das Geißhorn.
40. Tag: 8:50 Std., 25 km, + 828 m, - 1514 m.
41. Tag: Donnerstag, 24.08.06
Karte BLV: UK L 10, 1:50 000
Es ist heiter bei 12°C. Auf Bergweg aufwärts in Wald zu einem Joch mit Gabelung.
Wegweiser [Aggenstein 1 h], links Bergweg aufwärts in Schrofen zur
Bad Kissinger
Hütte (1792 m, 1:20 Std. ab Enge).
Die letzten Gäste gehen ab, ich bin der erste Tagesgast und bestelle ein
Frühstück, da staunt die Wirtin.
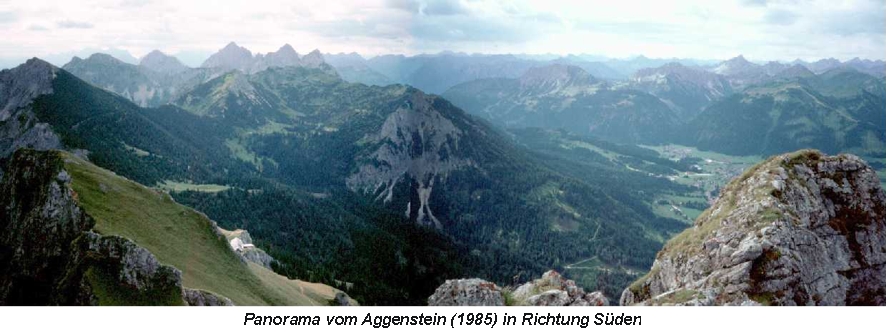
Auf Bergweg aufwärts in Flanke mit Gras, dann auf Steig in Schrofen teils mit
Ketten gesichert zum
Aggenstein
(1985 m, 0:30 Std.), fantastische Rundschau.
Kurz den Steig zurück bis Wegweiser [Hochalpbahn 0:50 h], Bergweg abwärts in
Steilhang - den sogenannten Langen Strich - mit Gras und Schotter, kurz über
Fels mit Drahtseil, dann flach in Weide zur
Hochalp Hütte
(1500 m, 1:05 Std.), Gasthaus, Zimmer. Die Sonne brennt auf die Terrasse, lege
Zelt und Schlafsack zum Trocknen aus, setze mich für Kartoffelsuppe und
Germknödel in den Schatten eines Sonnenschirms, wunderbar.
Nebenan ist die Bergstation der
Breitenberg
Seilbahn, fahre hinab ins Tal, gehe auf Straße durch den
Ort
Pfronten zum Bahnhof im Ortsteil
Ried (856 m, 0:50 Std.), Hotels, Gasthäuser, Läden, Bahn.
Ab Enge: 3:45 Std., 8 km, + 825 m, - 485 m (bei Seilbahn-Talfahrt)
Tannheim > Pfronten Ried: 6:05 Std., 13 km, + 888 m, - 485 m (Seilbahn-Talfahrt)
Vom Bahnhof Richtung S, nach links über den Bahnübergang, rechts ab auf dem
Drosselweg zu Bachlauf. Nach Wegweiser [Pfronten-Meilingen 0:30 h] auf Fußweg in
Wald, dann Straße bergauf nach Meilingen. Wegweiser [Falkenstein 1 h], Straße,
Fahrweg in Wiese, ein Stück Straße, dann auf Bergweg in Wald bergauf zum
Falkenstein
(1250 m, 1:25 Std.), Burgruine und Burghotel.
41. Tag: 5:10 Std., 13 km, + 1219 m, - 485 m.
Kurz nach Meilingen hat Sturm und Regen eingesetzt. Klatschnass betrete ich um
15.50 Uhr das Burghotel auf dem Falkenstein, um das Wetterchaos abzuwarten.
Ziehe im Windfang die nassen Kleider und die Stiefel aus, stelle den Rucksack in
eine Ecke, gehe dann in den Gastraum. Erfreut hat das Personal meine Aktion im
Windfang beobachtet, sie bedienen mich zuvorkommend. Ich werde gefragt nach
meiner Tour, eine Bedienung mit ähnlichen Ambitionen berichtet mir von ihren
Wanderungen auf Mittelmeerinseln. Ich überlege, wenn ich um 18 Uhr weitergehen
kann, reicht die Zeit noch um einen Biwakplatz auf dem Zirmgrat zu erreichen.
Doch es stürmt und regnet unentwegt, ich könnte der harte Hund sein und trotzdem
gehen. Wenn ich nur wüsste, wie morgen das Wetter ist. Da fällt mir der König
Ludwig ein und sein Plan zu einem Luxusschloss hier oben. Zelten im Freien ist
gut, denke ich, aber einmal im Leben fürstlich übernachten wäre ein Versuch
wert. Die Chefin des Hotels hat ein letztes freies Zimmer mit Bad, Luxus pur für
€
87.40. Die überdekorierte super gestylte Bude ist beleuchtet mit 28
Lichtquellen, nur ein Sternenhimmel kann das toppen. Also tue ich probeliegen,
Lichter schalten, Kleider waschen, lange duschen. Und liege neben einem riesigen
Tiger aus Stoff und schlafe dennoch wenig. Dafür scheint am Morgen die
aufgehende Sonne in mein Zimmer und lässt die rotgeflammte Tapete aufleuchten,
juhu!
42. Tag: Freitag, 25.08.06
Karte BLV: UK L 10
Bei schönem Wetter einige Stufen hinauf zur Ruine Falkenstein (1267 m),
Infotafel, fantastischer Ausblick. Abstieg zur Mariengrotte (6 Min.), eine große
natürliche Grotte in der senkrechten Felswand unterhalb der Ruine . Nach
Wegweiser [Zirmengrat 1 h, Salobergrat 1:30 h] auf Weg flach zu Aussichtspunkt,
auf Autostraße zu Kehre, nach Wegweiser [Salober Alp 1 h] auf Bergweg aufwärts
in Mischwald zu Aussichtspunkt auf dem Zirmgrat (1287 m). Bergab zu Senke mit
Gabelung, über bewaldeten Hügel zu 2. Senke. Auf Bergweg queren in Flanke zu
Aussichtspunkt mit Blick auf das Vorland mit vier Seen. Weiter zur
Salober Alpe
(1089 m, 1:35 Std. ab Falkenstein), Gasthaus.
 Wegweiser
[Alatsee 0:20 h, Füssen 1:30 h], Forststraße bergab, Straße am Alatsee entlang
zum Hotel Alatsee (870 m, 0:25 Std.), Gasthaus. Wegweiser [Füssen 4 km]: Fahrweg
rechts am Bach in Mischwald, dann an Badeseen entlang, ab Gasthaus auf der
Alatsee-Straße nach
Füssen
(808 m, 1:30 Std. ab Salober Alpe). Basilika St. Mang, Hohes Schloss,
historische Altstadt, Hotels, Gasthäuser, Läden, Bahn, Bus. Wegweiser
[Alatsee 0:20 h, Füssen 1:30 h], Forststraße bergab, Straße am Alatsee entlang
zum Hotel Alatsee (870 m, 0:25 Std.), Gasthaus. Wegweiser [Füssen 4 km]: Fahrweg
rechts am Bach in Mischwald, dann an Badeseen entlang, ab Gasthaus auf der
Alatsee-Straße nach
Füssen
(808 m, 1:30 Std. ab Salober Alpe). Basilika St. Mang, Hohes Schloss,
historische Altstadt, Hotels, Gasthäuser, Läden, Bahn, Bus.
Ab Falkenstein: 3:05 Std., 12 km, + 220 m, - 679 m.
 Von
11.45 Uhr bis 14 Uhr bin ich in der Kleinstadt Füssen zu Stadtrundgang und
Einkehr, dann eine kurze Busfahrt nach
Hohenschwangau
(800 m). Der Großparkplatz unter dem Schloss Linderhof ist voll mit Autos,
Bussen und Menschen. Nach Wegweiser [Pöllatschlucht] gehe ich auf Fußweg zur
Schlucht, auf Bergweg, Steinstufen, Metallsteg durch die
Pöllatschlucht
mit Wasserfall hinauf zur
Marienbrücke
(40 Min.). Die Brücke bietet einen weltbekannten Ausblick zum Schloss
Neuschwanstein, darauf drängeln sich massenhaft Besucher. Einer meint, die alte
Stahlkonstruktion hoch über dem Wasserfall ist permanent überbelastet und könnte
jederzeit einstürzen. Weiter auf dem Wasserleitungsweg, einer Forststraße mit
201 rechts vom Bach aufwärts in Mischwald nach
Bleckenau
(1167 m, 45 Min.), Gasthaus und ehemalige königliche Jagdhütte. In der Nähe ist
die Von
11.45 Uhr bis 14 Uhr bin ich in der Kleinstadt Füssen zu Stadtrundgang und
Einkehr, dann eine kurze Busfahrt nach
Hohenschwangau
(800 m). Der Großparkplatz unter dem Schloss Linderhof ist voll mit Autos,
Bussen und Menschen. Nach Wegweiser [Pöllatschlucht] gehe ich auf Fußweg zur
Schlucht, auf Bergweg, Steinstufen, Metallsteg durch die
Pöllatschlucht
mit Wasserfall hinauf zur
Marienbrücke
(40 Min.). Die Brücke bietet einen weltbekannten Ausblick zum Schloss
Neuschwanstein, darauf drängeln sich massenhaft Besucher. Einer meint, die alte
Stahlkonstruktion hoch über dem Wasserfall ist permanent überbelastet und könnte
jederzeit einstürzen. Weiter auf dem Wasserleitungsweg, einer Forststraße mit
201 rechts vom Bach aufwärts in Mischwald nach
Bleckenau
(1167 m, 45 Min.), Gasthaus und ehemalige königliche Jagdhütte. In der Nähe ist
die
Fritz-Putz-Hütte für Selbstversorger.
Der Fahrweg nach Bleckenau ist eine beliebte Strecke für Bergradler. An einem
Steilstück vor mir strampelt ein Radler bergauf, ich mache Tempo und ziehe
locker vorbei. Im flachen Abschnitt holt er mich natürlich wieder ein und
spricht mich an. Er wundert sich über mein Gehtempo und fragt nach. Ich berichte
von meinen Unternehmungen, der Freude daran und von der Vorgeschichte. Das
begeistert den Mann so sehr, dass er ebenfalls lange Überschreitungen gehen will
und mit mir in Verbindung bleiben will.
 Nach der
Einkehr im historischen Gasthaus Bleckenau nach Wegweiser [Jägerhütte 1:30 h]
auf Fahrweg bergauf zur Jägerhütte und einer Almhütte mit Bewirtung und Brunnen
(1:10 Std.). Abzweig Richtung [Niederstraußberg Alm, Kenzenhütte], auf Bergweg
aufwärts in Wald und Weide zum
Niederer
Straußberg Sattel (1:45 Std., kein Standortschild),
Wegweiser [Gabelschrofen, Kenzenhütte 3:30 h]. Es ist 18.20 Uhr. Mein Verstand
sagt, ich sollte hier einen Schlafplatz einrichten, aber mein Gemüt will
weitergehen. Meine Beine gehen einfach los, bei schönster Abendstimmung auf gut
angelegtem Bergweg aufwärts in Flanke mit Fels, Gras, Latschen zum
Gabelschrofen
Sattel (2000 m, 1 Std.). Steiniger Bergweg steil abwärts
in Flanke mit Grobschotter, im Kessel mühsam durch ein Karstlabyrint mit
Latschen. Es ist dunkel geworden und kein Biwakplatz ist hier. Kurzer Aufstieg
zum Kenzensattel (1650 m), auf steinigem Bergweg abwärts, nun bei völliger
Dunkelheit in Wald absteigen zur
Kenzen Hütte
(1294 m, 1:40 Std.), privat, bewirtschaftet. Nach der
Einkehr im historischen Gasthaus Bleckenau nach Wegweiser [Jägerhütte 1:30 h]
auf Fahrweg bergauf zur Jägerhütte und einer Almhütte mit Bewirtung und Brunnen
(1:10 Std.). Abzweig Richtung [Niederstraußberg Alm, Kenzenhütte], auf Bergweg
aufwärts in Wald und Weide zum
Niederer
Straußberg Sattel (1:45 Std., kein Standortschild),
Wegweiser [Gabelschrofen, Kenzenhütte 3:30 h]. Es ist 18.20 Uhr. Mein Verstand
sagt, ich sollte hier einen Schlafplatz einrichten, aber mein Gemüt will
weitergehen. Meine Beine gehen einfach los, bei schönster Abendstimmung auf gut
angelegtem Bergweg aufwärts in Flanke mit Fels, Gras, Latschen zum
Gabelschrofen
Sattel (2000 m, 1 Std.). Steiniger Bergweg steil abwärts
in Flanke mit Grobschotter, im Kessel mühsam durch ein Karstlabyrint mit
Latschen. Es ist dunkel geworden und kein Biwakplatz ist hier. Kurzer Aufstieg
zum Kenzensattel (1650 m), auf steinigem Bergweg abwärts, nun bei völliger
Dunkelheit in Wald absteigen zur
Kenzen Hütte
(1294 m, 1:40 Std.), privat, bewirtschaftet.
Ab Hohenschwangau: 5:50 Std., 18 km, + 1300 m, - 806 m.
Gesamt 42. Tag: 8:55 Std., 30 km, + 1520 m, - 1485 m.
Es ist 21.05 Uhr, Licht brennt in der Gaststube der Kenzen Hütte, aber die Tür
ist verschlossen. Klopfe am Fenster, die Wirtin sperrt auf. Zwei junge Männer
als einzige Gäste sitzen an einem Tisch, sind auch spät angekommen. Sie wollen
ein paar Tage lang durch die Ammergauer Alpen gehen, sind nicht geübt und
deshalb überfordert. Die Wirtin reklamiert die zu kurz angegebenen Gehzeiten in
den Beschreibungen, weil die kein Mensch einhalten kann. Sie kann nicht glauben,
dass ich heute beschwerdefrei vom Falkenstein komme in 9 Stunden Gehzeit. Ich
empfehle ihr, den Gästen klar zu machen, dass Bergwandern Kraft und Übung
braucht, dass die Gehzeiten immer für durchschnittlich trainierte Leute sind,
denn für untrainierte kann man keine Gehzeiten ermitteln.
43. Tag: Samstag, 26.08.06
Karte BLV: UK L 31.
Wegweiser [Linderhof, Klammspitze] kein VA-Schild. Heiter wie das Wetter gehe
ich auf Bergweg in Wald und Gras hinauf zum
Bäckenalm Sattel
(1536 m, 30 Min.). Wegweiser [201 Höhenweg Klammspitze] VAv, Bergweg aufwärts in
Gras zur Hirschwang Hütte. Die kleine Almhütte ist geschlossen, hat aber einen
offenen Unterstand für 6 Personen. Auf Höhenrücken mit Blumenwiese aufwärts zum
Feigenkopf (1867 m). Am Klammspitzgrat auf Bergweg abwärts in steiler
Grasflanke, queren in Steilflanke, kurz abwärts durch Felsstufe mit Ketten
versichert, in steiler Schrofenflanke bergauf zu
Große Klammspitze
(1924 m, 2:05 Std.), Aussichtsgipfel, Panorama mit Bergen und Flachland. Leider
kein Fotowetter wegen aufziehender Regenbewölkung.
Auf der Kenzen Hütte habe ich über Telefon mit meiner Evelyn ausgemacht, dass
wir uns um 11 Uhr auf der anspruchsvollen Klammspitze treffen. Ich bin 4 Minuten
vor der Zeit da, richte einen schönen Sitzplatz ein, stelle den Kocher auf für
ein Kaffeewasser und warte. Beobachte die wenigen Leute auf dem schroffen
Gipfel. Ein genervter Mann meint, der Abstieg wäre zu gefährlich für mich. Ein
großer Hund kommt herauf, hinterher ein Knirps mit 5 Jahren, dann der Reihe nach
seine 3 Geschwister, der Vater und endlich die Mutter. Die Familie bewegt sich
furchtlos auf dem ausgesetzten Grat, der 5-jährige ist fasziniert von meinem
Kocher, möchte er haben. Der Vater fragt nach der Kenzen Hütte, da will er hin
mit seiner Bande, und auch noch zurück zum Auto in Linderhof. Ich schildere kurz
den anspruchsvollen Steig am Grat entlang, den Abstieg zur Hütte, den langen und
langweiligen Rückweg und addiere ihm die Gehzeiten. Das rührt den Mann nicht.
Dann sagt die Frau, sie sind auf ihrem ersten Bergausflug mit den Kindern, haben
in der Brunnenkopf Hütte übernachtet, sind spät gestartet und haben lange
gebraucht für den Aufstieg. Mir verschlägt es die Sprache. Um 12 Uhr will ich
absteigen, da kommen Evelyn und eine Bekannte herauf. So gibt es doch noch einen
Gipfelespresso mit Keksen. Die beiden fahren von Linderhof wieder nach Hause.
Bergweg steil abwärts in Schrofen und in einer Karmulde, flach in Gras zur
Brunnenkopf Hütte
(1602 m, 1 Std.), bewirtschaftet. Fahrweg abwärts in Wald zum
Schloss Linderhof
(943 m, 1:20 Std.), Hotel, Gasthaus, Königsschloss. Fahrweg mit Schilder VAv
flach in Mischwald Richtung O zum Ellmaugrieß, durch das trockene Bachbett,
Richtung S auf Forststraße leicht ansteigend, dann abfallend zu Gabelung (1190
m) mit Wegweiser [Rotmoos, Enningalm]. Kurz Forststraße zu
Rotmoos Alm
und Diensthütte (2000 m, 2:40 Std., geschlossen, kein Brunnen). Fahrweg aufwärts
in Wald zu Gabelung (22 Min.), Via Alpina geht nach links aufwärts über die
Ennigalm nach Garmisch-Partenkirchen. Ich gehe Richtung Stepberg auf Fahrweg
aufwärts zu Sattel an der Ziegspitze (1660 m), abwärts zu geschlossener
Diensthütte
(1592 m, 1:10 Std.). Zelten unter dem Vordach der Hütte.
43. Tag: 8:45 Std., 24 km, + 1447 m, - 1149 m.
Ich habe eine Zeltnacht geplant an der Diensthütte mit Brunnen unter der
Ziegspitze. Doch im Aufstieg von der Rotmoos Alm fängt es an zu regnen, der
Brunnen an der Diensthütte gibt kein Wasser, aber unter das Vordach des neuen
Schuppens passt haargenau mein Zelt. So habe ich zwar kein Trinkwasser, aber
einen trockenen Zeltplatz mit Dach. Der nächste Morgen ist bewölkt aber trocken,
das Wetterstein Gebirge ist angeschneit. Nach 10 Min. bin ich an der Stepberg
Alm und frage um 7.45 Uhr nach einem Frühstück. Zwar qualmt der Kamin und die
Tür zur Gaststube ist offen, aber leider gibt es noch nix.
44. Tag: Sonntag, 27.08.06
Karte BLV: UK L 31.
Fahrweg zu
Stepberg Alm
(1583 m, 10 Min.), Gasthaus.
Wegweiser [Garmisch, Gelbes Gwänd], Bergweg abwärts in Mischwald mit Blick auf
das Wetterstein Massiv, flach auf dem Kramer Plateauweg, Abstieg ins Zentrum von
Garmisch
(708 m, 2:10 Std.).
2:20 Std., 8 km, - 884 m.
In Überhose und Anorak gehe ich bei Regenwetter durch die historische
Sonnenstraße auf die Pfarrkirche von Garmisch zu. Im Gasthaus zur Schranne
brennt Licht, ich kehre ein zu einer bayrischen Brotzeit mit Weißwurst, Brezen
und Bier. Beim Bezahlen höre ich die Glocken der Pfarrkirche läuten zum
Hauptgottesdienst. Bei jeder Heimkehr ist Dankbarkeit angebracht, also gehe ich
wie ich bin in Überhose und Anorak, mit Rucksack und Gehstecken in die Kirche,
stelle mich möglichst unauffällig in eine Nische. Jahrelang hatte ich im Chor
gesungen, aber am letzten Ostern aufgehört. Ich schaue zur Empore, steht doch
der Chor und ein Orchester oben. Obwohl ich überzeugt war, dass ich nie mehr
singe, gehe ich die Stufen hinauf in Überhose und Anorak, mit Rucksack und
Gehstecken. Alle drehen sich um, es recken sich die Köpfe, die Tenöre reihen
mich ein, man reicht mir die Noten der Missa in B, schon bin ich mitten im
Kyriegesang. Etwas abgerückt sind dann die Sangesbrüder schon wegen meinem
strengen Gebirgsduft, die letzte Kleiderwäsche ist lange her. Erfreut und
ergriffen gehe ich anschließend durch das Dorf nach Hause, den 14. Sommer in
Folge war ich jetzt unterwegs und über alle Berge.
Zusammenfassung für Via Alpina - Violetter Weg
von
Oberstdorf über Laufbacher Eck 2128
m, Bockkar Scharte 2164 m, Geißhorn 2249 m, Tannheim.
Tannheimer Berge: Tannheim,
Aggenstein 1987 m, Pfronten.
Ammergauer Alpen: Pfronten,
Falkenstein 1250 m, Füssen, Bleckenau, Gabelschrofen Sattel 2000 m, Klammspitz
1924 m, Linderhof, Stepberg Alm 1592 m
nach Garmisch-Partenkirchen.
6
Tage, 38:00 Std., 109 km, + 5515 m, - 6104 m.
Fotos von Hans Diem
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
24 - Dezember 2007
Eine Wanderung entlang der deutschen Donau
Von Günther Krämer
Karten:
Freizeitkarten
1:50 000 des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg
Topographische
Karte 1:50 000 des Bayerischen Landesvermessungsamtes
Umgebungskarten
1:50 000 des Bayerischen Landesvermessungsamtes
Versprechungen
Eine Wanderung
entlang des mit 2850 km zweitlängsten Flusses Europas ist schon ein besonderes
Erlebnis: Vom Schwarzwald geht es steil hinunter in die hochgelegene Baar, wo
sich in Donaueschingen die Quellflüsse vereinigen: „Brigach und Breg bringen die
Donau zuweg“. Die Geographen haben den alten Streit um die „richtige“
Donauquelle schon längst entschieden. Die Bregquelle bei der Martinskapelle am
Brend ist die Donauquelle.
In der Baar darf
sich die Donau noch mäandrierend als richtiger Fluss fühlen, denn bald darauf
ereilt sie das Schicksal fast aller europäischen Flüsse: Sie wurde begradigt,
kanalisiert, eingedeicht, gestaut, verbaut … Darüber hinaus stiehlt ihr der
Rhein bei Immendingen das Wasser. Es versickert einfach im zerklüfteten,
verkarsteten Jura-Kalkgestein und kommt erst in einer der stärksten
Karstquellen, im Aachtopf beim Städtchen Aach, wieder ans Tageslicht, um sich
dann schnellstens Richtung Bodensee-Rhein davonzumachen.
Das Donautal
entschädigt für den Wasserverlust. Zwischen Fridingen und Sigmaringen hat die
Donau einen großartigen Canyon geschaffen, den Donaudurchbruch durch die
Schwäbische Alb, garniert mit hohen Felsen, oft gekrönt von Burgen und
Schlössern.
Dann die
Donaustädte: Die Jugendstilstadt Tuttlingen, die Hohenzollern-Residenz
Sigmaringen, die vorderösterreichischen Städte Meßkirch, Riedlingen, Ehingen und
Günzburg, die Freien Reichsstädte Ulm und Regensburg mit ihrer großartigen
Geschichte und entsprechenden Baudenkmälern, die pfälzische Residenz Neuburg,
die altbayerischen Städte Ingolstadt, Vohburg, Kelheim und Straubing,
schließlich die alte Bischofsstadt Passau …. Wie an einer Perlenkette reihen
sich sehenswerte Städte aneinander!
Das Donautal
schwankt zwischen zwei Extremen: Engstellen zwischen hohen Kalksteinfelsen
wechseln sich ab mit breiten Niedermoorlandschaften, die teils unter Naturschutz
stehen, wo die Frösche in den Altwassern quaken, Störche und Eisvögel ihr
Refugium haben, oder aber - entwässert - Spezialitäten hervorbringen wie
Frühkartoffeln, Gemüse und vor allem Spargel. Und zwischendrin das normale
Donautal, wo der Weg am Fluss keine Sensationen bietet, dafür aber der Weg über
der Donau wunderbare Ausblicke bietet, die bei Föhnwetterlage bis zu den Alpen
reichen.
Für Radwanderer
ist der Fluss inzwischen bis nach Belgrad erschlossen, die Fortführung bis zur
Mündung in Vorbereitung. Der Donau-Radwanderweg ist der beliebteste Radwanderweg
der Welt. Wo bleibt da Platz für Wanderer?
Es gibt sie, die
Donauwanderwege! Teilweise sind es alteingeführte Wegeklassiker wie der
Alb-Südrandweg, der HW 2 des Schwäbischen Albvereins, teilweise neue,
zertifizierte Premium-Wanderwege wie der Jurasteig und der Donauberglandweg.
Manche dieser Teilstücke werden inzwischen pauschal angeboten als „Wandern ohne
Gepäck“. Ein durchgehender Donauwanderweg ist derzeit in Baden-Württemberg,
Bayern und Oberösterreich in Vorbereitung. Wir haben dazu im Jahr 2008 den
Abschnitt Donauwörth – Passau im Auftrag der „Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Donau“ und der regionalen Tourismusverbände erkundet und dokumentiert.
Einwände?
Natürlich tangiert der Wanderweg immer wieder mal den an schönen
Ferienwochenenden völlig überlaufenen oder besser überfahrenen Donau-Radweg, was
dann bei der Quartiersuche problematisch werden kann, denn der Wanderer ist
einfach weniger flexibel als der Radfahrer. Aber eine gute Vorbereitung beugt
negativen Überraschungen vor. Und unser Donauwanderweg versucht Asphaltstrecken
und langweilige Donaudämme zu meiden, obwohl er sich an der Donau orientiert. Er
schlängelt sich oft am Hang entlang, von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt, er
ist nicht nur gut wanderbar, sondern oft auch wunderbar – mit eingestreuten
„Durststrecken“.
Ein Weg
entlang der jungen Donau
Schönwald –
Furtwangen (12 km). Karte F 506
Von Schönwald
aus geht man auf dem Mittelweg des Schwarzwaldvereins zum E1 /
Schwarzwald-Westweg der zwischen Furtwänglehof und Elzquelle erreicht wird. Hoch
zur Martinskapelle, in deren unmittelbarer Nähe die Quelle der Breg zu finden
ist.
Nur im
Winterhalbjahr oder bei frisch gemähten Wiesen ist eine Fortsetzung der
Wanderung direkt an der Breg entlang nach Furtwangen sinnvoll, da ansonsten fast
nur die Straße benützt werden kann.
Es
gibt zwei Alternativwege:
Auf dem E1 / Westweg über den Brend (1149 m) bis zur Häusergruppe
Raben, hier auf dem Mittelweg hinunter nach Furtwangen. (12 km)
Zurück zum Furtwänglehof, dann auf dem Mittelweg, auf den
linksseitigen Höhen über dem Bregtal hinunter nach Furtwangen. (14 km)
Furtwangen –
Hammereisenbach-Bregenbach (14,5 km).
Karten F 506 und
F 507
Auf dem Querweg
Schwarzwald-Kaiserstuhl-Rhein wandern wir fast immer auf der ehemaligen
Eisenbahntrasse (auch als Radweg markiert) das Bregtal abwärts bis Vöhrenbach,
dann auf dem Bregtalweg hinunter bis Hammereisenbach-Bregenbach.
Hammereisenbach-Bregenbach – Donaueschingen (24 km).
Karte F 507
Der Bregtalweg
bringt uns nach Wolterdingen. Ab hier wieder mehrere Alternativen:
Breg-Puristen
gehen auf dem Waldweg durch die Bruggener Halde nach Bräunlingen, dann auf dem
Waldweg am Hangfuß rechts der Breg bis Hüfingen, schließlich auf Nebenstraßen
und Fußwegen in Bregnähe zum Zusammenfluss von Brigach und Breg bei
Donaueschingen.
Alternativen: a) Der Querweg führt direkt hinüber
ins Brigachtal und nach Donaueschingen. (17 km). b) Von Bräunlingen kann man
über den Schellenberg auf einem Wanderweg nach Donaueschingen gelangen. (19,5
km)
Donaueschingen – Geisingen (16 km). Karte F 507
Leider gibt es
nur einen Weg, den asphaltierten Donau-Radweg, der den Wanderer über Pfohren
nach Geisingen bringt. Ein Abstecher über den aussichtsreichen Wartenberg (844
m) lohnt sich.
Geisingen –
Tuttlingen (21 km). Karte F 507
Auch diese
Etappe muss auf dem Donau-Radweg gewandert werden: Von Geisingen über
Immendingen nach Tuttlingen. Bei Immendingen nicht die Donauver-sickerungen
übersehen!
Von
Tuttlingen bis Donauwörth
Ab Tuttlingen
folgen wir weitgehend dem HW 2, dem Alb-Südrandweg des Schwäbischen Albvereins,
der Tuttlingen mit Donauwörth verbindet, daher ist die folgende Wegbeschreibung
knapp gehalten.
Liebliche,
romantische Täler, in denen im Frühjahr Märzenbecher und Lerchensporn blühen,
ausgedehnte Wacholderheiden, die einzige Großstadt der Schwäbischen Alb, die
ehemalige Freie Reichsstadt Ulm mit dem höchsten Kirchturm der Welt, meist die
Donau in der Nähe, bei Föhn-Wetterlage Alpenfernsicht von der Zugspitze bis zum
Tödi, barocke Klöster, Burgruinen, aber im Nordosten dominierend das
Atomkraftwerk Gundremmingen. Als größte Sehenswürdigkeit der Durchbruch der
jungen Donau durch die Felsen der Schwäbischen Alb - und kurz davor der
Wasserdiebstahl durch den Rhein, die Donau-Versickerung - all das kennzeichnet
den HW2, den Schwäbische Alb - Südrandweg.
Er ist viel
weniger bekannt als der HW1, es gibt keinen Führer, der diesen Weg gut
beschreibt (der Kompass-Führer beschreibt Etappen von 33 und 41 km, der
Walz-Führer beginnt erst in Ulm), und auch mit den Karten und Quartieren ist es
zwischen Donauwörth und Giengen/Brenz schwierig. Aber der Weg lohnt sich!
Tipps: Die beste Wanderzeit ist März/April, wenn
die Märzenbecher und andere Frühblüher die Hänge bedecken. Ansonsten zu jeder
Jahreszeit schön - und natürlich bei Föhn! Aber daran denken: Der Föhn bricht
spätestens nach 1 - 2 Tagen zusammen, und das Wetter wird schlecht. Markierung:
Rotes Dreieck auf weißem Grund. Die Spitze weist nach Südwesten. Meine
Wegbeschreibung hält sich nicht immer exakt an die Wegmarkierung des
Schwäbischen Albvereins. Sie berücksichtigt eigene Erfahrungen und auch einige
Sehenswürdigkeiten, an denen man nicht vorbeigehen kann!
Zeichenerklärung: B Bus- oder Bahnanschluss, U
Übernachtungsmöglichkeit (nicht nur am Wochenende), E Einkehr ohne U, -->*
lohnender Abstecher, **Aussichtspunkt, besondere Sehenswürdigkeit
Tuttlingen
(B, U) - Ziegelhütte (E) [13 km] - (--> B, U in Fridingen) - [13 km] -
Wolferstal – Buttental – Bachtal – Eselstal - Schloss Bronnen - *Liebfrauental -
**Kloster Beuron (B,
U, *Naturschutzzentrum im Bahnhof) [10,5 km]
Alternativen:
a) Mühlheim – Beuron: Der neue zertifizierte Donauberglandweg.
b) Ziegelhütte – Beuron: *Talweg Ziegelhütte (E) – Scheuerlehof -
Jägerhaus (U) – Beuron [6,5 km]. Karte F 526
Beuron
- *Burg Wildenstein - **Eichfelsen [8 km] - *Schloss
Werenwag (nicht zu besichtigen) - *Schloss und Ruine
Hausen (B, U in
Hausen) [7 km].
Alternative: Beuron – Sigmaringen: Hohenzollernweg.
Karte F 526
Hausen
- *Schaufelsen - Thiergarten (B, U) [8 km] - **Donaudurchbruch durch die
Schwäbische Alb - *Inzigkofen (B, U) [10 km]. Karte F 526
Inzigkofen -
**Sigmaringen (B, U) [5 km] -
Bingen (B, U) 4 km.
Karte F 526
Bingen
– Billafingen - Friedingen [14 km] - *Große Heuneburg - Upflamör [6 km] -
*Kloster Zwiefalten
(B, U) 5 km. Karte F 527
Zwiefalten
- *Wimsener Höhle - Schloss Ehrenfels - *Glastal - Hayingen (B, U,
*Naturtheater) [11 km] - Maisenburg - **Großes
Lautertal (--> *U in Anhausen und Indelhausen) [6,5 km]. Karte F 524
Großes
Lautertal - Erbstetten - Granheim - Sondernach -
Hütten (U) [17 km].
Karte F 524
Hütten
- Talsteußlingen - Teuringshofen - *Kloster Urspring - Schelklingen (B,U,
*Hohler Fels) [10 km] - **Blaubeuren
(B, U) [8 km]. Karten F 524 und F 525
Blaubeuren
- Beiningen - Ermingen-Allewind [10 km] - *Oberer Kuhberg - **Ulm
(B, U) [8 km]. Karte F 525
Ulm
- Thalfingen (B, E) - *Kloster Oberelchingen (B, U) [10 km] -
Langenau (B, U,
*Museen, *Quellen) [7 km]. Karte F 525
Langenau
- Öllingen - Lindenau (*E, --> *Hohlenstein, *Bocksteinhöhlen im Lonetal) -
Stetten o.L. (U) [12 km] (--> *Vogelherdhöhle) - *Kaltenburg -
**Charlottenhöhle [4 km] - Hürben -
Giengen (Brenz (B, U)
[6 km]. Karte F 525
Alternative: Charlottenhöhle – Oberfinningen:
**Charlottenhöhle – Hermaringen - Pfannentalhaus (U) [12 km] - Haunsheim, U -
Wittislingen, U [6 km]. Karten F 525 und F 522
Giengen
– Oggenhausen[13 km] - Zöschingen -
Dischingen (U,
*Schloss Taxis) [8,5 km]
Alternativen:
a) Abkürzung Giengen/Brenz – Zöschingen über Staufen -
Syrgenstein 10 km, dann evtl. weiter bis Demmingen
b) Wittislingen - *Maria Medingen – Oberfinningen [8 km]. Karte F
522
Dischingen
oder Demmingen (U, --> *Schloss Duttenstein mit Wildpark) [11 km] -
Oberfinningen -
Unterliezheim (Mo-Fr B Dillingen, U, B). Karte L 7328
Unterliezheim
- Oberliezheim (E) [3 km] - Oppertshofen (E) [10 km] - Reichertsweiler -
Riedlingen - *Donauwörth
(B, U) [9 km]. Karte L 7328 und L 7330
Das sind rund
250 romantische Kilometer auf der Donauseite der Schwäbischen Alb!
Von
Donauwörth bis Passau
 Wir
hatten nicht lange mit der Zusage gezögert, als uns die Anfrage des
Touristik-Service Dietmann (www.touristik-service-agentur.de)
und der ARGE Deutsche Donau (www.deutsche-donau.de)
erreichte. Der Auftrag lautete: Erkundung eines neuen Weitwanderweges zwischen
Donauwörth und Passau, orientiert am Lauf der Donau, die Sehenswürdigkeiten
verknüpfend, den Donau-Radweg möglichst vermeidend, vorhandene, markierte
Wanderwege nutzend, die gute regionale Gastronomie und ihre
Übernachtungsmöglichkeiten genießend und das ganze nutzbar für ein Angebot
„Wandern ohne Gepäck“. Im Herbst 2008 war es dann so weit. Nachfolgend die
Etappen mit den wichtigsten Angaben. Hier ist das Ergebnis: Wir
hatten nicht lange mit der Zusage gezögert, als uns die Anfrage des
Touristik-Service Dietmann (www.touristik-service-agentur.de)
und der ARGE Deutsche Donau (www.deutsche-donau.de)
erreichte. Der Auftrag lautete: Erkundung eines neuen Weitwanderweges zwischen
Donauwörth und Passau, orientiert am Lauf der Donau, die Sehenswürdigkeiten
verknüpfend, den Donau-Radweg möglichst vermeidend, vorhandene, markierte
Wanderwege nutzend, die gute regionale Gastronomie und ihre
Übernachtungsmöglichkeiten genießend und das ganze nutzbar für ein Angebot
„Wandern ohne Gepäck“. Im Herbst 2008 war es dann so weit. Nachfolgend die
Etappen mit den wichtigsten Angaben. Hier ist das Ergebnis:
Donauwörth –
Marxheim, durch
Bayerisch Schwaben:
Auf interessanten Stadtwegen geht es durch die ehemalige Freie Reichsstadt
Donauwörth, dann steil hinauf auf die Monheimer Alb, den
 südlichsten
Teil der Fränkischen Alb. Aussichtsreiche Wege führen hoch über der Donau nach
Schloss Leitheim und nach Marxheim, dem letzten Ort Schwabens vor der „Grenze“
zur Pfalz. Strecke: ca. 19,5 km, Höhenmeter: ca. 200 m, Gehzeit: ca. 4,5 bis 5
h, Karte: UK L 15 südlichsten
Teil der Fränkischen Alb. Aussichtsreiche Wege führen hoch über der Donau nach
Schloss Leitheim und nach Marxheim, dem letzten Ort Schwabens vor der „Grenze“
zur Pfalz. Strecke: ca. 19,5 km, Höhenmeter: ca. 200 m, Gehzeit: ca. 4,5 bis 5
h, Karte: UK L 15
Marxheim –
Neuburg/Donau, von Schwaben in die Pfalz: Auch auf
dieser Etappe sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht. Bizarre Baumgestalten,
orchideenreiche Waldlichtungen im Auwald, blumenreiche Heiden am Albsüdrand,
Schmetterlinge vom Bläuling bis zum Schwalbenschwanz, Vogel- und Froschkonzerte
– die ganze Vielfalt der Natur kann erlebt werden. Und am Ende die pfälzische
Residenzstadt Neuburg/Donau mit prunkvollen Gebäuden. Strecke: ca. 22,5 km,
Höhenmeter: ca. 50 m, Gehzeit: ca. 5 bis 5,5 h, Karte: UK L 15
Neuburg/Donau
- Ingolstadt, zwischen der Residenzstadt und der Industrie- und Militärstadt:
Auwald und Donau. Prunkvoll verabschiedet sich die
Residenzstadt Neuburg. Die Donau und ihr Auwald, Altwässer und Biberlandschaft,
dazwischen Orchideenwiesen und Froschkonzert, aber auch kilometerlange Dammwege
an der Donau bestimmen das Bild dieser Etappe, die in der zweiten Großstadt an
der Donau endet. Strecke: ca. 23,5 km, Höhenmeter: ca. 30 m, Gehzeit: ca. 5 bis
5,5 h, Karte: UK 50-24
 Ingolstadt
- Vohburg, von der boomenden Großstadt in die beschauliche Kleinstadt:
Die Großstadt Ingolstadt verabschiedet den Wanderer mit schönen
Stadtwanderwegen. Bald aber bestimmt wieder der Auwald mit seinen Altwassern das
Bild. Hier hat die Rückkehr des Bibers nach Süddeutschland begonnen. Überall
sieht man seine Spuren: Biberrutschen, -wege, gefällte und abgenagte Bäume ….
Aber auch Kraftwerke und Erdölraffinerien drängen sich ins Bild. Ingolstadt
- Vohburg, von der boomenden Großstadt in die beschauliche Kleinstadt:
Die Großstadt Ingolstadt verabschiedet den Wanderer mit schönen
Stadtwanderwegen. Bald aber bestimmt wieder der Auwald mit seinen Altwassern das
Bild. Hier hat die Rückkehr des Bibers nach Süddeutschland begonnen. Überall
sieht man seine Spuren: Biberrutschen, -wege, gefällte und abgenagte Bäume ….
Aber auch Kraftwerke und Erdölraffinerien drängen sich ins Bild.
Strecke: ca.
16,5 km, Höhenmeter: ca. 20 m, Gehzeit: ca. 5 h, Karte: UK 50-24 und UK 50-25
Vohburg – Bad
Gögging, Bayerische Kleinstädte, Erdölraffinerien und schließlich ein
Mini-Kurort: Die große Donau, die Kleine Donau und
andere Altwasser begleiten den Wanderer. Auch die Ilm benutzt in ihrem Unterlauf
ehemalige Donau-Flussschlingen. Dazwischen ste-hende Gewässer, Froschgräben mit
entsprechendem Konzert, Störche, Reiher,
 Gänse,
Schwäne, Enten. Am Weg liegt das alt- bayerische Städtchen Neustadt. Das
Etappenziel ist Bad Gögging, ein kleiner, junger Kurort, wo man es sich gut
gehen lassen kann. Strecke: ca. 16,5 km, Höhenmeter: ca. 20 m, Gehzeit: ca. 4
bis 4,5 h, Karte: UK 50-25 Gänse,
Schwäne, Enten. Am Weg liegt das alt- bayerische Städtchen Neustadt. Das
Etappenziel ist Bad Gögging, ein kleiner, junger Kurort, wo man es sich gut
gehen lassen kann. Strecke: ca. 16,5 km, Höhenmeter: ca. 20 m, Gehzeit: ca. 4
bis 4,5 h, Karte: UK 50-25
Bad Gögging -
Kelheim, auf der Römerschlaufe des Jurasteigs zum Donaudurchbruch:
Premiumwege haben Konjunktur. Diese Wanderwege genügen,
was Wegführung und Markierung angeht, höchsten Ansprüchen und sind vom Deutschen
Wanderverband zertifiziert. Eine „Schlaufe“ des zertifizierten Jurasteigs wird
auf dieser Etappe begangen. Und schließlich ist der Donaudurchbruch beim Kloster
Weltenburg einer der schönsten Abschnitte der Donau überhaupt – und am besten zu
genießen per Schiff. Strecke: ca. 14,5 km zu Fuß und 6 km mit dem Schiff,
Höhenmeter: ca. 100 m, Gehzeit: ca. 4 bis 4,5 h, Karte: UK 50-25
 Kelheim –
Bad Abbach, Wandern auf dem
Jurasteig
am Südrand des Jura: Durch
Kelheims Altstadt, über die kanalisierte Altmühl, dann hinauf in den
Buchenwald des Goldbergs und über die Steppenheideflächen der Lehenberge. Danach
wieder ruhige Juralandschaft,
ehe sich vor Kapfelberg herrliche Ausblicke über das Donautal und die
Teufelsfelsen bei Bad Abbach bieten. Bei Poikam Wechsel aufs rechte Donauufer
und auf wunderschönen Waldpfaden durch idyllischen Hangwald und den Kurpark zu
den Kaiserthermen von
Bad Abbach. Kelheim –
Bad Abbach, Wandern auf dem
Jurasteig
am Südrand des Jura: Durch
Kelheims Altstadt, über die kanalisierte Altmühl, dann hinauf in den
Buchenwald des Goldbergs und über die Steppenheideflächen der Lehenberge. Danach
wieder ruhige Juralandschaft,
ehe sich vor Kapfelberg herrliche Ausblicke über das Donautal und die
Teufelsfelsen bei Bad Abbach bieten. Bei Poikam Wechsel aufs rechte Donauufer
und auf wunderschönen Waldpfaden durch idyllischen Hangwald und den Kurpark zu
den Kaiserthermen von
Bad Abbach.
Anmerkungen zum Abschnitt auf dem Jurasteig: Der
Weg ist sehr schön geführt, beinhaltet aber einige heftige Anstiege. Er ist
kurzweilig und meist sehr gut markiert (www.Jurasteig.de).
Leider sind die Jurasteig-Markierungen zum Teil Saboteuren zum Opfer gefallen.
Es waren keine Dumme-Jungen-Streiche oder stumpfsinnige
Vandalismus-Zerstörungen.
 Es wurden
ganz gezielt an sehr schwierig zu orientierenden Abzweigungen sämtliche
Markierungen entfernt, so dass nur der Kompass oder die genaue Untersuchung der
Bäume nach Alu-Nägeln weiterhelfen konnte. So geschehen mehrfach in den Wäldern
nördlich von Herrnsaal. Zusätzlich hat hier ein Groß-Agrarier sämtliche Graswege
inklusive Jurasteig umgepflügt, so dass wir hier eine eigene Wegführung finden
mussten. Auch zwischen Bad Abbach und Matting fehlen an einer entscheidenden
Abzweigung im Wald sämtliche Jurasteig-Markierungen. Hier kann man sich aber mit
den an den Bäumen aufgemalten Waldverein-Markierungen behelfen (siehe
Wegbeschreibung). Strecke: ca. 20,2 km, Höhenmeter: ca. 450 m, Gehzeit: ca. 5
bis 6 h, Karte: UK 50-25 Es wurden
ganz gezielt an sehr schwierig zu orientierenden Abzweigungen sämtliche
Markierungen entfernt, so dass nur der Kompass oder die genaue Untersuchung der
Bäume nach Alu-Nägeln weiterhelfen konnte. So geschehen mehrfach in den Wäldern
nördlich von Herrnsaal. Zusätzlich hat hier ein Groß-Agrarier sämtliche Graswege
inklusive Jurasteig umgepflügt, so dass wir hier eine eigene Wegführung finden
mussten. Auch zwischen Bad Abbach und Matting fehlen an einer entscheidenden
Abzweigung im Wald sämtliche Jurasteig-Markierungen. Hier kann man sich aber mit
den an den Bäumen aufgemalten Waldverein-Markierungen behelfen (siehe
Wegbeschreibung). Strecke: ca. 20,2 km, Höhenmeter: ca. 450 m, Gehzeit: ca. 5
bis 6 h, Karte: UK 50-25
Bad Abbach -
Regensburg. Auf dem Jurasteig und dem
E8
durchs
Regensburger Land:
Vom Schwefelbad – man kann es manchmal riechen – hoch über steilen
Felshängen mit Ausblicken auf die Donau geht es nach
Matting, einem Dorf, in dem die Zeit stehen geblieben ist:
 Viele
interessante, alte Gebäude, eine alte Gastwirtschaft – und nicht zuletzt die
über 55 Jahre alte Seilfähre, die Sie aufs linke Donau-Ufer zu Füßen des
Naturschutzgebiets „Mattinger
Hänge“ bringt. Hier wechseln Sie vom Jurasteig auf den Europäischen
Fernwanderweg 8. Regensburg,
einzige Freie Reichsstadt Altbayerns mit seinen Sehenswürdigkeiten aus zwei
Jahrtausenden erwartet Sie! Viele
interessante, alte Gebäude, eine alte Gastwirtschaft – und nicht zuletzt die
über 55 Jahre alte Seilfähre, die Sie aufs linke Donau-Ufer zu Füßen des
Naturschutzgebiets „Mattinger
Hänge“ bringt. Hier wechseln Sie vom Jurasteig auf den Europäischen
Fernwanderweg 8. Regensburg,
einzige Freie Reichsstadt Altbayerns mit seinen Sehenswürdigkeiten aus zwei
Jahrtausenden erwartet Sie!
Anmerkungen zum Abschnitt auf dem E8: Dieser
Europäische Fernwanderweg ist hier abwechslungsreich geführt und gut markiert.
In Sinzing wurde der E 8 verlegt. Wir haben den alten Weg benutzt, der auf der
Straße Richtung Regensburg entlang geht, aber eindeutig und kurz ist. Vielleicht
kann man auch der neuen E8-Markierung ohne große Umwege folgen? Strecke: ca. 16
km, Höhenmeter: ca. 300 m, Gehzeit: ca. 4,5 bis 5 h, Karte: UK 50-25
 Regensburg
- Bach an der Donau, von Regensburg ins einzige
Weinbaugebiet
Altbayerns:
Über die uralte Steinerne Brücke geht es aus Regensburg hinaus an die Donau.
Erste Vorboten des Weinbaus begegnen Ihnen in Tegernheim. Ehe wir sein Zentrum
in Bach an der Donau (Baierweinmuseum)
erreichen, gibt es noch Kultur und Geschichte satt in
Donaustauf und auf der
Walhalla. Und immer wieder
schöne Wanderwege am Hangfuß, aussichtsreich auf halber Höhe oder gar durch den
Thurn und Taxis’schen Wildpark mit beinahe garantierter Wildschweinbeobachtung.
Strecke: ca. 19,5 km, Höhenmeter: ca. 200 m, Gehzeit: ca. 5 bis 5,5 h, Karte: UK
50-26 Regensburg
- Bach an der Donau, von Regensburg ins einzige
Weinbaugebiet
Altbayerns:
Über die uralte Steinerne Brücke geht es aus Regensburg hinaus an die Donau.
Erste Vorboten des Weinbaus begegnen Ihnen in Tegernheim. Ehe wir sein Zentrum
in Bach an der Donau (Baierweinmuseum)
erreichen, gibt es noch Kultur und Geschichte satt in
Donaustauf und auf der
Walhalla. Und immer wieder
schöne Wanderwege am Hangfuß, aussichtsreich auf halber Höhe oder gar durch den
Thurn und Taxis’schen Wildpark mit beinahe garantierter Wildschweinbeobachtung.
Strecke: ca. 19,5 km, Höhenmeter: ca. 200 m, Gehzeit: ca. 5 bis 5,5 h, Karte: UK
50-26
Bach an der
Donau – Hofdorf / Kirchroth, vom Fürstentum
Thurn und
Taxis in die
Donau-Aue: Dieser Tag wird bestimmt durch das Fürstenhaus Thurn und
Taxis: Wildpark, Schloss Wiesent,
Schloss Wörth und andere
repräsentative Gebäude. Später dann ruhige Donau- Auenlandschaft
mit Altwässern, Streuwiesen, Bibernagespuren, Biberdämme und –wege, dazu seltene
Vögel. Der Kontrast dazu: Langsam vorbei ziehende Donau-Frachter und
Passagierschiffe aus vielen Auenlandschaft
mit Altwässern, Streuwiesen, Bibernagespuren, Biberdämme und –wege, dazu seltene
Vögel. Der Kontrast dazu: Langsam vorbei ziehende Donau-Frachter und
Passagierschiffe aus vielen
Donauländern.
Und in der Ferne grüßt schon die Gäuboden-Hauptstadt Straubing.
Strecke: ca. 18
km, Höhenmeter: ca. 300 m, Gehzeit: ca. 4 bis 5 h, Karte: UK 50-26
Hofdorf –
Straubing (- Bogen), durch die Donau-Aue in die Gäuboden-Hauptstadt:
Auch diese Etappe führt durch ruhige Donau-Auenlandschaft,
an Gräben entlang, am Fuß der Dämme und auch mal oben mit Aussicht auf den Fluss
oder auf die Altwässer. In der Stadt, in der Agnes Bernauer den Tod fand, in der
Gäuboden-Hauptstadt
 Straubing,
finden wir unser schönstes Quartier. Das Herzogsschloss, der großartige
Straßenmarkt und viele prunkvoll verzierte Barock- und Rokoko-Gebäude erfreuen
das Auge. Straubing,
finden wir unser schönstes Quartier. Das Herzogsschloss, der großartige
Straßenmarkt und viele prunkvoll verzierte Barock- und Rokoko-Gebäude erfreuen
das Auge.
Anmerkung zu den Wanderwegen im Raum Straubing – Bogen – Deggendorf:
Die vorhandenen örtlichen Wegmarkierungen sind sehr zuverlässig! Strecke: ca. 20
km, Höhenmeter: ca. 20 m, Gehzeit: ca. 4 bis 5 h,
Karte: UK 50-28
Straubing -
Straßkirchen, durch die Donau-Aue in die Gäuboden-Hauptstadt und weiter nach
Bogen:
Der Höhepunkt gleich am Anfang: Geologisch, botanisch und kulturhistorisch ist
der Bogenberg mit seinen wunder-/wanderbaren, bestens gepflegten Wanderwegen ein
wahres Wanderparadies. Dann über die Donau, ganz normale niederbayerische
Kulturlandschaft. Aber ein Wanderer Alptraum: Die amtliche Karte ist nicht
zuverlässig. Feld- und Waldwege gibt es nicht mehr – zugewachsen, ein Wegenetz
ist nicht vorhanden. Lange Abschnitte verlaufen (wie übrigens öfters an
Straßenneubaustrecken in Ostbayern) auf verkehrsreichen Auto-Rennstrecken ohne
Geh- oder Radweg. Quartiere und Einkehrmöglichkeiten fehlen oder sind von
miserabler Qualität. Deshalb planen wir die Etappe nach dem Bogenberg völlig um
und überprüfen die neue Trasse im Herbst.
Strecke: ca. 25
km, Höhenmeter: ca. 100 m, Gehzeit: ca. 6 bis 7 h, Karte: UK 50-28
Empfehlenswerte Alternative: Bogen - Metten 21 km
 Straßkirchen
- Deggendorf Straßkirchen
- Deggendorf
Ein Handwerker
nimmt uns mit nach Irlbach, da im August entgegen der bayerischen
Fahrplaninformation doch kein Bus fährt. Mangels Feld-, Rad- oder Wanderweg
müssen wir auf der Straße bis zur Donaufähre von Stephansposching gehen, die uns
für 0,50 € nach Mariaposching
bringt, wo der Donaudammweg über viele Kilometer angenehm nach
Deggendorf führt.
Strecke: ca. 18
km, Höhenmeter: ca. 20 m, Gehzeit: ca. 4 bis 5 h, Karte UK 50-28
Empfehlenswerte Alternative:
Metten – Deggendorf - Niederalteich – Winzer 23 km
Winzer –
Vilshofen – Windorf 19,5 km
Windorf –
Passau 22,6 km
Leider müssen
die letzten Abschnitte oft auf dem Donauradweg geführt werden, da es im engen
Donautal am Rand des Bayerischen Waldes kaum Platz für weitere Wege gibt!
Den Weiterweg
von Passau nach Linz erkunden derzeit unsere österreichischen Kollegen.
Ausführliche
Wanderberichte mit Bildern und exakter Wegbeschreibung für den neu erwanderten
Abschnitt zwischen Donauwörth und Passau sowie Wegbeschreibungen und viele
wichtige Links für den HW 2 gibt es im Internet unter
www.lustwandeln.net/donau.htm.
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
27 - Dezember 2008
Durch das Dahner Felsenland
Von Thomas Striebig
Ich
höre schon die kritischen Fragen:
Warum musst du denn jetzt auch andauernd noch in die Pfalz
fahren? - Weil sie eben da ist. Weil man dort so toll wandern und essen kann.
Und überhaupt …
Und: Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!
Ja, ja, um kluge Sprüche und Zitate bist du nie verlegen. - Werden die dadurch
falsch?
Aber in die Pfalz kannst du auch noch mit 80! - So? Dann zeig‘
mir doch mal bitte die 80-Jährigen, die diese Dreitagestour rund um Dahn in
dieser Weise gehen können! Viele wirst du nicht finden.
Du bist einfach hoffnungslos altmodisch. Kein bisschen im
Trend. - Das stimmt allerdings.
Für den Pfälzerwald, immerhin das größte zusammenhängende
deutsche Waldgebiet, gibt es eigentlich keine „beste Jahreszeit“, aber für den
Saisonausklang bietet er sich besonders an. So fuhren wir am 19. Oktober 2007
zum Ausgangspunkt unserer Dreitagestour rund um Dahn nach Bruchweiler-Bärenbach.
10 Uhr vormittags, bedeckter Himmel, Außentemperatur 2 Grad plus. Der Mensch ist
ein Wesen, das sehr viel vergisst, aber wann hat es einen solchen Kälteeinbruch
im Oktober zuletzt gegeben? Und die Natur schien die frühe Kälte bereits im Juli
zu ahnen und stellte sich durch besondere Eile darauf ein: Im Juli blühten auf
den Osttiroler Alpen Herbstblumen, um den 10. Juli war trotz des lausigen
Frühsommers schon der Almrausch verglüht, am 7. August sah ich in den Vogesen,
unweit der Weinstraße, verfärbte Wälder und die Schwalben waren bereits aus
Mannheim abgezogen. Gespannt hatte ich seitdem auf den Kälteeinbruch gewartet,
der dann auch kam.
Freilich störte er uns zunächst nicht, denn beim Gehen wurde uns
schnell warm und die herrliche Wasgau-Landschaft sorgte allemal für genügend
Ablenkung. Kurz durch bewohntes Gebiet, dann auf einem Sträßchen durch ein
herrliches, stilles Wiesental und schließlich auf abwechslungsreichem Weg ging
es hinauf zum ersten Zwischenziel, dem Spitzfelsen. Der heißt auch aus
ungeklärten Gründen „Napoleonsfels“; jedenfalls weiß von etwaigen
Besteigungsversuchen des Namenspatrons nicht einmal die Gerüchteküche.
Aber ein herrlicher Rastplatz ist die kleine Waldkuppe mit dem
schlanken Sandsteinturm allemal. Ebenso die Rasthütte am Wegtreffpunkt Am Hundel.
Und erst recht der Große Eyberg, mit 513 m Höhe bereits einer der Großen im
hügeligen Dahner Felsenland und zudem mit einem Aussichtsturm ausgestattet,
einem schlanken Eisengerüst, dem - wie so oft in der Pfalz - die Bäume der
Umgebung allmählich über den Kopf wachsen. Immerhin, man sieht noch so einiges:
Wälder, Berge, Wiesentäler, Dörfer. Aussichtspunkte im geschlossenen Waldgebiet
sind eh selten. Also wollen wir nicht meckern.
Im unmittelbaren Einzugsbereich von Dahn werden die Probleme
einer solchen Tour deutlich. Die liegen in der Orientierung. Das sollte man
eigentlich nicht glauben, schließlich sind wir hier doch in Deutschland und
nicht sonst wo! Aber die Kurverwaltung Dahn hat einfach des Guten zuviel getan.
Mehr als 60 mit Zahlen markierte Rundwanderwege, wo es maximal ein Drittel auch
getan hätte! Fast zwangsläufig sind die Zahlen oft lückenhaft angebracht,
Wegweiser zuweilen sporadisch, vor allem, wenn sie nicht zu einem
gastronomischen Stützpunkt leiten. Zahllose Wege im unübersichtlichen, hügeligen
Waldgelände sorgen für zusätzliche Verwirrung, selbst die vorzügliche
topografische Karte des Landesvermessungsamts Rheinland-Pfalz im Maßstab
1:25.000 hilft hier nur noch bedingt. Ich bin weiß Gott kein Wander-Frischling,
bin mir aber bei der Wegsuche um Dahn schon wie ein Idiot vorgekommen.
Bei dieser Tour passierte das allerdings nicht. Denn wir
benutzten zur Dahner Hütte ein Vorzeige-Projekt der Dahner, den „Dahner
Felsenpfad“. Der führt auf einer Länge von gut 12 km in stetem Bergauf und
Bergab an mehr als einem Dutzend bizarrer Sandsteintürme vorbei und bietet sich
sogar, da man in der Dahner Hütte am Wochenende übernachten kann, für Familien
mit kleineren Kindern als kindgerechte Zweitagestour an. Hier ist die Markierung
eher überreichlich, alle 20 oder 30 Meter findet man ein Täfelchen.
Wir folgten dem Felsenpfad nur ein Stück weit, wobei er,
tatsächlich als Pfad, an den eher kleinen Massiven des „Ungeheuerfelsen“ vorbei
führt, zuletzt durch einen ganz engen Durchschlupf, wo man schon den Bauch
einziehen muss und ein großer Rucksack etwas hinderlich ist. Ein herrliches
Wegstück! Weniger spektakulär erreicht man eine halbe Stunde später die auch
wochentags bewirtschaftete Dahner Hütte des Pfälzerwaldvereins (PWV), wo man,
wie in PWV-Hütten üblich, die Wahl zwischen Deftigem (Bratwürste, Leberknödel,
Saumagen, Weißem Käse) und einem reichhaltigen Kuchenangebot hat. Schon meldete
sich wieder mein unsichtbarer Kritiker: Du wanderst nur in der Pfalz, um dir bei
jeder Gelegenheit den Bauch mit Pfälzer Kuchen „wie von Oma gebacken“
vollzuschlagen. Richtig. Sonst noch was?
Auch der Weiterweg, anfangs wieder etwas unübersichtlich
bezeichnet, hielt noch Überraschungen parat. Zunächst kamen wir auf einem
unmarkierten, aber beschilderten Abstecher an weiteren Felsungetümen vorbei, dem
„Hexentisch“ und dem „Satansbrocken“, dann gelangten wir zur imposanten
Burgruine Neudahn, die trotz ihrer bescheidenen Höhe einen herrlichen Ausblick
bietet. Der Ausklang der Etappe bestand dann in einer weniger spektakulären
Talwanderung, anfangs auf dem Radweg Hinterweidenthal - Weißenburg (Wissembourg),
nach Hinterweidenthal, wo auch noch niemand verhungert oder verdurstet sein
dürfte.
Am zweiten Wandertag (strahlender Sonnenschein, aber nur wenige
Grad über Null ( brrr...)) war natürlich der kleine Abstecher zum
„Teufelstisch“, dem berühmtesten Felsen der Pfalz, obligatorisch. Anschließend
stand nur eine Halbtagesetappe auf dem Programm.
Aber was für eine! Die 10,5 Wanderkilometer von Hinterweidenthal
zum PWV-Wanderheim „Dicke Eiche“ gehören zum Schönsten, das die Pfalz zu bieten
hat. Zunächst noch in Hörweite der stark befahrenen Bundesstraße 10 (Landau -
Pirmasens) bergauf, allerdings auf herrlichem Hangpfad, auf der Südseite des
Bergrückens rasch bergab, vorbei an einer gefassten Quelle, in ein abgelegenes
Wald- und Wiesental, dieses am fast verlandeten „Schwarzen Mühlwoog“ vorbei
einwärts bis zum früher als Wiese genutzten, jetzt fast urwaldartigen Talschluss
„Am Stockwoog“ und kurz steiler Anstieg hinauf zur Unterstandshütte am
Wegtreffpunkt „Vier Buchen“, bis hierher in völliger Einsamkeit.
Die ist an den „Vier Buchen“ an schönen Wochenenden allerdings
vorbei, ohne dass von Massenbetrieb die Rede sein könnte. Freilich bietet der
folgende Höhenweg noch einmal eine Steigerung. Vorbei an einigen herrlichen
Aussichtspunkten und oft auf schmalen Hangpfaden gelangt man zuerst zur
Wallfahrtskapelle „Winterkirchel“, deren frei zugängliche Glocke speziell auf
Kinder und Narren einen unwiderstehlichen Reiz ausübt, weiter zum leider durch
Vandalismus zerstörten Naturdenkmal „Dicke Eiche“ und wenige Minuten später zum
gleichnamigen großen, stark frequentierten Wanderheim.
Und weil der Tag ja noch einige Sonnenstunden zu bieten hatte,
bummelten wir noch hinüber zum „Hühnerstein“. Das ist ein vielleicht 15 m hoher
Felsturm auf einer kleinen Anhöhe, etwa 450 m über dem Meer und über eine Leiter
mit 39 Sprossen zu besteigen - aber was für ein Aussichtspunkt! Zudem sind in
letzter Zeit dort viele Bäume gefällt worden, sodass die Sicht jetzt völlig frei
ist. Man überblickt große Teile des östlichen Wasgaus mit den Burgen Trifels und
Lindelbrunn und erkennt bei klarem Wetter - das wir hatten - sogar den
Nordschwarzwald. Selten habe ich in der Pfalz eine so eindrucksvolle Gipfelrast
erlebt wie am 20. Oktober auf dieser kleinen Felskanzel.
Im Wanderheim „Dicke Eiche“ ging es an diesem Wochenende lustig
zu. Schuld daran war ein Fußballverein aus der Umgebung, der seine sportliche
Zukunft sichtlich hinter sich, dafür aber umso mehr vor sich hatte, vor sich auf
dem Tisch, versteht sich. Andauernd gaben die fröhlichen Zecher dem nicht so
ganz freiwilligen Publikum Lieder zum Besten, in denen die Wanderseligkeit aus
Urgroßvaters Zeiten hochgehalten wurde: „o Heiiiiimatlaaaaaand…“. Mag sein, dass
das eine Generationsfrage ist, aber mich macht verlogenes Liedgut geradezu
aggressiv; meine jugendlichen Mitwanderer sahen das Ganze pragmatischer und
machten sich darüber lustig. Am Abend torkelte einer dieser Sportsfreunde an
unseren Tisch und erkannte erst im letzten Augenblick, dass wir nicht zu seinem
Verein gehörten.
So etwas kann natürlich auf Hütten immer passieren, zumal in der
Pfalz. Aber das Wanderheim „Dicke Eiche“ ist so geräumig, dass wir den
Krachmachern ganz gut aus dem Weg gehen konnten. Wir machten einen kleinen
Nebenraum ausfindig und hatten prompt unsere Ruhe. Auch unsere Nachtruhe verlief
ungestört. Das Haus ist im Übrigen durchweg gepflegt und wirkt insgesamt sehr
einladend (das gilt im selben Maß oder noch mehr für die bereits erwähnte Dahner
Hütte). Und eine schlecht bewirtschaftete PWV-Hütte habe ich ohnedies noch nie
erlebt.
Der dritte Tag brachte die befürchtete Wetterverschlechterung;
vorläufig blieb es allerdings noch trocken. Wir folgten dem Höhenweg weiter nach
Süden, an einer Stelle unübersichtlich bezeichnet (dort muss man sich links
durch ein kurzes hohlwegartiges Stück halten und findet bald wieder die
Farbkleckse), aber wieder auf herrlichen Wegen; einmal ging es direkt unterhalb
eines felsigen Kamms entlang. Schließlich schlugen wir uns in den Ort Busenberg
durch, um von dort zum „Drachenfels“ zu gelangen, ein Wegstück, das schon
allerlei Witzeleien provoziert hat („weiblicher Lebenslauf“). Ein kleines,
idyllisches Wiesental, ein kurzer Waldanstieg und man erreicht - nun, was wohl?
Eine PWV-Hütte mit der obligatorischen deftigen Pfälzer Hausmannskost.
Hat der Pfälzerwaldverein ein Nachwuchsproblem? Diese Frage
stellte sich mir spätestens hier. In allen drei PWV-Hütten, die wir berührten,
lag das Alter der Vereinsmitglieder, die am Wochenende für die Bewirtschaftung
sorgten, jenseits der Fünfzig, wenn nicht der Sechzig. Und mir fiel auf, dass
die PWV-Markierungen zwar im Wesentlichen noch zuverlässig, aber nicht mehr so
lückenlos wie vor ein paar Jahrzehnten sind. In den Vogesen sind sie
beispielsweise insgesamt besser. Wie mag es im Pfälzerwald in 20 oder 30 Jahren
aussehen?
Aber auch ohne Markierung kommt man problemlos von der
Drachenfelshütte zur gleichnamigen Ruine hinauf. Dieser nur wenige Minuten
erfordernde Abstecher ist ein absolutes Muss. Denn die Felsruine ist von einer
Wildheit, wie man sie aus den benachbarten Nordvogesen kennt. Sie liegt höchst
exponiert auf einer Bergkuppe und bietet ein umfassendes 360°-Panorama. Zudem
ist der Aufstieg, immer wieder über gesicherte Galerien, schon ein kleines
Abenteuer und, nebenbei bemerkt, nichts für Leute mit sehr starker Höhenangst
und auch nicht unbedingt bei Vereisung zu empfehlen.
Der Rest war eine ordentlich markierte, zügige Wanderung zurück
zum Ausgangspunkt; dass der Regen uns jetzt doch noch erwischte und das
abschließende Stück, ein Teil des von Deutschland nach Frankreich führenden „Zabern-Wegs“
oder „Sentier Tres Tabernae“, nur mit sehr verwaschenen roten Rauten markiert
war, störte uns auch nicht mehr. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass Regen und
Zeitknappheit uns daran hinderten, noch dem „Jüngstberg“, den wir teilweise
umwanderten, unsere Aufwartung zu machen. Aber man braucht ja einen Grund
wiederzukommen! Wobei man den im Pfälzerwald ebenso sicher findet wie
Leberknödel und Saumagen.
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
27 - Dezember 2008
Pfingsten 2008: Unterwegs im Odenwald
Von Walter Brückner
Karten:
Topographische Freizeitkarte 1 : 50.000 „ Nördlicher Odenwald" NO Ost und NO
West ISBN 978-3-89446-291-8
Topographische Karte 1 : 50.000 „Odenwald" Blätter Südost und Südwest,
Landesvermessungsamt Baden-Württemberg
Führer: Siegfried Joneleit „Odenwald",
Verlagshaus Elster, Serie „Leichter Wandern" ISBN 3-89151-180-9
Bernhard Pollmann, „Odenwald",
Rother Wanderführer,
ISBN 3-7633-4151-X
Andreas Stieglitz, „Wandern im
Odenwald und an der Bergstraße",
DuMont aktiv, ISBN 3-7701-5015-5
Helmut Dumler, „Rundwanderungen Odenwald", J. Fink Verlag, Stuttgart
Thomas Klein, „Wanderbuch für
Spessart, Odenwald, Taunus und Vogelsberg", BLV Verlagsgesellschaft, München,
ISBN 3-405-13525-7
Internet: Unter
www.odenwald.de findet
man viele Informationen zu Wanderwegen, Sehenswürdigkeiten,
Übernachtungsmöglichkeiten usw. im Odenwald
Der Odenwald ist
ein wunderbares Wandergebiet mit gut ausgebauten und markierten Wegen,
zahlreichen Sehenswürdigkeiten sowie malerischen Orten und Städtchen, er wird
aber leider durch die bekannteren Mittelgebirge etwas in den Hintergrund
gedrängt.
Der Odenwald ist
auch in wenigen Tagen zu durchqueren, unabhängig von der Richtung, die man
einschlägt. Die Wanderführer bieten deshalb fast ausschließlich Tagestouren an.
Wer länger unterwegs sein will findet Hilfe im Internet, wo er auf den „Odenwald
Schmetterling" stößt, mehrtägige Wanderstrecken, die grob in der Form von
Schmetterlingsflügeln angeordnet sind, oder muss seine Strecke selbst
zusammenbasteln.
Ein günstiger
Ausgangspunkt für Wanderungen ist Heidelberg: Es ist verkehrsmäßig gut zu
erreichen, bietet viele Sehenswürdigkeiten und ebenfalls viele (wenn auch
teuere) Unterkunftsmöglichkeiten.
Seit langen Jahren
nutze ich die Pfingstzeit zu Wanderungen in Deutschland, üblicherweise zu zweit
oder zu dritt. In den letzten Jahren jedoch ist der Stamm der Mitwanderer
erfreulicherweise gewachsen. So hatte ich dieses Jahr fünf Begleiter.
Start- und Zielpunkt der Wanderung war Heidelberg.
Üblicherweise buche ich nur am Startpunkt Quartier. Da der Beginn der Wanderung
diesmal genau auf das Pfingstwochenende fiel, und ich befürchtete, die
Übernachtungsmöglichkeiten könnten ausgebucht sein, buchte ich ausnahmsweise die
ersten vier Quartiere rechtzeitig vorher.
Wir trafen am
Freitagnachmittag in Heidelberg ein. Untergebracht waren wir im Hotel
„Rosengarten", oberhalb von Ziegelhausen, gut eine Wegstunde von Heidelbergs
Altstadt entfernt. Das Restaurant des Hotels war verpachtet, aber der Pächter
hatte es noch nicht eröffnet, also kein Abendessen und kein Frühstück.
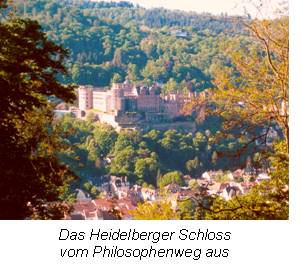 1.
Wandertag 1.
Wandertag
Heutiges Ziel ist
Neckarsteinach, die Vier-Burgen-Stadt, gerade mal 15 km entfernt, aber natürlich
mache ich es uns nicht ganz so einfach, sondern habe ein paar Schikanen
eingeplant.
Bei herrlicher
Sonne laufen wir um 8.00 Uhr los, auf dem Neckartal-Randweg Richtung Heidelberg,
werden zum berühmten Aussichtsweg „Philosophen-weg" geleitet und steigen um 9.00
Uhr den „Schlangenweg" hinunter zur „Alten Brücke". Über sie gelangen wir direkt
in die Altstadt, zur Heilig-Geist Kirche, dem Hotel Ritter und dem Marktplatz.
 Die
Wanderkameraden/In wollen nicht auf ihren Morgenkaffee verzichten, also beehren
wir das Cafe am Markt, das erfreulicherweise schon offen ist, um wenigsten etwas
Warmes zu trinken. Um 10.00 Uhr geht es weiter, Treppen hinauf zum Eingang des
Schlosses. Ursprünglich hatte ich geplant, den „Königstuhl", 566 m und Hausberg
Heidelbergs, auf der „Himmelsleiter“ zu ersteigen. Das sind Stufen, die vom
Schloss fast bis zum Gipfel führen. Nach den Treppen hinauf zum Eingang des
Schlosses ziehe ich dann den normalen Wanderweg vor. Die
Wanderkameraden/In wollen nicht auf ihren Morgenkaffee verzichten, also beehren
wir das Cafe am Markt, das erfreulicherweise schon offen ist, um wenigsten etwas
Warmes zu trinken. Um 10.00 Uhr geht es weiter, Treppen hinauf zum Eingang des
Schlosses. Ursprünglich hatte ich geplant, den „Königstuhl", 566 m und Hausberg
Heidelbergs, auf der „Himmelsleiter“ zu ersteigen. Das sind Stufen, die vom
Schloss fast bis zum Gipfel führen. Nach den Treppen hinauf zum Eingang des
Schlosses ziehe ich dann den normalen Wanderweg vor.
Die Wegweiser
hier sind Sandsteinblöcke, in die die Wanderziele bzw. Wegnamen sowie
Richtungspfeile eingemeiselt sind. Als wir sehr bald auf den „Friesenweg"
stoßen, geht ein Grinsen über die Gesichter, denn der „Friesenweg" (Osnabrück
bis Papenburg) und der sich daran anschließende „Ostfriesenweg" (Papenburg bis
Bensersiel) war die letztjährige Pfingstwanderung.
Bald ist die
„Molkenkur" erreicht. Hier wurde 1853 ein Restaurant eröffnet, in dem den Gästen
Ziegenmolke als Kurgetränk angeboten wurde. Und weiter geht es. Der Weg wird
steiler, kreuzt die Trasse der Bergbahn zwei Mal, und um 11.30 Uhr ist die
Bergstation der Bahn erreicht. Von der Terrasse hat man einen großartigen Blick
hinunter in die Stadt und die Ebene und auf den „Heiligenberg" gegenüber. Am
Kiosk holen wir uns die nötige Auffrischung unserer Flüssigkeitsreserven.
Um 12.00 Uhr
machen wir uns wieder auf die Socken. Vorbei an einer Falknerei auf einem
breiten Waldweg erst eben, dann abwärts. Diverse Künstler haben hier ihre Spuren
hinterlassen: eine Statue, zusammengesetzt aus Müllteilen, geschnitzte Bänke und
Tierfiguren am Wegesrand. Es ist inzwischen sehr heiß geworden, aber wir laufen
viel im Schatten.
Schließlich sind
wir unten am Neckar, am Ortseingang von Neckargemünd. In der Mittagshitze
entlang der Bundesstraße durch den Ort. Alle von uns wollen einkehren, aber ein
Gasthaus ist geschlossen, das nächste liegt voll in der Sonne. So folgen wir der
Straße entlang des Flusses weitere 2 km bis Rainbach, wo wir eine große
Wirtschaft finden mit einem schönen Biergarten und uns im Schatten riesiger
Kastanien erholen können. Kurz nach 15.00 Uhr brechen wir wieder auf. Jetzt geht
es steil hinauf auf den Dilsberg.
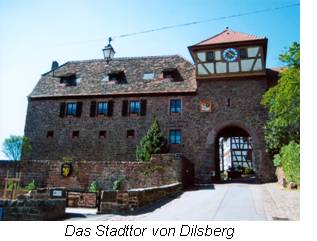 Oben
liegt der Ort Dilsberg, mit einer Stadtmauer und einer Burgruine mit
unterirdischem Gang. Der Dilsberg ist ein Umlaufberg, das heißt, dass der Neckar
ursprünglich einen anderen Verlauf hatte. Im alten Flusstal wurde in den Sand-
und Kiesgruben von Mauer unter anderem der Kieferknochen des „Homo
Heidelbergensis“ gefunden. Oben
liegt der Ort Dilsberg, mit einer Stadtmauer und einer Burgruine mit
unterirdischem Gang. Der Dilsberg ist ein Umlaufberg, das heißt, dass der Neckar
ursprünglich einen anderen Verlauf hatte. Im alten Flusstal wurde in den Sand-
und Kiesgruben von Mauer unter anderem der Kieferknochen des „Homo
Heidelbergensis“ gefunden.
Wir haben beim Aufstieg keinen Schatten. Direkt unter der
Stadtmauer wird es Mechthild schwarz vor Augen, und sie muss sich hinlegen. Ich
bin überrascht! Mechthild, unsere Powerfrau, ist mit die Fitteste von uns. Die
hat Probleme? Hundert Meter weiter, kurz vor dem Mauertor, ist eine Sitzgruppe
im Schatten. Dort lassen wir uns nieder, bis Mechthild sich wieder erholt hat.
 Gegen
16.00 Uhr gehen wir durch das Tor in den Ort, hindurch, auf der Rückseite wieder
hinaus und in Serpentinen steil hinunter zum Stauwehr und der Schleuse von
Neckarsteinach. Wir überqueren den Fluss auf dem Steg des Wehrs und laufen
entlang der Straße zurück in den Ort. Um 16.43 Uhr ist unser Quartier, Pension
„Neckarblick", in der Bahnhofstraße erreicht. Erwins Schrittzähler zeigt 25,3 km
an. Das Quartier ist recht angenehm. Später machen wir noch einen kleinen
Stadtbummel und nehmen im Biergarten des „Schwanen" ein Abendessen ein, bevor
wir dann auf der Dachterrasse unserer Pension bei einem Glas Rotwein über
Wanderziele der nächstjährigen Pfingsttour beraten. Wir einigen uns auf den
„Goldsteig". Gegen
16.00 Uhr gehen wir durch das Tor in den Ort, hindurch, auf der Rückseite wieder
hinaus und in Serpentinen steil hinunter zum Stauwehr und der Schleuse von
Neckarsteinach. Wir überqueren den Fluss auf dem Steg des Wehrs und laufen
entlang der Straße zurück in den Ort. Um 16.43 Uhr ist unser Quartier, Pension
„Neckarblick", in der Bahnhofstraße erreicht. Erwins Schrittzähler zeigt 25,3 km
an. Das Quartier ist recht angenehm. Später machen wir noch einen kleinen
Stadtbummel und nehmen im Biergarten des „Schwanen" ein Abendessen ein, bevor
wir dann auf der Dachterrasse unserer Pension bei einem Glas Rotwein über
Wanderziele der nächstjährigen Pfingsttour beraten. Wir einigen uns auf den
„Goldsteig".
 2.
Wandertag, Pfingstsonntag 2.
Wandertag, Pfingstsonntag
Gegen 9.00 Uhr brechen wir auf, heute mit Früh-stück. Das
Wetter ist wie gestern, was bedeutet, dass wir uns auf einen heißen Tag gefasst
machen müssen. Heutiges Tagesziel ist Eberbach. Zunächst laufen wir zurück
Richtung Stauwehr. Unsere Markierung wird das rote
R des
rechten Neckarrandweges sein. Wir steigen die Darsberger Straße aufwärts, weil
die weiter oben den Randweg kreuzt, biegen bei den letzten Häusern aber schon
auf einen breiten Waldweg ein, der leicht aufwärts führt und uns direkt zum
Randweg bringt. Der angenehm zu gehende
Weg
steigt erträglich und verläuft nur gelegentlich eben oder abwärts. Das
Blätterdach schützt uns weitgehend vor der heißen Sonne. Der Randweg läuft alle
Täler aus und ist dadurch länger als eigentlich nötig, läuft sich aber wirklich
gut.
 Schließlich
steigen wir steil hinunter nach Hirschhorn. Um 12.10 Uhr laufen wir im Ort ein
und steuern sofort das Café Hirschhörnchen am Rand der Altstadt an. Eine
„Tankpause" ist jetzt dringend geboten. Mit Mineralwasser oder Radler füllen wir
unser Flüssigkeitsreservoir wieder auf. Um 12.50 Uhr geht es weiter. Durch die
Altstadt und anschließend Treppen steil hinauf zum Schloss, was uns wieder auf
Betriebstemperatur bringt. Es geht allerdings noch weiter aufwärts, bis die
Reisehöhe wieder geschafft ist. Zu unserem Leidwesen verläuft der Weg jetzt
häufig in der Sonne, was uns ganz schön schlaucht. Schließlich
steigen wir steil hinunter nach Hirschhorn. Um 12.10 Uhr laufen wir im Ort ein
und steuern sofort das Café Hirschhörnchen am Rand der Altstadt an. Eine
„Tankpause" ist jetzt dringend geboten. Mit Mineralwasser oder Radler füllen wir
unser Flüssigkeitsreservoir wieder auf. Um 12.50 Uhr geht es weiter. Durch die
Altstadt und anschließend Treppen steil hinauf zum Schloss, was uns wieder auf
Betriebstemperatur bringt. Es geht allerdings noch weiter aufwärts, bis die
Reisehöhe wieder geschafft ist. Zu unserem Leidwesen verläuft der Weg jetzt
häufig in der Sonne, was uns ganz schön schlaucht.
Um 15.00 Uhr
durchqueren wir Igelsbach, die blühenden Apfelbäume überall sind eine Pracht.
Eberbach ist in der Ferne bereits in Sicht. Die letzten Kilometer verlaufen
leider auf Teer. Um 15.45 Uhr passieren wir das Ortsschild, um 16.00 Uhr ist das
Hotel „Karpfen" erreicht, unser Quartier, mitten in der Altstadt. Erwins
Schrittzähler zeigt 26,7 km an. Später machen wir den üblichen Stadtbummel und
schauen uns die hübschen Fachwerkhäuser der Altstadt an. Unser Abendessen nehmen
wir im Biergarten des „Krabbenstein" ein.
 3.
Wandertag, Pfingstmontag 3.
Wandertag, Pfingstmontag
Wir frühstücken um 7.30 Uhr und lassen uns Zeit dabei. Das
Wetter ist wie gestern: sonnig und trocken. Heutiges Tagesziel ist Mudau. Der
Abmarsch erfolgt um 8.40 Uhr. Durch den Ort und steil aufwärts, bis wir wieder
auf das rote
R des
Randwegs treffen, dem wir noch bis zum Schloss Zwingenberg folgen.
Nachdem erst
einmal die erste Höhe geschafft ist, hält sich das Auf und Ab einigermaßen in
Grenzen. Über den Aussichtspunkt „Teufelskanzel" geht es weiter, bis nach
längerem Abstieg in Höhe der Bahnlinie Schloss bzw. Burg Zwingenberg erstmals in
Sicht kommt. Anders als erwartet führt der Randweg nicht direkt zur Burg, zu der
wir eigentlich hinwollten, um dort dann in die Wolfsschlucht einzusteigen.
Angeblich hat die wilde Schlucht den berühmten Schlossgast C. M. von Weber zu
seinem „Freischütz" bzw. der Schluchtszene darin inspiriert.
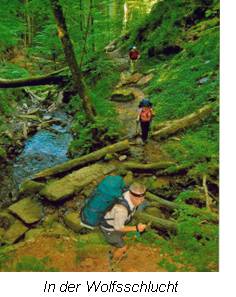 Stattdessen
steigen wir ein ganzes Stück am Rand der Schlucht aufwärts und können später
einsteigen, um wenigstens noch die zweite Hälfte der Schlucht hinaufzukraxeln.
Um 11.20 Uhr legen wir dann am Ende der eigentlichen Schlucht Stattdessen
steigen wir ein ganzes Stück am Rand der Schlucht aufwärts und können später
einsteigen, um wenigstens noch die zweite Hälfte der Schlucht hinaufzukraxeln.
Um 11.20 Uhr legen wir dann am Ende der eigentlichen Schlucht
die erste Rast ein. Waren wir von Eberbach aus dem
Neckar ziemlich direkt nach Osten gefolgt, laufen wir jetzt in nördlicher
Richtung.
Bald weiter. Nach
kurzer Zeit verlassen wir den schattigen Wald und laufen in der prallen Sonne
das Sträßchen aufwärts Richtung Oberdielbach. Auf dem Scheitelpunkt des
Sträßchens liegen der Sportplatz und das Vereinsheim des Sportklubs. Da ein
Fußballspiel angesetzt ist, ist die Vereinsgaststätte geöffnet. Dankbar nehmen
wir die Gelegenheit wahr, kühle Getränke zu einem sehr günstigen Preis zu
bekommen.
Um 13.15 Uhr brechen wir wieder auf, frisch gestärkt, aber
weiterhin voll in der Sonne. Folgen der Straße hinunter nach und durch
Oberdielbach. Eigentlich hatten wir noch den nahen Katzenbuckel, mit 626 Metern
höchster Berg des Odenwalds, mitnehmen wollen. Aber in Anbetracht der Zeit und
der noch zu bewältigenden Strecke verzichten wir darauf. Weiter nach
Strümpfelbrunn und dann nach Mülben. In der offenen Landschaft sehen wir überall
blühende Bäume. In Mülben verlassen wir den markierten Weg, da er nicht dahin zu
führen scheint, wo er laut Karte hin sollte. Laufen nach Karte und
der Nase und landen schließlich auf einer Straße, an der Abzweigung nach
Wagenschwend. Laufen hinunter in den Ort und kehren um 15.45 Uhr in der „Linde"
ein. 30 Minuten später geht es weiter, zunächst auf der Straße, dann auf dem
Limesweg. Der Weg ist nicht immer klar, teilweise laufen wir direkt durch den
Wald ohne Weg, sind aber immer richtig. Die Zeit verrinnt, der eine oder andere
spürt seine Knochen. Ab
Langenelz
sind wir wieder auf Teer.
 Um
18.30 Uhr, endlich, laufen wir durch den kleinen Ort Mudau. Unser Quartier, der
„Löwen", ist schnell gefunden. Erwins Zähler zeigt 33 km an. Die Dusche ist
heute besonders wohltuend. Wir essen danach im Haus und bummeln anschließend
noch durch den Ort. Um
18.30 Uhr, endlich, laufen wir durch den kleinen Ort Mudau. Unser Quartier, der
„Löwen", ist schnell gefunden. Erwins Zähler zeigt 33 km an. Die Dusche ist
heute besonders wohltuend. Wir essen danach im Haus und bummeln anschließend
noch durch den Ort.
4. Wandertag
Im 7.30 Uhr
sitzen wir beim Frühstück und um 8.30 Uhr sind wir unterwegs. Heutiges Ziel ist
Miltenberg am Main. Das Wetter ist wie an den vergangenen drei Tagen: sonnig und
heiß. Auf der Straße aus dem Ort. Dann hinüber zum rechten Talrand, wo wir auf
unsere derzeitige Markierung, einen blauen Rhombus, stoßen und ihr folgen.
Erfreulicherweise werden wir uns für längere Zeit im Wald, und damit im
Schatten, aufhalten.
Erstes Teilziel ist die Ruine der Wildenburg. Wolfram von
Eschenbach hat dort zumindest Teile seines Parzivals geschrieben und die Burg
wohl auch als Modell für die Gralsburg genommen. Der Weg führt nicht direkt dort
hin, aber ein markierter Querweg - vielleicht sogar ein Hinweisschild - wird uns
hinbringen. Wir stoßen auf einige Querwege und überprüfen alle genau, aber eine
Markierung entdecken wir nirgendwo, von einem Hinweisschild ganz zu schweigen.
Also trotten wir weiter aufwärts. An einer Stelle, wo der allgegenwärtige Wald
zum Tal hin eine Lücke aufweist, sehen wir auf einem Sporn in der Talmitte die
Ruine liegen. Wir haben
ganz offensichtlich die Abzweigung verpasst. Das ist mehr als ärgerlich, aber
nicht zu ändern. Zurück will keiner.
 Der
angenehme Waldweg ist inzwischen zu einem schrecklichen Schotterweg geworden und
führt uns kurz hinter dem Dorf Buch hinunter auf einen guten Weg, der parallel
zur Straße nach Amorbach läuft. Wir folgen ihm die paar Kilometer. Um 11.40 Uhr
laufen wir in Amorbach ein und passieren die ehemalige Benediktinerabtei. Vor
einem griechischen Restaurant unterhalb der Kirche pausieren wir mit
Mineralwasser bzw. Radler. Die Rast dauert bis 12.30 Uhr. Der
angenehme Waldweg ist inzwischen zu einem schrecklichen Schotterweg geworden und
führt uns kurz hinter dem Dorf Buch hinunter auf einen guten Weg, der parallel
zur Straße nach Amorbach läuft. Wir folgen ihm die paar Kilometer. Um 11.40 Uhr
laufen wir in Amorbach ein und passieren die ehemalige Benediktinerabtei. Vor
einem griechischen Restaurant unterhalb der Kirche pausieren wir mit
Mineralwasser bzw. Radler. Die Rast dauert bis 12.30 Uhr.

Der rote Rhombus seit Buch wird jetzt vom blauen abgelöst.
Durch den Ort und in der prallen Sonne gehen wir hinauf auf den Gotthardsberg.
Oben hat eine Planierraupe gewütet. Auf dem so bearbeiteten Weg geht es steil
hinunter nach Weilbach. Hier wird das gelbe Dreieck unsere neue Markierung.
Aufwärts, aufwärts, aufwärts, nicht immer steil, aber häufig in der Sonne. Der
Weg zieht sich. Gegen 14.30 Uhr gönnen wir uns auf frisch gefällten Bäumen am
Greinberg eine Pause. Bald geht es in Serpentinen hinauf auf den Schlossberg und
oben einen hässlich planierten Weg mit tiefen
Fahrspuren entlang. Miltenberg ist in Sicht, aber der Abhang hier ist äußerst
steil. Ein Stück weiter führt der Weg dann hinunter. Die letzten 100 Meter vor
der Stadt sind entweder durch einen Sturm oder eine Fällaktion oder beides
blockiert. Glücklicherweise lässt sich dieses kurze Stück leicht umgehen, so
dass wir die letzten Meter auf der Originalroute laufen können und direkt am
Alten Markt herauskommen (15.45 Uhr).
 Vor
jeder Wanderung suche ich mir im Internet von jedem größeren Ort an der
Wanderstrecke alle akzeptablen Quartiere heraus und notiere sie mit Adresse,
Telefonnummer, Bettenzahl und Preisen. So können wir gegebenenfalls von
unterwegs schon anrufen, ob man Platz für uns hat. Vor
jeder Wanderung suche ich mir im Internet von jedem größeren Ort an der
Wanderstrecke alle akzeptablen Quartiere heraus und notiere sie mit Adresse,
Telefonnummer, Bettenzahl und Preisen. So können wir gegebenenfalls von
unterwegs schon anrufen, ob man Platz für uns hat.
Heute haben wir
nicht angerufen, aber es ist ja ausreichend Zeit, etwas zu finden. Ich habe das
Gasthaus „Anker“ im Visier. Durch die Fußgängerzone der herrlichen Altstadt
gehen wir bis zum „Anker". Es ist gerade 16.00 Uhr. Ja, sie haben Platz für uns.
Erwins Zähler zeigt 25,6 km an. Um 18.00 Uhr nehmen wir dann unten in der
Wirtschaft ein Abendessen ein. Anschließend schauen wir uns gemütlich den Ort
an, bevor wir beim Weingut Steuer hiesige Sorten probieren.
 5.
Wandertag 5.
Wandertag
Um 7.20 Uhr
sitzen wir beim Frühstück und um 8.20 Uhr brechen wir auf. Heutiges Ziel ist
Michelstadt/Erbach. Das Wetter ist weiterhin sonnig, heute aber recht schwül.
Einige versorgen sich noch beim Bäcker und in anderen
Läden mit Verpflegung, dann sind wir ernsthaft unterwegs. Zum Mainufer, Main
abwärts Richtung Kleinheubach. Wir folgen nun bis Bensheim an der Bergstraße dem
Nibelungenweg (Markierung gelbes Quadrat). Bald leitet man uns aber durch das
Industriegebiet
Richtung Rüdenau und kurz darauf finden wir uns im Wald
wieder. An einer starken Quelle teste ich das Wasser und fülle meine
Wasserflasche damit anstatt mit dem Leitungswasser.
Um 10.10 Uhr durchqueren wir Rüdenau
und treffen dort auf eines der seltenen Schilder, die auf den „Odenwald
Schmetterling" hinweisen. Nächstes Ziel ist Vielbrunn. Dafür dürfen wir erst
einmal wieder aufsteigen, auf zunächst angenehmen Wegen. Als aber die Höhe
geschafft ist, stoßen wir auf verwüstete Pfade, die von schweren Maschinen
völlig zerwühlt sind. Wenn es die letzten Tage nicht so trocken gewesen wäre,
hätten wir hier das reinste Schlammbad. Glücklicherweise ist dieser Abschnitt
nur kurz. Um 11.25 Uhr erreichen wir die Hütte und die Bänke an der „Lauseiche"
und legen eine Pause ein. Bis jetzt haben wir 12
km geschafft.
Um 11.50 Uhr geht
es weiter hinunter zur „Geyersmühle" und anschließend, meist in voller Sonne,
steil hinauf nach Vielbrunn, das wir um 13.00 Uhr erreichen. Direkt am Weg liegt
ein Gasthaus mit Kegelbahn , was uns sehr willkommen ist. Kalte Getränke sind
jetzt angenehm.
 Wir
genießen die Mittagspause und brechen erst um 13.50 Uhr wieder auf und steigen -
gemäßigt - weiter an, um dann lange und steiler abzusteigen. Vor „Weitengesäß"
(so heißt der Ort wirklich) erneut aufwärts in den Ort, abwärts, aufwärts und so
fort. Links von uns ist der Himmel ziemlich bedeckt. Es grummelt öfter und fängt
dann an zu tröpfeln. Manche hängen sich vorsichtshalber ihre Regensachen um. Der
Weg führt nun ernsthaft abwärts nach Michelstadt. Wir
genießen die Mittagspause und brechen erst um 13.50 Uhr wieder auf und steigen -
gemäßigt - weiter an, um dann lange und steiler abzusteigen. Vor „Weitengesäß"
(so heißt der Ort wirklich) erneut aufwärts in den Ort, abwärts, aufwärts und so
fort. Links von uns ist der Himmel ziemlich bedeckt. Es grummelt öfter und fängt
dann an zu tröpfeln. Manche hängen sich vorsichtshalber ihre Regensachen um. Der
Weg führt nun ernsthaft abwärts nach Michelstadt.
Gegen 16.00 Uhr laufen wir ein. Am
berühmten Rathaus ist ziemlicher Trubel. Direkt gegenüber ist das Hotel „Drei
Hasen", aber das sieht der Mannschaft zu vornehm und teuer aus. Also pilgere ich
zur nahen Tourist-Info, um mir dort etwas anbieten zu lassen. Man sagt mir, zur
Zeit wäre der Bienenmarkt und heute auch noch das Radrennen rund ums Rathaus, da
wäre vieles ausgebucht. Nach einigem Herumtelefonieren stellt sich heraus, dass
nur „Drei Hasen" noch Platz hat. Das erweist sich als recht ordentlich und auch
preislich ist es akzeptabel. Laut Erwins Zähler haben wir heute 26,9 km
zurückgelegt.
Um 18.00 Uhr starten wir den gewohnten Stadtbummel. Am
Stadtrand gibt es einen überraschend großen Rummel mit sehr vielen
Verkaufsständen und einer Reihe von Fahrgeschäften. Wir schlendern dort durch
und gehen dann ins
Deutsches Haus", um etwas zu essen.
Leider sind die Gasthäuser in den ländlichen Gebieten selten auf Vegetarier
eingerichtet. So besorge ich mir bei Aldi (alles andere ist inzwischen
geschlossen) ein paar muffige Brötchen und an einem Stand getrocknete Mango- und
Papayastreifen dazu. Das tut es auch. Dann laufen wir noch ein bisschen durch
die Nebenstraßen und finden ein Lokal mit „Rothaus Bier“. Das dürfen wir uns
natürlich nicht entgehen lassen. Gegen 21.30 Uhr gehen wir dann zurück ins
Hotel.
6. Wandertag
Um 7.30 Uhr geht‘s zum Frühstück. Das
Buffet ist ausgezeichnet und sogar der Schwarztee ist ausnahmsweise wirklich
gut. Um 8.30 Uhr ist Abmarsch. Das Wetter ist wieder sonnig. Tagesziel ist heute
Reichelsheim/Neunkirchen.
Einige müssen
unbedingt noch beim Bäcker oder sonstwo Einkäufe tätigen, so dass es fast 9.00
Uhr ist, bis wir wirklich unterwegs sind. Mich nervt diese Trödelei etwas.
Natürlich geht es aufwärts. 10 Minuten später sind wir in Steinbach bei der
Einhardbasilika (so gut wie unverändert seit 827 AD). Die ist allerdings
eingerüstet und sowieso erst ab 10.00 Uhr zu besichtigen, also weiter.
Zwischen Obstbäumen und Wiesen führt der Weg
aussichtsreich aufwärts und schließlich durch ein kurzes Waldstück. Eine ganze
Weile laufen wir nun auf der Höhe entlang, meist in der Sonne, vorbei an einer
ESOC-Satelliten-Empfangsstation, an der blitzgeschädigten Russeneiche und an
Rehbach, hinunter nach Spreng. Der Weg entwickelt sich jetzt zu einer Art
Achterbahn. Immerhin sind die Auf- und Abstiege, wenn auch steil, so doch meist
kurz. Schließlich steigen wir hinunter nach Kirch-Beerfurth und folgen der
Straße nach Pfaffen-Beerfurth, wo wir um 12.00 Uhr eintreffen. Direkt am Weg
liegt praktischerweise der „Goldene Pflug“. Eine „Tankpause" ist jetzt geboten.
Ich überprüfe die möglichen Übernachtungsmöglichkeiten heute und befrage auch
die Wirtin deswegen.
 Um
13.00 Uhr weiter, aufwärts, was sonst? Etwa eine Stunde später trotten wir durch
Reichelsheim. An der Tourist Info erhalten wir eine Karte der Umgebung und ein
Gastgeberverzeichnis, das aber nicht mehr bietet als das, was ich schon im
Internet gefunden habe. Nach kurzer Unterhaltung gehen wir weiter. Ich
entscheide mich für das Landhotel „Höhenhaus Odenwald" in Neunkirchen als
Quartier. Um
13.00 Uhr weiter, aufwärts, was sonst? Etwa eine Stunde später trotten wir durch
Reichelsheim. An der Tourist Info erhalten wir eine Karte der Umgebung und ein
Gastgeberverzeichnis, das aber nicht mehr bietet als das, was ich schon im
Internet gefunden habe. Nach kurzer Unterhaltung gehen wir weiter. Ich
entscheide mich für das Landhotel „Höhenhaus Odenwald" in Neunkirchen als
Quartier.
Gnadenlos aufwärts. Die Höhe ist fast geschafft, da
beginnt es zu regnen. Das hat schon eine ganze Weile gedroht. Wir stellen uns im
Wald unter und hängen die Ponchos um. Nach einer Weile wird es mir zu dumm und
ich laufe weiter. Am Waldrand muss ich warten, da es richtig gießt. Vor mir sind
einpaar Häuser. Ist das schon das Gasthaus „Zur Freiheit"? Als es nachlässt,
gehen wir hin. Kein Gasthaus, ein Bauerhof. Der Weg macht eine große Schleife,
aber der Regen hört auf, Gott sei dank. Bedauerlicherweise läuft man nun ein
ganzes Stück auf Teer. Dann geht
es hinunter nach Laudenau und dem Gasthaus „Zur Freiheit". Vorbei und - richtig
- aufwärts, steil. Nach Neunkirchen sind es noch 3 km. Am Wasserhäuschen vorbei
durch Wald. Ich quäle mich etwas erreiche die Straße nach Neunkirchen und
verlasse die Markierung, um der Straße hinunter in den Ort zu folgen. Das
Landhotel ist am Ortseingang.
Um 16.20 Uhr bin
ich da. Davor steht ein Bus. Oh je! Entpuppt sich als Rentnerausflug, der hier
Halt gemacht hat. Wir können unterkommen, aber nur unten in der ehemaligen
„Linde", die dazu gehört. Jetzt heißt es warten. Ich habe von meinen Leuten
nichts mehr gesehen. Um 17.30 Uhr treffen sie endlich ein. Sie haben noch in der
„Freiheit" pausiert. Zum Quartier. Erwins Zähler zeigt 26,4 km an.
Das Abendessen
nehmen wir um 19.00 Uhr im Landhotel ein. Anschließend machen sie zu. Wir
genehmigen uns im Grünen Baum, gegenüber von unserem Quartier, noch ein Glas
Wein bzw. „Äppelwoi". Inzwischen schüttet es wie aus Kübeln, so dass wir im
Spurt zum Quartier über die Straße müssen.
 7.
Wandertaq 7.
Wandertaq
Ich habe diesmal
nicht besonders gut geschlafen. 20 vor 8.00 Uhr gehe ich zum Frühstück, 8.30 Uhr
ist Abmarsch. Das Wetter ist trübe und bedeckt. Tagesziel ist heute
Bensheim/Auerbach. Wir müssen zunächst, zurück zur Markierung. Also steigen wir
auf die Neunkircher Höhe und schon haben wir sie wieder. Vorbei an der
Radarschüssel zum Kaiserturm, dann abwärts nach Gadernheim. Durch den Ort und
auf der Straße hinauf geht es nach und durch Raidelbach. Dort hat die Schule
gerade Pause und die Schüler toben draußen herum.
Wir Verlassen die Straße und steigen ab nach Reichenbach,
wobei wir zwei mal Felskanten passieren, die als Kletterfelsen senkrecht in der
Landschaft stehen. In Reichenbach gibt es keine
Einkehrmöglichkeit. So nutzen wir um 11.00 Uhr das winzige Stehcafe einer
kleinen Bäckerei zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Mein Tee schmeckt
genauso hässlich wie der beim Frühstück heute morgen. Die Mannschaft will nicht
zum Felsenmeer, daher steigen wir um 11.20 Uhr steil hinauf auf den Teufelsberg.
Vorbei am Wormser Naturfreundehaus leitet man uns auf schmalen Pfad durch
Gestrüpp und Büsche erst zum Ehrenmal des Odenwaldklubs für seine Gefallenen und
dann wieder zurück auf den richtigen Weg. Das Wetter hat sich inzwischen
gemacht. Es ist jetzt sonnig und heiß.
Über die Ludwigshöhe geht es langsam hinunter zum
„Fürstenlager" bei Auerbach, wo wir 12.10 Uhr im Hotel „Herrenhaus" einkehren.
Das Haus wirkt etwas verwohnt aber man scheint sich dennoch für etwas Besseres
zu halten, wenn man nach den Preisen geht. Für einen Liter Mineralwasser 5,20
Euro zu verlangen erfordert schon Selbstbewusstsein. Obwohl der Tag noch jung
ist, beschließen wir, es für heute gut sein zu lassen und nicht weiter zu
laufen. Wir machen uns also auf die Suche nach dem Hotel „Waldruhe" und
entdecken zu unserer Überraschung, dass es ein kirchliches Altenheim ist, was
natürlich eine bestimmte Art von Kommentaren
herausfordert. Die haben in einem zweiten Gebäude aber tatsächlich auch einen
Hotelbetrieb und Platz für uns. Es ist erst 14.30 Uhr. So früh haben wir selten
aufgehört. Haben gerade einmal 17,4 km hinter uns.
Um 16.00 Uhr
brechen wir zum üblichen Bummel durch den Ort auf. Später in den „Blauer Aff'.
Das soll das beste Lokal hier sein. Zurück im Quartier greife ich mir die
Gitarre die herumsteht, und wir singen ein paar Lieder. Gegen 22.30 Uhr geht‘s
ab ins Bett.
8. Wandertag
Um 7.30 Uhr ist
Frühstück. Heute Nacht hat es kräftig geregnet aber im Augenblick ist es
trocken. Der Hausherr gesellt sich zu uns und versucht, unser Bildungsniveau zu
erhöhen. Wir wollen eigentlich nur in Ruhe frühstücken. Gegen 8.20 Uhr brechen
wir auf. Heutiges Tagesziel ist Weinheim.
 Runter
in den Ort und neben der Straße entlang Richtung Bensheim. An einer stark
befahrenen Straße entlang zu laufen ist nicht das, was wir uns unter einer
angenehmen Wanderung vorstellen. Also biegen wir ab, hangaufwärts, und nehmen
eine Straße, die parallel zur B3 verläuft, uns aber in Bensheim wieder hinunter
führt. Durch die Altstadt, dann erneut hangaufwärts, wo wir auf den „Blütenweg"
stoßen, der uns ansteigend in großem Bogen Richtung Heppenheim führt. Unterwegs
gesellt sich dann noch der „Burgenweg" dazu. Gerade als wir die Altstadt von
Heppenheim erreichen, beginnt es
kräftig zu regnen
(11.20 Uhr). Wir flüchten in ein Café zu Kaffee und Kuchen. Dem Flohmarkt in der
Fußgängerzone nebenan schmeckt der Regen auch nicht. Runter
in den Ort und neben der Straße entlang Richtung Bensheim. An einer stark
befahrenen Straße entlang zu laufen ist nicht das, was wir uns unter einer
angenehmen Wanderung vorstellen. Also biegen wir ab, hangaufwärts, und nehmen
eine Straße, die parallel zur B3 verläuft, uns aber in Bensheim wieder hinunter
führt. Durch die Altstadt, dann erneut hangaufwärts, wo wir auf den „Blütenweg"
stoßen, der uns ansteigend in großem Bogen Richtung Heppenheim führt. Unterwegs
gesellt sich dann noch der „Burgenweg" dazu. Gerade als wir die Altstadt von
Heppenheim erreichen, beginnt es
kräftig zu regnen
(11.20 Uhr). Wir flüchten in ein Café zu Kaffee und Kuchen. Dem Flohmarkt in der
Fußgängerzone nebenan schmeckt der Regen auch nicht.
 Als
wir schließlich weitermarschieren tröpfelt es noch ein bisschen, aber nur kurze
Zeit. Am Friedhof vorbei geht es aus dem Ort, dann aufwärts und einen Pfad über
Weinbergen oder durch Wald entlang. Wir folgen nun dem blauen
B des
Burgenwegs. Erfreulicherweise sind die Wege nicht zu nass. Die nachfolgenden
Orte Laudenbach, Hemsbach und Sulzbach werden nicht mehr durchquert, sondern nur
am Rand berührt. Zwischendurch setzen immer wieder kurze Schauer ein. Je nach
Möglichkeit stellen wir uns unter oder hängen das Regenzeug um. Um 15.00 Uhr
laufen wir in Weinheim ein und durch die Altstadt zum Marktplatz, wo wir bei
Sonnenschein am Café „Florian" eine Pause machen. Als
wir schließlich weitermarschieren tröpfelt es noch ein bisschen, aber nur kurze
Zeit. Am Friedhof vorbei geht es aus dem Ort, dann aufwärts und einen Pfad über
Weinbergen oder durch Wald entlang. Wir folgen nun dem blauen
B des
Burgenwegs. Erfreulicherweise sind die Wege nicht zu nass. Die nachfolgenden
Orte Laudenbach, Hemsbach und Sulzbach werden nicht mehr durchquert, sondern nur
am Rand berührt. Zwischendurch setzen immer wieder kurze Schauer ein. Je nach
Möglichkeit stellen wir uns unter oder hängen das Regenzeug um. Um 15.00 Uhr
laufen wir in Weinheim ein und durch die Altstadt zum Marktplatz, wo wir bei
Sonnenschein am Café „Florian" eine Pause machen.
 Später,
nach einer kurzen Visite des Schlossparks geht es weiter nach Lützelsachsen, wo
wir im „Schmittberger Hof“ unterkommen. Gegen 17.00 Uhr treffen wir ein.
Zurückgelegte Strecke: 27,8 km. Um 18.30 Uhr nehmen wir im Haus ein Abendessen
ein. Anschließend machen wir noch einen kleinen Spaziergang durch den Ort. Um
22.00 Uhr geht‘s aufs Zimmer. Später,
nach einer kurzen Visite des Schlossparks geht es weiter nach Lützelsachsen, wo
wir im „Schmittberger Hof“ unterkommen. Gegen 17.00 Uhr treffen wir ein.
Zurückgelegte Strecke: 27,8 km. Um 18.30 Uhr nehmen wir im Haus ein Abendessen
ein. Anschließend machen wir noch einen kleinen Spaziergang durch den Ort. Um
22.00 Uhr geht‘s aufs Zimmer.
9. Wandertag
Heute ist der
letzte Wandertag, das Ziel: Heidelberg. Es ist bewölkt aber trocken. Vor dem
Abmarsch um 8.30 Uhr befragt uns der Wirt über unsere Absichten. Wir erklären
ihm, dass wir auf dem Burgenweg nach Schriesheim und dann weiter nach Heidelberg
wollen. Er rät, nicht in Lützelsachsen aufzusteigen, da wir nur im nächsten Ort
wieder runter müssten. Also laufen wir auf einer Ortsstraße nach Großsachsen und
dort auf der Straße in den Odenwald hinein, Richtung Oberflockenbach. An einem
Parkplatz wechseln wir dann auf den Randweg und folgen ihm Richtung Kanzelberg.
Der Weg läuft
natürlich die Täler aus. Wir passieren Hirschberg/Leuters-hausen und haben dann
um 9.25 Uhr den Burgenweg endlich erreicht. In der Folge steigen wir zur Ruine
Hirschberg, zur Hohen Waid und dem Schanzenköpfle. Ab hier leitet man uns in
vielen Windungen hinunter nach Schriesheim. Wir erreichen die Straße oberhalb
von Schriesheim und folgen ihr in Richtung Ortsmitte, steigen aber bei der
ersten Gelegenheit hinauf zur Strahlenburg, wo wir um 11.50 Uhr auf der
Burgterrasse die erste Rast einlegen und Flüssigkeit nachfüllen. Trotz Sonne ist
es recht kühl, vor allem, da wir völlig verschwitzt sind.
Um 12.30 Uhr brechen wir erneut auf, steil aufwärts
Richtung „Weißer Stein“. Wir verlassen ausnahmsweise den markierten Weg und
folgen dem schmalen Pfad entlang der Kante des Steinbruchs. Später stoßen wir
natürlich wieder auf die Markierung und folgen ihr zum Gipfel des Weißen Steins
(548 m). Der Weg zieht sich ziemlich und führt auch über Gelände, in dem
Fällaktionen dem Weg nicht gut getan haben. Um 14.20 Uhr sind wir oben. Auf der
Terrasse des Gasthauses machen wir eine weitere Tankpause. Von hier aus ist es
zwar schon noch ein Stück zu laufen aber auf breiten Wegen und eher abwärts.
 Ab
15.00 Uhr folgen wir der „Hohe Straße" und sind 15.50 Uhr am „Zollstock", wo wir
den ersten Blick auf Heidelberg haben. Es folgt ein kurzer Aufstieg auf den
Gipfel des Heiligenbergs zur „Thingstätte", einem Amphitheater, das in der Zeit
des Nationalsozialismus für Veranstaltungen der Partei gebaut wurde und zur
Ruine des Michaelsklosters, das nach der Reformation verlassen wurde und dann
verfiel. Ein kurzer Abstieg bringt uns zu den Resten des Stefansklosters und dem
Aussichtsturm mit Blick auf die Stadt und den Königstuhl. Heute werden wir nicht
in
einem
Hotel übernachten, sondern bei meinem Bruder im Stadtteil Neuenheim. Wir steigen
weiter ab, über den Bismarckturm zum Philosophenweg und folgen ihm abwärts nach
Neuenheim. Rainer verabschiedet sich. Er will zu seiner Mutter im nahen
Sandhausen. Wir Anderen sind um 17.30 Uhr bei meinem Bruder und seiner Frau, die
wir natürlich telefonisch vorgewarnt haben. Heutige Wanderstrecke: 29,5 km. Nach
einem Essen im nahen Gasthaus verbringen wir den Abend im Gespräch. Ab
15.00 Uhr folgen wir der „Hohe Straße" und sind 15.50 Uhr am „Zollstock", wo wir
den ersten Blick auf Heidelberg haben. Es folgt ein kurzer Aufstieg auf den
Gipfel des Heiligenbergs zur „Thingstätte", einem Amphitheater, das in der Zeit
des Nationalsozialismus für Veranstaltungen der Partei gebaut wurde und zur
Ruine des Michaelsklosters, das nach der Reformation verlassen wurde und dann
verfiel. Ein kurzer Abstieg bringt uns zu den Resten des Stefansklosters und dem
Aussichtsturm mit Blick auf die Stadt und den Königstuhl. Heute werden wir nicht
in
einem
Hotel übernachten, sondern bei meinem Bruder im Stadtteil Neuenheim. Wir steigen
weiter ab, über den Bismarckturm zum Philosophenweg und folgen ihm abwärts nach
Neuenheim. Rainer verabschiedet sich. Er will zu seiner Mutter im nahen
Sandhausen. Wir Anderen sind um 17.30 Uhr bei meinem Bruder und seiner Frau, die
wir natürlich telefonisch vorgewarnt haben. Heutige Wanderstrecke: 29,5 km. Nach
einem Essen im nahen Gasthaus verbringen wir den Abend im Gespräch.
Fotos: Walter Brückner
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
28 - April 2009
Auf dem Altmühltal-Panoramaweg
Wanderbericht einer Fernwanderung vom 19.09.-27.09.2008
Von Harald Vielhaber
1.
Motivation
Angelockt durch vollmundige
Anpreisungen im Internet und in diversen Marketingbroschüren haben wir – das
sind Beatrice aus Zürich und Harald aus dem rheinischen Neuss – uns entschieden,
'mal
einen Fernwanderweg in Deutschland auszuprobieren (sonst sind wir eher in
Frankreich und der Schweiz unterwegs). Beatrice war zunächst skeptisch („Bayern,
cha ma do au go wandere?“), doch Superlative wie zum Beispiel „Deutschlands
beliebtester Wanderweg“ (Zitat aus „Wander-bares Deutschland“) haben sie
schließlich umgestimmt, es zusammen mit mir in Bayern zu wagen. Fragt man sich
nur, woher die das wissen bei „Wanderbares Deutschland“.
Beschrieben ist der Altmühltal-Panoramaweg als 10-tägige Tour von ca. 200 km
Länge, beginnend an der Altmühl in Gunzenhausen (Franken) und endend an der
Donau in Kelheim (Oberbayern). Im September 2008 konnte es dann losgehen, wegen
der Vorschusslorbeeren im Internet waren unsere Erwartungen an den Weg sehr
hoch.
2.
Reisevorbereitung
Geographisch gesprochen fließt die
Altmühl im Raum südlich von Nürnberg und nördlich von Ingolstadt nach Osten bis
sie bei Kelheim in die Donau mündet. Die Anreise mit der Bahn zum Startpunkt
Gunzenhausen (IC-Bahnhof) ist problemlos, die Abreise empfiehlt sich von Saale
an der Donau, etwa 5 km vom Ziel Kelheim entfernt (Kelheim selbst hat leider
keine Bahnanbindung mehr). Es gibt (mindestens) zwei Wanderführer zu dem Weg,
über amazon habe ich beide bestellt. Nach kurzer Prüfung habe ich einen Führer
prompt zurückgehen lassen und die Tour mit dem hikeline-Führer vorgeplant und
durchgeführt (mehr zu den Führern siehe die
Rezension am Ende des Artikels). Dann haben wir noch das „Gastgeberverzeichnis
2008“ eingesteckt, die ersten beiden Wegequartiere vorsichtshalber reserviert,
und schon konnte es losgehen.
3.
Wegbeschreibung
Für eine Übersicht über die einzelnen Etappen verweise ich auf die beiligende
„objektive“ Etappen-Tabelle. An dieser Stelle erfahrt ihr meine Eindrücke von
dieser Tour, diese naturgemäß sehr subjektiv.
Freitag, 19.09.08, Startpunkt Gunzenhausen -> Heidenheim.
Um 12:30 Uhr steige ich aus dem Zug und treffe dort auf Beatrice die zehn
Minuten vor mir aus Zürich schon eingetroffen war. Wir beschließen, uns zunächst
zu stärken. Unsere Wahl fällt auf ein Gasthaus mit angeschlossener Metzgerei,
dort mache ich meine erste Bekanntschaft mit der Altmühl (noch bevor ich sie
gesehen habe), und zwar in Form einer halben Altmühl-Flugente in Begleitung
zweier Riesenknödel. Nach Vernichtung derselben geht es trotzdem weiter, bei
schönstem Sonnenschein.
Wir durchqueren Gunzenhausen auf
der Suche nach dem Wanderweg. Am südlichen Ortsende finden wir ihn zusammen mit
der Altmühl, die der Weg hier auf einer Brücke quert. Erst am nächsten Abend
werden wir die Altmühl wiedersehen, bis dorthin geht der Weg zunächst recht
unspektakulär zwischen Feldern und Wiesen nach Spielberg (mit altem Schlößchen).
Dort verlassen wir den Weg und gehen eine Variante (Schlaufenweg Nr 2) über den
Jakobsweg bis nach Heidenheim, da wir in Spielberg kein Quartier bekommen haben
(einziger Gasthof hatte Betriebsferien). Wir übernachten dort sehr schön auf
einem Bio-Bauernhof in H.-Mariabronn, wo wir erst bei
Einbruch der Dämmerung eintreffen. Jetzt ist die Flugente definitiv verbraucht,
wir verspeisen unsere Einkäufe und fallen todmüde in die frisch gemachten
Betten.
 Samstag,
20.09.08, Heidenheim-Mariabronn -> Treuchtlingen-Dietfurt Samstag,
20.09.08, Heidenheim-Mariabronn -> Treuchtlingen-Dietfurt
Als Morgenüberraschung bekommen
wir ein bayrisches Frühstück: Konfitüre, diversen Käse, Wurst, Schinken, frische
Brötchen und Brot, das alles in üppigen Mengen. Diese großzügige bayrische
Gastfreundschaft wird uns den ganzen Weg begleiten. Über den „Quellenweg“,
welcher am Haus vorbeiführt, gelangen wir oberhalb von Wolfsbronn wieder auf den
Altmühltal-Panoramaweg. Wir gehen ein kurzes Stück zurück und steigen ab bis zur
„Steinernen Rinne“, einem Naturwunder welches man hier antrifft: kalkhaltiges
Wasser schießt konstant aus einer Quelle, nicht zu schnell und nicht zu langsam,
und die Kalkablagerungen formen über Jahrzehnte und Jahrhunderte
eine Art Kanal, das Wasser baut sich auf diese diese Art selbst ein in die Höhe
wachsendes Bett.
Leider bleibt die Sonne heute
ganztägig unter einer dicken und tiefen Wolkendecke verborgen. Kälter geworden
ist es auch, heute bleiben die kurzen Hosen daher im Rucksack - so wie alle
weiteren Tage der Tour
L. Es geht jetzt überwiegend durch Wald – von
Panorama keine Spur – dem „Hahnenkamm“ folgend. Als willkommene Abwechslung am
Wegesrand treffen wir auf ein keltisches Dorf, natürlich nachgebaut, aber die
Stelle ist historisch. Wir übernachten in Treuchtlingen-Dietfurt in der Pension
Friedrich (sehr zu empfehlen).
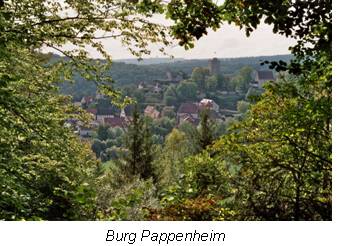 Sonntag, 21.09.08, Treuchtlingen-Dietfurt -> Mörnsheim Sonntag, 21.09.08, Treuchtlingen-Dietfurt -> Mörnsheim
Es ist weiterhin bewölkt und noch
kälter, und außerdem schmerzt mein linker Fuß. Zum Glück hat die Zimmerwirtin
Voltaren-Salbe dabei, genau das brauche ich jetzt, und sie schenkt mir die
restliche Tube zum Mitnehmen. Es geht sofort bergan, und tatsächlich bietet sich
uns sehr bald das erste Mal ein Panoramablick auf die Altmühl. Wir kommen bald
nach Pappenheim, für einige Minuten zeigt sich sogar die Sonne und die Hoffnung
beginnt wieder zu keimen. In Pappenheim ist gerade Kirchweih, der ganze Ort ist
aus dem Häuschen: überall Stände die etwas anbieten, eine Blaskapelle
spielt, Bier und Würstchen warten auf Konsumenten. Pappenheim ist ein schönes
mittelalterliches Städtchen mit Schloß und Burg derer zu Pappenheim,
„Erbfeldmarschall“, wie eine Tafel uns informiert.
 Für eine Mittagsrast ist es noch
zu früh, also geht es bald weiter. Der Weg überquert die Altmühl und geht weiter
über die Höhe, Panorama-Aussichten sind aber eher selten. Wir streifen als
nächstes Solnhofen, den Fundort des weltberühmten „Arche-opteryx“, dem
Flugsaurier oder Urvogel. Der Wanderweg führt alsdann tatsächlich mitten durch
das Betriebsgelände des „Maxberg Steinbruchs“, sicher ein Highlight der Tour.
Überall stapeln sich hier die Solnhofener Platten, sauber geschnitten und
gestapelt als Bodenbelag, nicht selten mit fossilen Spuren darauf (einen Archeopteryx
habe ich aber nicht erspäht, eher so was wie Farne und kleine Fische). Einige
Plattenstücke mit interessanten Fossilien liegen für wenige Euro zum Mitnehmen
aus, aber wegen des Gewichts sehe ich doch davon ab. Auf dem Gelände ist auch
ein Museum, das war aber am Sonntag geschlossen, und so steigen wir ab nach
Mörnsheim wo wir übernachten (Pension Armann, auch diese sehr zu empfehlen). Für eine Mittagsrast ist es noch
zu früh, also geht es bald weiter. Der Weg überquert die Altmühl und geht weiter
über die Höhe, Panorama-Aussichten sind aber eher selten. Wir streifen als
nächstes Solnhofen, den Fundort des weltberühmten „Arche-opteryx“, dem
Flugsaurier oder Urvogel. Der Wanderweg führt alsdann tatsächlich mitten durch
das Betriebsgelände des „Maxberg Steinbruchs“, sicher ein Highlight der Tour.
Überall stapeln sich hier die Solnhofener Platten, sauber geschnitten und
gestapelt als Bodenbelag, nicht selten mit fossilen Spuren darauf (einen Archeopteryx
habe ich aber nicht erspäht, eher so was wie Farne und kleine Fische). Einige
Plattenstücke mit interessanten Fossilien liegen für wenige Euro zum Mitnehmen
aus, aber wegen des Gewichts sehe ich doch davon ab. Auf dem Gelände ist auch
ein Museum, das war aber am Sonntag geschlossen, und so steigen wir ab nach
Mörnsheim wo wir übernachten (Pension Armann, auch diese sehr zu empfehlen).
 Montag, 22.09.08, Mörnsheim -> Eichstätt Montag, 22.09.08, Mörnsheim -> Eichstätt
Nach dem besten Frühstück der
ganzen Tour brechen wir bei wolkenverhangenem Himmel und Nieselregen auf. Wir
kürzen daher ab auf dem Rad- und Wanderweg durch das Gailach-Tal und treffen
nach 20 Minuten hinter Altendorf auf die Altmühl und unseren Weg. Über den
Altmühltal-Panoramaweg hätte uns das 5 km und 150 Höhenmeter zusätzlich
gekostet. Es regnet fester. Wir laufen tapfer weiter bis nach Dollnstein, dort
nehmen wir dann den Zug bis ins 16 km entfernte Eichstätt. Wir kommen gegen
Mittag dort an, und Eichstätt lohnt ohne weiteres eine halbtägige (oder auch
längere) Pause. Weil
Eichstätt im 30-jährigen Krieg vollständig zerstört und danach wieder aufgebaut
wurde, präsentiert es sich heute als eine der schönsten Barockstädte überhaupt,
mit fürstlichem Palais, Burg, Klöstern und schönen Plätzen. Exzellentes
Abendessen gibt es übrigens im Gasthof „Krone“ (besser vorher reservieren, sonst
wird es knapp).
Dienstag, 23.09.08, Eichstätt -> Arnsberg
Das Wetter bleibt kalt und die
Sonne zeigt sich wieder nicht, aber wenigstens bleibt es (meistens) trocken. Wir
ziehen weiter über die Höhen entlang der Altmühl bis nach Arnsberg. Der Weg geht
dabei konsequent an allen Dörfen vorbei (Landershofen, Rieshofen, Pfalzpaint und
Gungolding), und das meine ich wörtlich, sogar wenn es in diesen Orten eine
Kneipe gibt! Was denken sich die Wegemacher eigentlich dabei? Haben Wanderer
keine weltlichen Bedürfnisse mehr? Im heutigen Etappenziel Arnsberg sind alle
Privatzimmer und Pensionen belegt, wir übernachten das erste Mal für mehr als
30,- EUR, und zwar im Gasthof Rabe.
Hier nehmen wir das beste Abendessen unserer Tour ein, eine „Schäferplatte“ mit
diversen Zubereitungen des Altmühltal-Lamms. Man trifft in der Tat hier Schäfer
mit ihrer Herde an, das Altmühltal-Lamm dient hier der Landschaftspflege und als
gastronomisches Markenzeichen. Und Wandern macht bekanntlich Appetit.
 Mittwoch, 24.09.08, Arnsberg -> Unteremmendorf Mittwoch, 24.09.08, Arnsberg -> Unteremmendorf
Wir ziehen weiter über die Höhe
entlang der Altmühl bis nach Kipfenberg, wo wir uns stärken. Hierzu müssen wir
wieder den Altmühltal-Panoramaweg verlassen, denn auch hier führt der Weg glatt
an diesem Städtchen vorbei (wie übrigens auch schon an Eichstätt). Weiter geht
es durch den Wald bis nach Kinding. Es ist früher Nachmittag, wir halten kurz an
und telefonieren die möglichen Nachtquartiere in 5 bis 10 km Entfernung vor uns
auf dem Weg ab. Privatzimmer hat es wieder keine, so übernachten wir in
Unteremmendorf
in einem kleinen Landgasthof.
Donnerstag, 25.09.08, Unteremmendorf -> Deising
Bei Wolken und Kälte zieht es uns
rasch weiter, und schon sind wir in Beilngries. Hier geht der Weg tatsächlich
durch den Ort, ließ sich wohl nicht vermeiden. Beilngries ist sehr schön gelegen
zwischen Main-Donau-Kanal und Altmühl, hier gibt es hier einiges zu sehen. Doch
Beatrice zieht es voran, sie will jetzt schnell ans Ziel, sie hat Wolken und
Kälte satt. Wir lassen – so wie der Weg es auch tut – das Städtchen Dietfurt
links liegen und gehen viele Kilometer durch dichten Wald. Als es zu dämmern
beginnt verlassen wir den Weg, um in Deising zu übernachten (Gasthof
Himmelreich).
 Freitag, 26.09.08 Deising -> Altessing Freitag, 26.09.08 Deising -> Altessing
Am nächsten Morgen geht es steil
bergan auf den Rosskopf mit wirklich schöner Aussicht, dann weiter nach Schloss
Eggersberg. Hier wärmen wir uns auf bei einem Kaffee. Gegen Mittag passiert mir
dann jenes folgenreiche Malheur, woraufhin auf immer ein Teil von mir bei der
Altmühl verbleiben sollte: bei Jachenhausen betrete ich eine Drachenfliegerrampe
mit der Absicht ein „Panorama-Foto“ zu schießen, doch eine heftige Windboe reißt
mir meine Baskenmütze vom Kopf und weht sie hinab ins Altmühltal. Den Rest der
Tour (und länger) trauere ich um diesen, meinen treuen und ständigen Begleiter,
nun
barhäuptig unterwegs und dadurch ohne Schutz vor Wind, Regen, Sonne oder
Steinschlag. Am frühen Nachmittag erreichen wir dann Riedenburg (ja, diesmal
führt der Weg
durch den Ort, denn hier muss er die Altmühl queren und benötigt
dafür eine Brücke). Hinter der Brücke treffen wir auf die Schiffsanlegestelle
und ein (fast) abfahrbereites Schiff, sodass wir uns spontan entscheiden ein
Stück Weg
'mal
aus der Perspektive des träge fließenden Altmühlkanals wahrzunehmen. Bei einem
kühlen Bier sehen wir die bewaldeten Höhen vorbeiziehen, haben einen
spektakulären Blick auf die Burg Prunn, unterqueren die längste Holzbrücke
Europas (in architektonisch interessanter Wellenform). In Essing steigen wir
wieder aus und suchen unser telefonisch
 avisiertes Privatzimmer in Altessing.
Leckeres Abendessen im einzigen Gasthof von Altessing. avisiertes Privatzimmer in Altessing.
Leckeres Abendessen im einzigen Gasthof von Altessing.
 Samstag, 27.09.08, Altessing -> Kloster Weltenburg -> Kelheim Samstag, 27.09.08, Altessing -> Kloster Weltenburg -> Kelheim
An unserem letzten Wandertag
erleben wir noch ein paar Höhepunkte: wildromantische Seitenarme der (ansonsten
für den Kanal weg gebaggerten) Altmühl, Wegeführung über einen ehemaligen
keltischen Befestigungswall (den „Kelten-wall“), das berühmte Kloster Weltenburg
und ..... die Sonne! Ja, jetzt ist sie wieder da. Auch wenn es noch nicht sofort
wieder warm ist, so lädt sie doch ein zum Ver-weilen im Biergaten des Klosters
bei dunklem Klosterbier. Zum Abschluss nehmen wir für die letz-ten wenigen
Kilometer ganz gemütlich das Schiff (diesmal auf der Donau), durchschippern den
berühmten
Donaudurchbruch (hier ist die Donau 15 Meter tief !) und gelangen in Kürze nach
Kelheim.
Hätten wir ein Navigationsgerät dabei, so würde jetzt eine tiefe weibliche
Stimme zu uns sprechen:
 „Sie haben das Ziel erreicht!“. „Sie haben das Ziel erreicht!“.
4.
Fazit
Und, stimmt es nun, ist der Altmühltal-Panoramaweg (APW) wirklich der schönste
im ganzen Land? Ich meine: nein. Um diese Frage bejahen zu können, müsste ich ja
alle anderen Wege kennen. Wer hohe Erwartungen schürt muss sich aber nicht
wundern, wenn er an diesen dann gemessen wird. Der APW ist sicher ein schöner
Wanderweg, zudem mit guter Infrastruktur, und wer bayrische Gemütlichkeit und
hübsche alte Dörfer und Städtchen schätzt ist hier sicher gut aufgehoben.
Nur „Panoramaweg“ finde ich dann doch etwas hochgestapelt für gelegentliche
Aussichten auf die nur 100 m tiefer vor sich dahin mäandernde Altmühl. Da halte
ich das Etikett „Panorama“ für den Rheinsteig (früher: Rhein-Panoramaweg) eher
zutreffend: Hier trennen 300 Höhenmeter Weg und Strom, und das Panorama ist
außerdem „animiert“, weil sich ständig Schiffe und Züge auf bzw. an der
Verkehrsader Rhein entlang bewegen.
Schade finde ich auch, dass der
APW meist die Ortschaften meidet und dadurch wahre Kleinode wie Eichstätt oder
Kipfenberg dem wegetreuen Wanderer vorenthält. Schade zum einen, weil damit des
Wanderers Urleiden wie „Durst“ und „Hunger“ nicht am Wegesrand bekämpft werden
können, zum anderen weil diese Orte wirklich sehenswert sind. Vielleicht wollten
die Wegemacher sich hier die Premium-Statistik nicht durch die dadurch
erforderlichen zusätzlichen Asphaltmeter verwässern lassen. Dieser Verdacht
würde auch die manchmal unlogischen Umwege in der Wegeführung erklären (siehe
z.B. Etappe 4). „Gute Wegführung“ lässt sich nicht allein durch die sicher
objektive Messzahl „Anteil Asphaltkilometer“ ausdrücken. Denn
gut für den Weg ist es auch, wenn jeder Schritt den Wanderer seinem Ziel (oder
hilfsweise wenigstens einem Gasthof) ein Stückchen näher bringt.
Sehr gut ist die Infrastruktur entlang des Weges. Mit Bahn, Bus und Schiff
lassen sich An- und Abreise sowie Tagesetappen flexibel ausführen.
Der „offizielle Altmühltal-Panoramaweg-Führer“ beschreibt 10, der
Hikeline-Führer 11 Etappen für die Gesamtstrecke. Wir haben es in 9 geschafft,
sicher auch wegen des schlechten Wetters, welches selten zum Verweilen einlud
(war häufig zu kalt dafür, nur Bewegung oder beheizte Räume hielten uns warm).
Wer weniger Zeit hat, der sollte sich den langweiligen Anfang schenken und nicht
in Gunzenhausen beginnen, sondern stattdessen in Treuchtlingen starten, welches
ebenfalls mit der Bahn gut erreichbar ist. Ab hier ist der Weg interessanter und
die Unterkunftsbeschaffung leichter. Insgesamt ein schönes Projekt für gut eine
Wanderwoche.
5.
Referenzliteratur und Rezension der beiden Wanderführer
5.1 Gastgeberverzeichnis Naturpark Altmühltal
Das
Gastgeberverzeichnis enthält eine Fülle von Unterkünften mit ausführlicher
Beschreibung zum Komfort (Piktogramme) sowie Preise. Außerdem enthält es weitere
nützliche Informationen wie zum Beispiel das Bahn- und Busnetz,
Schiffabfahrtszeiten und -Preise, sowie eine große Übersichtskarte. Es ist
erhältlich bei der „Zentralen Tourist-Information Naturpark Altmühltal“ in 85072
Eichstätt oder im Internet unter
http://www.naturpark-altmuehltal.de/service/infomaterial/.
(Die
Redaktion: Ein weiteres, sehr umfangreiches Übernachtungsverzeichnis von
„fernwege.de“ -
http://www.fernwege.de/einkauf/wanderfuehrer/panoramaweg/index.html)
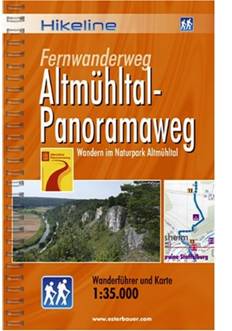 5.2 Hikeline-Führer 5.2 Hikeline-Führer
Reihe:
Hikeline „Fernwanderweg Altmühltal-Panoramaweg“, 1. Auflage 2008, Verlag
Esterbauer, ISBN 978-3850005005, 148 Seiten, kostet 12,90
€.
Der Hikeline-Führer enthält eine Fülle an Informationen und ist trotzdem
handlich durch sein Hosentaschenformat 11 cm x 16 cm und die Spiralbindung.
Kompass-Wanderkartenausschnitte im Maßstab 1:35.000 zeigen die Wegestrecke und
Ortschaften links und rechts des Weges, größere davon mit Innenstadtplan. Die
Karte zeigt sogar die Wegbeschaffenheit (z.B. Asphaltweg, Wanderweg, Steig)
sowie Gaststätten, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten.
Ein ausführliches Unterkunftsverzeichnis (9 Seiten) mit Telefonnummern und ein
Ortsverzeichnis runden das Bild ab.
Der Weg ist in 11 Etappen mit Längen zwischen 13 und 24 km unterteilt. Pro
Etappe ist ein Höhenprofil mit Auf- und Abstiegen angegeben, dieses enthält
außerdem Referenzpunkte zum nebenstehenden Kartenausschnitt. Wenn man diesen
Führer hat, benötigt man nichts weiter. Karten braucht man dann nur noch, wenn
man – so wie wir ganz am Anfang – vom Weg abweichen möchte.
Einziger Wermutstropfen: die Erstausgabe enthält noch einige Druckfehler, die
uns aber nie wirklich gestört haben.
5.3 Offizieller Altmühltal-Panoramaweg
Magenta-Verlag: „Wanderführer
Altmühltal-Panoramaweg mit Schlaufenwegen“, 3. Auflage 2008, ISBN
978-3980758550, 99 Seiten, kostet 9,90
€.
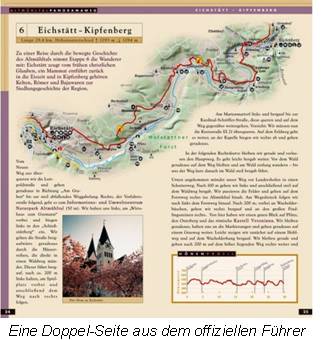 Das Buch trägt den Untertitel: „Der offizielle Wanderführer
Altmühltal-Panoramaweg. Rourenbeschreibungen, Tipps, Sehenswertes und
Reiseinformationen“, und wird anscheinend
beworben ähnlich wie der Weg selbst. Er enthält eine Beschreibung der Tour in 10
Etappen zwischen 18 und 29 km Länge. Das Format ist 20,5 cm x 10,5 cm, also
leider etwas unhandlich für Hosentaschen oder (kleinere) Rucksackfächer. Leider
enthält er keine topographischen Kartenausschnitte, stattdessen nur eine
schematische Darstellung des Weges mit viel Text und einem kleinen Höhenprofil.
Es sind nur ausgewählte (eher teurere) Unterkünfte direkt angegeben, ansonsten
wird einfach auf die Telefonnummer des nächsten Fremdenverkehrsamtes verwiesen.
Das einzige was dieser Führer dem Hikeline-Führer voraus hat, ist die
Beschreibung der sogenannten Schlaufenwege. Das sind Eintagestouren um Standorte
des Altmühltal-Panoramawegs herum. Das braucht man aber nicht unbedingt, wenn
man die Fernwanderung vorhat. Das Buch trägt den Untertitel: „Der offizielle Wanderführer
Altmühltal-Panoramaweg. Rourenbeschreibungen, Tipps, Sehenswertes und
Reiseinformationen“, und wird anscheinend
beworben ähnlich wie der Weg selbst. Er enthält eine Beschreibung der Tour in 10
Etappen zwischen 18 und 29 km Länge. Das Format ist 20,5 cm x 10,5 cm, also
leider etwas unhandlich für Hosentaschen oder (kleinere) Rucksackfächer. Leider
enthält er keine topographischen Kartenausschnitte, stattdessen nur eine
schematische Darstellung des Weges mit viel Text und einem kleinen Höhenprofil.
Es sind nur ausgewählte (eher teurere) Unterkünfte direkt angegeben, ansonsten
wird einfach auf die Telefonnummer des nächsten Fremdenverkehrsamtes verwiesen.
Das einzige was dieser Führer dem Hikeline-Führer voraus hat, ist die
Beschreibung der sogenannten Schlaufenwege. Das sind Eintagestouren um Standorte
des Altmühltal-Panoramawegs herum. Das braucht man aber nicht unbedingt, wenn
man die Fernwanderung vorhat.
Empfehlung:
Obwohl er etwas teurer ist, hat der Hikeline-Führer eindeutig das bessere
Preis-Leistungs-Verhältnis.
6. Tabellarische Etappenübersicht
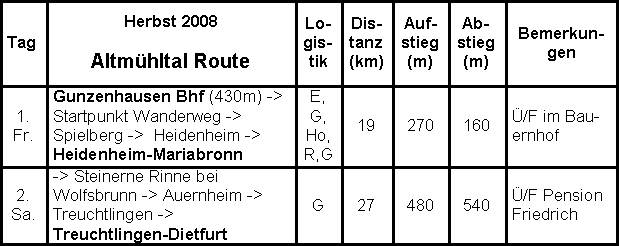
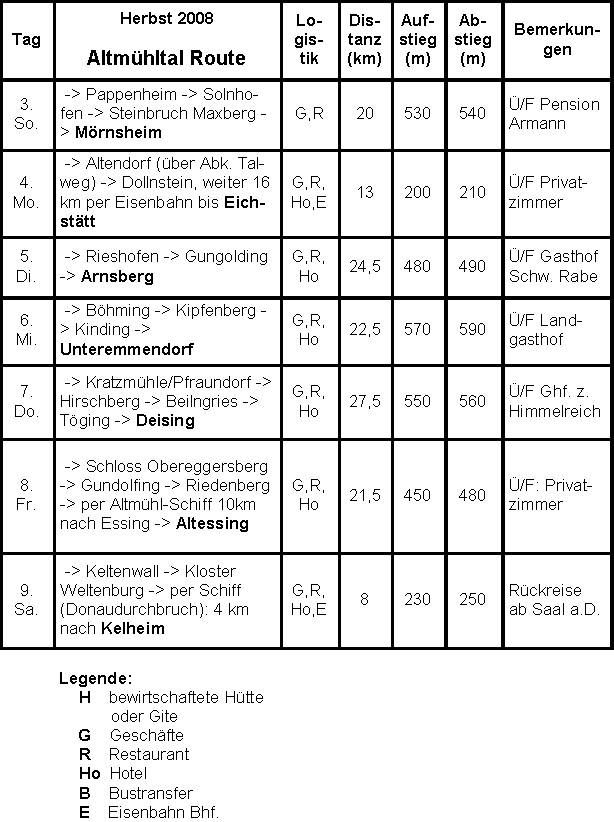
Fotos und Titelfoto: Harald Vielhaber
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
29 - August 2009
Betrachtungen eines
Goldsteigwanderers
Eine Wanderwoche auf dem
ehemaligen Burgenweg
im Oberpfälzer Wald
Von Tilman Kleinheins
 Ist ein
Bekannter von Urlaub und Erholung zurückgekehrt, überschlägt er sich in seinen
Erzählungen darüber gerne vor Begeisterung. Oft gehört: Da musst Du unbedingt
hin. Oder: Das ist eine Waaaahnsinnsgegend. Man hört aufmerksam zu, rollt
innerlich ein wenig mit den Augen und beschließt für sich, bestimmt ein ganz
anderes Urlaubs- oder Wanderziel zu wählen. Wie aber soll man Begeisterung
teilen, ohne die zahlreichen Flyer und Internet-Auftritte der
Marketing–Abteilungen einer Region zu wiederholen? Wohl am besten mit sachlicher
Berichterstattung. Aber es war schon waaaaaahnsinnig schön, da müsst Ihr
unbedingt mal hin. Auf den Burgenweg des Oberpfälzer Waldvereins. Ist ein
Bekannter von Urlaub und Erholung zurückgekehrt, überschlägt er sich in seinen
Erzählungen darüber gerne vor Begeisterung. Oft gehört: Da musst Du unbedingt
hin. Oder: Das ist eine Waaaahnsinnsgegend. Man hört aufmerksam zu, rollt
innerlich ein wenig mit den Augen und beschließt für sich, bestimmt ein ganz
anderes Urlaubs- oder Wanderziel zu wählen. Wie aber soll man Begeisterung
teilen, ohne die zahlreichen Flyer und Internet-Auftritte der
Marketing–Abteilungen einer Region zu wiederholen? Wohl am besten mit sachlicher
Berichterstattung. Aber es war schon waaaaaahnsinnig schön, da müsst Ihr
unbedingt mal hin. Auf den Burgenweg des Oberpfälzer Waldvereins.
Nicht ohne Skepsis legte ich zu Beginn der Karwoche die
ersten Schritte auf dem Burgenweg zurück, der von Marktredwitz bis Waldmünchen
den vorderen Oberpfälzer Wald auf rund 180 km Länge durchzieht. Einmal, weil ich
vor vielen Jahren beim Versuch, den E6 von hier aus nach Süden fortzusetzen, im
Schnee versackte. Zum zweiten, weil ich gespannt war, wie sich denn das
Klassifizierungs–Bohei ums Wegenetz der deutschen Wandervereine unter den
Wandersohlen konkret anfühlt. Wieviel ist von Marketing – Begriffen wie
„Ge(h)nuss–Wandern“ abzuziehen, wenn man unterwegs ist? Wie alt ist das „Neue
Wandern“, das man selbst ja schon
einige Jahre ausübt. Gelingt es, „couch potatoes“ erstmalig für Schusters Rappen
zu
begeistern? Und warum heißt der Burgenweg jetzt
Goldsteig?
 „Ja,
ja, wenn´s Wetter schön ist, ist´s überall schön“, meint Frau Träxler vom
gleichnamigen Gasthof in Thanstein scherzhaft. Stimmt natürlich, aber es ist
tatsächlich viel geschehen beim Trassieren, beim Markieren, beim Miteinbeziehen
der Gastronomen. Dass ein Fernwanderweg – als Projekt verstanden – Geld braucht,
zeigt ggf. wie hier eine neue Namensgebung. Letztlich ein Werbeauftritt der
Goldsteig–Käserei in Cham, die viele Euro gesponsort hat, um für den
Burgenweg/Goldsteig den Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbands
entsprechen zu können, damit er sich unter die deutschen
„Top Ten Trails“ einreihen
kann.
Dass das Ergebnis auf jeden Fall die Mittel heiligt, merkt der Wanderer recht
schnell: Mindestens 35 % naturbelassene Wege sind gefordert und von
Hauptwegemeister Kurt Heinold und seinen Abschnittswegewarten auf wunderbare Art
und Weise umgesetzt. „Ja,
ja, wenn´s Wetter schön ist, ist´s überall schön“, meint Frau Träxler vom
gleichnamigen Gasthof in Thanstein scherzhaft. Stimmt natürlich, aber es ist
tatsächlich viel geschehen beim Trassieren, beim Markieren, beim Miteinbeziehen
der Gastronomen. Dass ein Fernwanderweg – als Projekt verstanden – Geld braucht,
zeigt ggf. wie hier eine neue Namensgebung. Letztlich ein Werbeauftritt der
Goldsteig–Käserei in Cham, die viele Euro gesponsort hat, um für den
Burgenweg/Goldsteig den Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbands
entsprechen zu können, damit er sich unter die deutschen
„Top Ten Trails“ einreihen
kann.
Dass das Ergebnis auf jeden Fall die Mittel heiligt, merkt der Wanderer recht
schnell: Mindestens 35 % naturbelassene Wege sind gefordert und von
Hauptwegemeister Kurt Heinold und seinen Abschnittswegewarten auf wunderbare Art
und Weise umgesetzt.
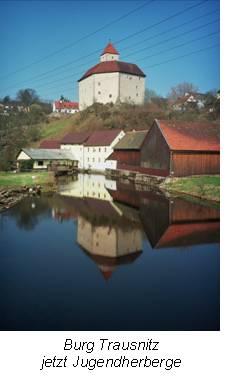 Erinnert
Euch: Kam man bisher aus dem Wald in den
nächsten Ort, war folgende Reihenfolge stets
gleich: Waldweg, Wasserhäuschen, Forststraße, wahlweise Schützenhaus oder
Fußballplatz, geteerter Planweg. Und nach weiteren 1,5 km Straße stand man
schließlich vor der Eisdiele am Marktplatz. Am Burgenweg dagegen wird der
wandernde Zeitgenosse, wo es nur geht, überrascht von plötzlichen Abzweigen vor
und im Ort. Alles wird gegeben, um quasi per Hintertürchen ins Zentrum zu
gelangen. Geführt wird man über kleinste Treppen; durch alles, was an
nennenswerten Grünanlagen vorhanden ist; stellenweise über Trampelpfade, deren
Art jeder kennt, der mal einen Schulweg hatte. Das
alles, ohne Ziel und Himmelsrichtung aus den Augen zu verlieren. Die
Wegführung des neuen „Fränkischen Gebirgsweges“ dagegen, dessen
Initiatoren die 120 km lange Luftlinie vom Ausgangs- zum Zielort auf 440
Wanderkilometer strecken, bleibt fragwürdig. Natürlich sind mir Abstecher
jederzeit willkommen, auch eine größere Schleife hat ihren Sinn, wenn es etwas
Besonders zu erwandern oder zu sehen gibt. Der Gebirgsweg ist indes eindeutig
ein Produkt zu vieler Regionen, die logischerweise alle ihr Bestes zeigen
wollen. Und dann mäandriert man so herum. Erinnert
Euch: Kam man bisher aus dem Wald in den
nächsten Ort, war folgende Reihenfolge stets
gleich: Waldweg, Wasserhäuschen, Forststraße, wahlweise Schützenhaus oder
Fußballplatz, geteerter Planweg. Und nach weiteren 1,5 km Straße stand man
schließlich vor der Eisdiele am Marktplatz. Am Burgenweg dagegen wird der
wandernde Zeitgenosse, wo es nur geht, überrascht von plötzlichen Abzweigen vor
und im Ort. Alles wird gegeben, um quasi per Hintertürchen ins Zentrum zu
gelangen. Geführt wird man über kleinste Treppen; durch alles, was an
nennenswerten Grünanlagen vorhanden ist; stellenweise über Trampelpfade, deren
Art jeder kennt, der mal einen Schulweg hatte. Das
alles, ohne Ziel und Himmelsrichtung aus den Augen zu verlieren. Die
Wegführung des neuen „Fränkischen Gebirgsweges“ dagegen, dessen
Initiatoren die 120 km lange Luftlinie vom Ausgangs- zum Zielort auf 440
Wanderkilometer strecken, bleibt fragwürdig. Natürlich sind mir Abstecher
jederzeit willkommen, auch eine größere Schleife hat ihren Sinn, wenn es etwas
Besonders zu erwandern oder zu sehen gibt. Der Gebirgsweg ist indes eindeutig
ein Produkt zu vieler Regionen, die logischerweise alle ihr Bestes zeigen
wollen. Und dann mäandriert man so herum.
Noch einmal Kurt Heinold: „Die Planung der neuen
Wegführung des Goldsteigs war die Hauptarbeit. Mit vielen Grundbesitzern war zu
reden, ob diese Wiese überquert
werden darf oder jener Graben mit einem Steg überbrückt werden kann. Die meisten
haben rasch zugestimmt, bei anderen war es nicht so einfach.
 Das
Ergebnis lässt sich jedenfalls sehen. Was für die Wegführung im oder auf Orte zu
gilt, ist auch außerhalb in Wald und Flur so abwechslungsreich umgesetzt, dass
man sich fragt, welcher Wanderer noch die herkömmlich geführten Wege geht. Weil
Erfolg aber sexy macht, ist laut Heinold, der zweite wichtige Hauptwanderweg des
Oberpfälzer Waldvereins „in der Mache“: der Nurtschweg, welcher den E6 Huckepack
trägt. Das
Ergebnis lässt sich jedenfalls sehen. Was für die Wegführung im oder auf Orte zu
gilt, ist auch außerhalb in Wald und Flur so abwechslungsreich umgesetzt, dass
man sich fragt, welcher Wanderer noch die herkömmlich geführten Wege geht. Weil
Erfolg aber sexy macht, ist laut Heinold, der zweite wichtige Hauptwanderweg des
Oberpfälzer Waldvereins „in der Mache“: der Nurtschweg, welcher den E6 Huckepack
trägt.
Man muss an dieser Stelle der Gerechtigkeit genüge
tun. Viele Wegewarte deutscher Wandervereine waren in ihrer Ehre gekränkt, als
der Herr Professor aus Marburg mit einer Studie an die Öffentlichkeit trat, die
belegte, dass die bisherige (immerhin bis zu 100 Jahren währende) ehrenamtliche
Wege- und Markierungsarbeit der Vereine nicht mehr zeitgemäß sei. Der nach neuen
Richtlinien und mit zusätzlichen Initiatoren
 daraufhin
ins Leben gerufene Rothaarsteig sollte zeigen, wo die Zukunft der deutschen
Wanderei liegt. Die weit über dem normalen Geldtopf des Sauerländischen
Gebirgsverein dafür eingeworbenen Mittel in Euro und Cent machten den
Rothaarsteig aber erst möglich. Und
da liegt m. E. der Hase im Pfeffer. Wurde früher die reine Wegearbeit der
Vereine seitens des Bundeslandes oder der politischen Regionsebene jährlich mit
5.000 bis 15.000 € bezuschusst, stellte das Land Rheinland-Pfalz 2008 allein für
den Westerwaldsteig 800.000 € zur
Verfügung. Ein Quantensprung. So wartet z.B. der Fränkische Gebirgsweg an
wichtigen Wegepunkten bzw. Etappenenden mit überdimensional großen
Orientierungstafeln auf: gefördert mit Mitteln der EU. Und der Tourismusverband
Ostbayern konnte zusammen mit dem Oberpfälzer Waldverein einen privaten
Geldgeber ins Boot holen und für die Idee des Goldsteigs erwärmen. Die Wegewarte
der Vereine zeigen sich also offen und bereit, Kooperationen einzugehen, die
letztlich allen nützen. daraufhin
ins Leben gerufene Rothaarsteig sollte zeigen, wo die Zukunft der deutschen
Wanderei liegt. Die weit über dem normalen Geldtopf des Sauerländischen
Gebirgsverein dafür eingeworbenen Mittel in Euro und Cent machten den
Rothaarsteig aber erst möglich. Und
da liegt m. E. der Hase im Pfeffer. Wurde früher die reine Wegearbeit der
Vereine seitens des Bundeslandes oder der politischen Regionsebene jährlich mit
5.000 bis 15.000 € bezuschusst, stellte das Land Rheinland-Pfalz 2008 allein für
den Westerwaldsteig 800.000 € zur
Verfügung. Ein Quantensprung. So wartet z.B. der Fränkische Gebirgsweg an
wichtigen Wegepunkten bzw. Etappenenden mit überdimensional großen
Orientierungstafeln auf: gefördert mit Mitteln der EU. Und der Tourismusverband
Ostbayern konnte zusammen mit dem Oberpfälzer Waldverein einen privaten
Geldgeber ins Boot holen und für die Idee des Goldsteigs erwärmen. Die Wegewarte
der Vereine zeigen sich also offen und bereit, Kooperationen einzugehen, die
letztlich allen nützen.
Fotos:
Tilman Kleinheins
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
30 - Dezember 2009
Auf dem „Limeswanderweg“von
Jagsthausen nach Lorch
Von Gerhard Wandel
Eigentlich ist das
ganze Jahr über Wanderzeit. Für eine Winterwanderung muss man jedoch die
Tagesetappen kürzer halten und wegen der Unberechenbarkeit des Wetters auch die
Möglichkeit einplanen, die Tour jederzeit abzubrechen. Dazu eignet sich der
Limeswanderweg in Baden-Württemberg in besonderem Maße, denn er beinhaltet keine
steilen und möglicherweise vereisten Auf- und Abstiege und er durchkreuzt
jeweils die Bahn- und Busverbindungen von Stuttgart nach Nord und Ost.
Der Obergermanische bzw. Rätische Limes als Grenzwall
des Römischen Reiches bildete in der Zeit von ca. 150 n.Chr. bis 260 n.Chr. eine
kulturelle, wirtschaftliche und zuletzt auch militärische Grenze gegen die
nördlich und östlich davon siedelnden germanischen Stämme. Er gehört als
längstes Kulturdenkmal Europas zum UNESCO Weltkulturerbe. In erster Linie diente
er dazu, die Macht des Römischen Reiches zu demonstrieren, den Handel zu
kontrollieren und Zolleinnahmen zu sichern. Als militärischer Wall hatte er
zunächst geringe Bedeutung. Im Bereich des Schwäbisch-Fränkischen Waldes ist er
in Waldgebieten als Wall mit Graben teilweise noch gut erkennbar. Der Wall
verläuft im Bereich
Walldürn bis
Welzheim schnurgerade aus, eine Meisterleistung der römischen Vermesser.
Der Limesweg ist
als Fernwanderweg beim Schwäbischen Albverein als
„HW 6“bezeichnet und gekennzeichnet mit einem stilisierten schwarzen Wachturm
über rotem Balken. Ein Weniger an Markierungen wäre vielleicht ein Mehr an
Orientierungssicherheit. 5 - 6 Markierungen an einem Baum sind wirklich zuviel
des Guten! Vermisst habe ich eine bessere Kennzeichnung der Zu- und Abgangswege
zu den Etappenorten. Vielleicht sollte der Schwäbische Albverein doch öfter mal
auf französischen Weitwanderwegen wandern gehen.
Das
Landesvermessungsamt Baden-Württemberg hat eine Wander- und Radfahrkarte zum
Limeswanderweg (2005) herausgegeben. Sie deckt den Bereich von Miltenberg/Main
bis zur Wörnitz an der Landesgrenze zu Bayern ab und umfasst einen Streifen von
ca. 4 – 5 km diesseits und jenseits des Limes. Der Erwerb der einzelnen
Gebietswanderkarten ist nur notwendig, wenn man über andere markierte Wege
weiterwandern will, da diese nicht auf der Karte eingezeichnet sind.
Ein Unterkunftsverzeichnis ist unter
www.schwaebischer-albverein.de
als pdf-Datei bereit gestellt. An Wanderliteratur kann ich empfehlen: „Der Limes
in Südwestdeutschland“ von Dieter Planck, Willi Beck, 1987, Konrad Theiss Verlag
Stuttgart, leider
nicht
mehr erhältlich (mein Exemplar stammt aus der Stadtbibliothek!).
Der Führer dürfte
vor allem für den Historiker von Interesse sein, beinhaltet jedoch auch
Etappenlänge, Wanderzeit, Landschafts- und Wegebeschreibung. Im Wanderführer
„Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald“ (4. Auflage 2006) vom Schwäbischen
Albverein befindet sich eine Kurzbeschreibung des HW 6 für den Abschnitt
Öhringen - Lorch. Ein sehr guter Führer zur Beschreibung der durchquerten
Ortschaften liefert der Silberburg-Verlag (2005): „Dieter Buck, Ausflugsziel
Schwäbisch-Fränkischer Wald“.
Samstag, 24. Februar
2007
Ich starte mit
Begleitung in Jagsthausen zur ersten Tagesetappe. Schnell verlassen wir das
Jagsttal und durchwandern die Hohenloher Ebene bei windigem und regnerischem
Wetter. Bei Sindringen wird das Kochertal durchquert. Im Wald sehen wir das
erste restaurierte Fundament eines Wachturmes. Wir wandern weiter auf der
Hochebene über Pfahlbach, vorbei am Kastell Westernbach, das wir leider nicht
erblicken, nach Öhringen, dem heutigen Etappenort. Wir besichtigen noch kurz die
Stadtkirche, den Marktplatz und die sehenswerte Altstadt mit Stadtmauer und
Schloss, dann treten meine Mitwanderer die Heimreise an.
Wanderzeit: 5 Stunden.
 Sonntag, 25.
Februar 2007 Sonntag, 25.
Februar 2007
Leider muss ich die Bedienung zum Aufbruch drängen. Es
geht auf dem Radweg
durch
Wohnbausiedlungen der 60er – 90er Jahre nach Pfedelbach und weiter durch
Obstbaumkulturen und Weiler zur Waldgrenze. An einer der kleinen
Häuseransiedlungen stoße ich auf diese einzigartige Kombination von funktionalen
Gebäuden: oben das ehemalige Gefängnis, darunter die dörfliche Schnapsbrennerei.
Man kann sich darüber Gedanken machen. Dann bleibt mir noch Zeit, die
Regensachen überzuziehen und unter dem Regen hindurchzuwandern über einen noch
gut erhaltenen Limesabschnitt mit Wall und Graben. Bei der Gaststätte
Schönhardt, Neuwirtshaus, wird der HW 8 (Frankenweg) gequert. Die Waldwege sind
teilweise nur noch Schlammpfade, da die schweren Holzbearbeitungsgeräte nicht
für aufgeweichte Waldwege geeignet sind. Manchmal sehnt man sich nach Frost, Eis
und Schnee! Bei Gailsbach trifft man auf einen rekonstruierten hölzernen
Limesturm. Es gibt jedoch nach heutigen Erkenntnissen keine Hinweise auf
Holzbauweise. Nach ca.
5 Stunden Wanderzeit
erreiche ich gut durchfeuchtet das empfehlenswerte Cafe-Hotel Schoch in
Mainhardt, wo ich mir nach einer heißen Dusche den vorzüglichen Kuchen munden
lasse, während sich meine Bekleidung im Heizraum regenerieren darf.
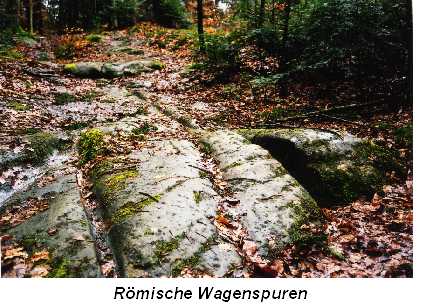 Montag, 26.
Februar 2007 Montag, 26.
Februar 2007
Sehenswert sind in Mainhardt noch die restaurierten
Grundmauern des Kastells und etliche Ausgrabungen. Das Museum habe ich leider
nur von außen gesehen. Ich wandere nach Querung der Bundesstraße beim
Gewerbegebiet über mehrere gut erhaltene Limesreste nach Grab. Dort wurde ein
Wachturm mit Graben und Palisade restauriert („Heidenbuckel“). Danach verlässt
man den Limes und wandert auf einer geologisch interessanten Strecke über
Klingen und Bäche nach Steinberg und Siegelsberg. Ich verlasse hier den
Limeswanderweg nach Murrhardt, wo der nächste Regen schon auf mich wartet.
Wanderzeit ca. 4 ½ Stunden.
Murrhardt lädt zum Verweilen ein: ehemaliges Kloster, Stadtkirche, malerische
Fachwerkhäuser, der Gasthof Engel – ältestes Gasthaus am Ort und Geburtsort des
Malers Reinhold Nägele -, und natürlich das Haus des Naturparks
Schwäbisch-Fränkischer Wald (www.naturpark-sfw.de,
info@naturpark-sfw.de)
mit sehenswerter Ausstellung und reichhaltigen Informationsbroschüren, auch zum
Limesweg.
 Dienstag, 27.
Februar 2007 Dienstag, 27.
Februar 2007
In Murrhardt gibt
es zu bemängeln, dass es keine Hinweisschilder auf den Limesweg gibt. Die
Querung des Murrtals durch den Limesweg ist nicht einfach zu finden. Es folgt
eine Berg- und Talstrecke mit restauriertem Wachturm beim Ebnisee/Kaisersbach.
Beim Überqueren der Hauptstraße Murrhardt – Welzheim sind durch die Waldarbeiten
nicht nur die Wege abhanden gekommen, sondern auch die Markierungen. Man wandert
über den Aichstrut-Stausee zum Kleinkastell Rötelsee, dessen Grundmauern
freigelegt wurden, nach Welzheim.
Wanderzeit ca. 6 Stunden.
 Mittwoch, 28. Februar
2007 Mittwoch, 28. Februar
2007
Da der Wanderweg
am Ort vorbeiführt trifft auch auf Welzheim zu, dass die Zu- und Abgänge mühsam
gesucht werden müssen. Ich wandere zum archäologischen Park Kastell
Welzheim-Ost, dessen Westtor eindrucksvoll restauriert wurde .
Durch den
eingeschränkten Blick des Wanderers mit Regenkapuze nehme ich einen Umweg in
Kauf, da ich keine Markierung erkennen konnte. Der Weg führt über den Haghof
entlang der Straße nach Pfahbronn und weiter über Limesreste durch den Wald,
vorbei an einem Wachturm und wahrscheinlich römischen Wagenspuren im Fels zum
Kloster Lorch, wo ich meine Wanderung ausklingen lasse und meine Regionalbahn
zur Heimfahrt besteige.
Wanderzeit ca. 4 ½ Stunden.
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
25 - April 2008
Wanderroute Moselle
Von Gerhard Wandel
Das Projekt
Anlässlich einer Tagung in Trier fiel mir im
Fremdenverkehrsbüro der „Mosel-land-Wanderführer“ der Mosellandtouristik GmbH,
eMail:
mosellandtouristik@t-online.de,
www.mosellandtouristik.de in die
Hände.
Der praktische
Führer in der Form eines Ringbuches (nachempfunden den einschlägigen
Fahrradwanderführern) enthält Kartenausschnitte 1: 50.000, Kurzwegebeschreibung,
Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und Infos zum ÖPNV. Bei näherer
Betrachtung musste ich die Wegführung teilweise über den Radweg an der Mosel,
sowie über diverse örtliche Wege bemängeln, wobei ich mir vorstellen könnte,
sich in jedem Ort mehrfach zu verzetteln. Ich stellte weiter fest, dass zwar die
Straßen keine Grenzen nach Frankreich und Luxemburg kennen, aber alle Wanderwege
an der Grenze enden. Ich sammelte bei der Messe CMT in Stuttgart fleißig
Material und entdeckte einen Katalog „Wanderroute Moselle“, gefördert mit
EU-Mitteln. Die Idee zur Durchführung einer grenzüberschreitenden Wanderung,
beginnend in Schengen (Luxemburg), über Trier nach Traben-Trarbach war geboren.
Ich plante, über die luxemburgischen Wege, den Moselhöhenweg des Eifelvereins
und des Hunsrückvereins zu wandern. Es sollte meine erste Fernwanderung auf
deutschem Boden werden.
 Die Durchführung Die Durchführung
Angekommen in Perl, der Endstation der
Deutschen Bahn AG, stelle ich fest: Die europäische Arbeitsteilung funktioniert
ja tatsächlich. 2 große Supermärkte stehen am Ortseingang, aber über 70 % der
davor geparkten Autos haben französische oder luxemburgische Kennzeichen. Dann
auf der anderen Seite der Mosel: Schengen, ein Dorf mit 250 Einwohnern, aber 5
Tankstellen, die Kunden vorwiegend aus Deutschland und Frankreich.
Ich folge von Schengen bis Wasserbillig
in Luxemburg dem E 3, einheitlich mit
gelbem Balken (soweit an extra Pfählen befestigt, auf blauem Grund)
gekennzeichnet.
 Der Weg führt weitgehend über asphaltierte Wirtschaftswege der
Weinberge und quert immer wieder die netten Winzerdörfer im Moseltal. Auch sind
größere Abschnitte durch Wiesen und Wälder geführt, zum Beispiel durchs Syrtal
von Manternach nach Wasserbillig. Am Ortseingang von Wasserbillig verlasse ich
den E 3 und gehe durch den Ort zur Brücke über die Sauer, die hier die Grenze zu
Deutschland bildet. An der Wasserbilliger Brücke finden sich bereits
Markierungen des Eifelvereins vom Moselhöhenweg (großes weißes „M“
auf schwarzem Grund). Ein eher unspektakulärer Weg durch Weinberge, Wiesen,
Felder und Wald führt mich auf einer alten Römerstraße nach Trier. Ich verlasse
den Moselhöhenweg bei den Hochspannungsleitungen und steige an einer
Ausflugswirtschaft mit Wanderparkplatz rechts steil hinunter nach Trier. Über
die Römerbrücke erreiche ich direkt das Stadtzentrum. Der Weg führt weitgehend über asphaltierte Wirtschaftswege der
Weinberge und quert immer wieder die netten Winzerdörfer im Moseltal. Auch sind
größere Abschnitte durch Wiesen und Wälder geführt, zum Beispiel durchs Syrtal
von Manternach nach Wasserbillig. Am Ortseingang von Wasserbillig verlasse ich
den E 3 und gehe durch den Ort zur Brücke über die Sauer, die hier die Grenze zu
Deutschland bildet. An der Wasserbilliger Brücke finden sich bereits
Markierungen des Eifelvereins vom Moselhöhenweg (großes weißes „M“
auf schwarzem Grund). Ein eher unspektakulärer Weg durch Weinberge, Wiesen,
Felder und Wald führt mich auf einer alten Römerstraße nach Trier. Ich verlasse
den Moselhöhenweg bei den Hochspannungsleitungen und steige an einer
Ausflugswirtschaft mit Wanderparkplatz rechts steil hinunter nach Trier. Über
die Römerbrücke erreiche ich direkt das Stadtzentrum.
 Den Weg durch die
Stadt möchte ich mir ersparen und nehme den Bus Nr. 1 vom Porta-Nigra-Platz nach
Trier-Ruwer (Sportplatz) und wandere dort über den Moselhöhenweg (weißes „M“
auf grünem Grund) des Hunsrückvereins nach Mehring, Strecke nicht zu empfehlen,
da die parallel verlaufende Autobahn A 1 jede Wanderfreude verdirbt! Nach der
Autobahnüberführung nehme ich den Moselverbindungsweg „
MV“
hinunter nach Mehring (schöne römische Villa auf der rechten Moselseite und
hübscher Ortskern auf der linken Moselseite) und steige von dort wieder über
Weinberge dem
MV
folgend bis zum Zitronenkreuz auf den Moselhöhenweg (Eifelseite) hoch. Den Weg durch die
Stadt möchte ich mir ersparen und nehme den Bus Nr. 1 vom Porta-Nigra-Platz nach
Trier-Ruwer (Sportplatz) und wandere dort über den Moselhöhenweg (weißes „M“
auf grünem Grund) des Hunsrückvereins nach Mehring, Strecke nicht zu empfehlen,
da die parallel verlaufende Autobahn A 1 jede Wanderfreude verdirbt! Nach der
Autobahnüberführung nehme ich den Moselverbindungsweg „
MV“
hinunter nach Mehring (schöne römische Villa auf der rechten Moselseite und
hübscher Ortskern auf der linken Moselseite) und steige von dort wieder über
Weinberge dem
MV
folgend bis zum Zitronenkreuz auf den Moselhöhenweg (Eifelseite) hoch.
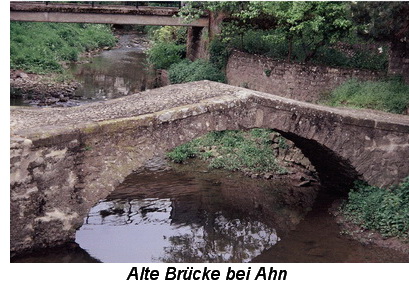 Der Weg führt über
Wälder und Weinberge nach Klüsserath und weiter nach Piesport. An der Landstraße
L 50 vor Piesport zweigt rechts ein lokaler Weg mit der Nr. 17 ab, der mich
durch Weinberge mit schöner Aussicht übers Moseltal, vorbei am Hotel Moselblick
hinunter nach Piesport bringt. Ich überquere die Mosel zum Winzerdorf
Niederemmel (Ortsteil von Piesport). Der Weg führt über
Wälder und Weinberge nach Klüsserath und weiter nach Piesport. An der Landstraße
L 50 vor Piesport zweigt rechts ein lokaler Weg mit der Nr. 17 ab, der mich
durch Weinberge mit schöner Aussicht übers Moseltal, vorbei am Hotel Moselblick
hinunter nach Piesport bringt. Ich überquere die Mosel zum Winzerdorf
Niederemmel (Ortsteil von Piesport).
 Von dort wird die zweite Moselbrücke
gequert und über den „Schiffswanderweg“
S
in Serpentinen die Weinberge hochgestiegen bis zur Kreisstraße 52, dort scharf
links abknicken und der Straße entlang laufen bis zum Wanderparkplatz und
Schutzhütte rechts der Straße. Hier zweigt der örtliche Weg Nr. 12 ab, der mich
wieder auf den Moselhöhenweg (Eifelseite) bringt. Von dort wird die zweite Moselbrücke
gequert und über den „Schiffswanderweg“
S
in Serpentinen die Weinberge hochgestiegen bis zur Kreisstraße 52, dort scharf
links abknicken und der Straße entlang laufen bis zum Wanderparkplatz und
Schutzhütte rechts der Straße. Hier zweigt der örtliche Weg Nr. 12 ab, der mich
wieder auf den Moselhöhenweg (Eifelseite) bringt.
 Durch Wald und Weinberge geht’s über
Monzel, Lieser nach Bernkastel-Kues. Nach Lieser habe ich die Markierung
verloren und wandere unmarkiert durch die Weinberge zum Winzerort Kues (Teilort
von Bernkastel-Kues). Ich überquere die Mosel und bin dann in Bernkastel wieder
auf der Hunsrückseite, wo ich über den Moselhöhenweg über den ehemaligen
jüdischen Friedhof zur Graacher Schäferei, vorbei an den „Graacher Schanzen“,
einer Befestigungsanlage der Franzosen aus dem Jahre 1795, über das ehemalige
Kloster Wolf nach Traben-Trarbach weiterwandere, wo mich eine Regionalbahn
wieder zurück in den Alltag bringt. Durch Wald und Weinberge geht’s über
Monzel, Lieser nach Bernkastel-Kues. Nach Lieser habe ich die Markierung
verloren und wandere unmarkiert durch die Weinberge zum Winzerort Kues (Teilort
von Bernkastel-Kues). Ich überquere die Mosel und bin dann in Bernkastel wieder
auf der Hunsrückseite, wo ich über den Moselhöhenweg über den ehemaligen
jüdischen Friedhof zur Graacher Schäferei, vorbei an den „Graacher Schanzen“,
einer Befestigungsanlage der Franzosen aus dem Jahre 1795, über das ehemalige
Kloster Wolf nach Traben-Trarbach weiterwandere, wo mich eine Regionalbahn
wieder zurück in den Alltag bringt.
Der
Etappenplan
1. Tag: Schengen – Remich ca. 4
– 4 ½ Std. Man kann an diesem Tag als Anreisetag direkt vom Bahnhof Perl im
Moseltal loswandern, oder auf deutscher Seite in Perl mit seiner sehenswerten
fürstbischöflichen Residenz übernachten und dann vom Ortszentrum Perl der
Jakobsmuschel folgend zur Schengener Brücke wandern. Wanderzeit dann ca. ½ Std.
länger.
2. Tag: Remich – Grevenmacher
ca. 7 – 7 ½ Std. Wanderzeit
3. Tag: Tag: Grevenmacher
–Wasserbillig – Trier ca. 6 ½ - 7 Std. Wanderzeit. Wer nicht wie ich direkt ins
Ortszentrum von Trier will, wird möglicherweise weiterwandern auf dem
Moselhöhenweg über die Mariensäule zur Kaiser-Wilhelm-Brücke.
4. Tag: Trier(Ruwer) – Mehring
ca. 4 ½ - 5 Std. Wanderzeit
5. Tag: Mehring – Piesport ca. 5
Std. (bis Ortszentrum) Wanderzeit
6. Tag: Piesport – Bernkastel
ca. 5 ½ Std. Wanderzeit
7. Tag: Bernkastel –
Traben-Trarbach ca. 4 – 4 ½ Std. (bis zur Mosel) Wanderzeit
Karten und Führer
Mehr etwas für Kartenliebhaber, als
dringende Notwendigkeit.
Luxemburg:
Schengen-Weiler-La-Tour
(R 10)
1:20.000
Luxemburg:
Sandweiler-Grevenmacher
(R 8)
1:20.000
LVA Rheinland-Pfalz
(Eifelverein) Trier
(Nr. 29)
1:25.000
LVA Rheinland-Pfalz
(Eifelverein) Der Meulenwald
(Nr. 30)
1:25.000
LVA Rheinland-Pfalz
(Eifelverein) Bernkastel-Kues
(Nr. 35)
1:25.000
Mosellandtouristik
„Moselland-Wanderführer“ 1:50.000
Wichtige Adressen in Luxemburg
Touristeninformation und Hotelbuchung:
www.visitluxembourg.lu
Touristenbüro:
www.ont.lu
Landesvermessungsamt (Karten):
Administration du Cadastre et de la Topographie, 54 avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxemburg,
www.etat.lu
Unterkünfte:
www.logis.lu,
www.youthhostels.lu
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
17 - August 2005
Auf
dem „Goldsteig“
durch den Bayerischen Wald
Von Gerhard Wandel
Im Herbst
2007 wurde mit dem „Goldsteig“ der bisher längste „Qualitätswanderweg“ in
Deutschland eröffnet. Allseits wird versucht, mit dem Markenzeichen „Goldsteig“
zu punkten, ob dies bei der Butter oder einem Gasthaus am Goldsteig ist. Nur
Wanderkarten für den Goldsteig bekommt man noch keine. Im Frühjahr 2008 ist im
Kompass-Verlag der Wanderführer „Goldsteig“ von Michael Körner und Christine
Meier erschienen. Man hört und liest viel über diese einzigartige
Urwaldlandschaft in Deutschland. Ein Besuch und ein persönlicher Eindruck kann
da nicht schaden.
 1.
Tag: Von Bayerisch Eisenstein
zum Falkenstein 1.
Tag: Von Bayerisch Eisenstein
zum Falkenstein
Von
Bayerisch Eisenstein folge ich dem E 6 über Schwellhäusl, Zwieseler Waldhaus,
Ruckowitzschachten zur Schutzhütte auf dem Großen Falkenstein. Beim Schwellhäusl
kann man gut die Anlage eines Triftteiches und Triftbaches erkennen. Diese
dienten zum Transport des geschlagenen Holzes in Richtung Donau. Die Trennung
von Radfahr- und Wanderwegen ist hier gut gelungen. Übernachtung erfolgt
„hüttenmäßig“ auf dem Großen Falkenstein als einzigem Gast.
Wanderzeit ca. 4 ½ Stunden.
 2.
Tag: Vom Großen Falkenstein
zum Großen Rachel 2.
Tag: Vom Großen Falkenstein
zum Großen Rachel
Heute ist
der Tag der „Schachten“ und Filze. Unter Schachten versteht man frühere
Bergweiden, die zwischenzeitlich teilweise zugewachsen sind. Über Albrecht-,
Rindel-, Jährlings-, Kohl-, Hochschachten, verlorener Schachten führt der Weg
durch Bergfichtenwälder, über Hochmoore und vorbei an Heidelbeersträuchern zum
„Waldschmidthaus“ am Großen Rachel (1452 m). Eine lange und anstrengende Etappe!
Markierung: grünes Dreieck des E 6, gelegentlich Logo des Goldsteigs.
Übernachtung in der Berghütte. Die Mücken treiben mich abends schnell in die
geschlossenen Räume!
Wanderzeit ca. 8 Stunden.
 3.
Tag: Vom Großen Rachel zum
Lusen 3.
Tag: Vom Großen Rachel zum
Lusen
Aufstieg vom Waldschmidthaus auf den Gipfel des Großen Rachel (zweithöchster
Berg des
Bayerischen Waldes) und anschließendem Abstieg zum Rachelsee. Ich folge der E 6
Bergvariante über Felsenkanzel, Teufelsloch und langem Aufstieg über die
sogenannte „Himmelsleiter“ zum Lusen. Große Waldschäden durch den Borkenkäfer.
Übernachtung in der Lusenschutzhütte.
Wanderzeit ca. 5 Stunden.
 4.
Tag: Vom Lusen über Mauth nach
Freyung 4.
Tag: Vom Lusen über Mauth nach
Freyung
Ich
wandere weiter auf dem E 6 über Tummelplatz, Steinbachklause nach Mauth. Hier
verlasse ich den Goldsteig bzw. E 6 und wandere auf einem der „Goldenen Steige“,
dem „Bergreichensteiner Weg“ über Kreuzberg nach Freyung. Die „Goldenen Steige“
wurden im Mittelalter als Handelswege von Passau in Richtung Böhmen angelegt und
dienten in erster Linie dem Transport von Salz. Auf dem Rückweg erfolgte der
Transport von allerlei Handelsgütern, vor allem Getreide. Die Markierung mit dem
Säumersymbol ist nicht so gut und man muss öfter einen Blick auf die Landkarte
werfen. Insgesamt wesentlich höherer Asphaltanteil; der Wanderweg ist teilweise
identisch mit dem Radweg. Hotelübernachtung in Freyung. Interessante
Hinweistafeln am Wegesrand.
Wanderzeit ca. 5 Stunden.
 5.
Tag: Von Freyung nach
Fürsteneck 5.
Tag: Von Freyung nach
Fürsteneck
Ich folge
weiter dem Bergreichensteiner Weg über Geyersberg, Harsdorf, Rumpenstadl,
Saußmühle, über lokale Wege nach Bruckmühle, Köpplhof, Eschberg und das
Osterbachtal bzw. Tal der Wolfsteiner Ohe nach Fürsteneck. Fürstliche
Übernachtung im Schlossgasthof „Fürsteneck“, einer restaurierten Burganlage.
Wanderzeit ca. 5 Stunden.
 6.
Tag: Von Fürsteneck nach
Passau 6.
Tag: Von Fürsteneck nach
Passau
Ich
wandere ein kurzes Stück die Wolfsteiner Ohe über die Einmündung in die Ilz
flussaufwärts und quere die Ilz und folge dann dem „E 8“, „Main-Donau-Weg“ bzw.
„Pandurensteig“ auf dem orthografisch rechten Ufer der Ilz bis Kalteneck, wo die
Ilz erneut gequert wird. Ich folge dann der orthografisch linken Seite der Ilz
bis Fischhaus, dann erneute Flussquerung. Es beginnt zu regnen und die
Regenbekleidung muss übergezogen werden. Wegen einer gesperrten Brücke am
Ilztalstausee muss ich wieder zurücklaufen. Es ist zwar auf eine Umleitung
hingewiesen. Welcher der Originalweg und welcher Weg die Umleitung ist, kann man
jedoch nicht unbedingt erkennen. Über die Mausmühle, Talsperre bei Oberilzmühle,
Hals wandere ich direkt nach Passau, dort Hotelübernachtung. In Passau sollte
man noch 1 bis 2 Tage für Stadtbesichtigung einplanen (Dom, Kirchen, Oberhaus,
sehenswertes römisches Museum).
Wanderzeit ca. 6 Stunden.
Benützte Karten:
Bayerisches Landesvermessungsamt 1: 50.000
Umgebungskarte 50-29 Nationalpark Bayerischer Wald, Naturpark östlicher Teil und
50-30 Naturpark südlicher Teil
Wanderführer: Kompass
„Goldsteig Kammvariante“, Auflage 2008
Wichtige Internetadressen:
www.bayerischer-wald-verein.de/wandern
hier sind
auch die einzelnen Etappen des E 6 und E 8 beschrieben. Nicht korrekt ist jedoch
die Angabe, dass auf dem Waldschmidthaus nicht übernachtet werden kann!
www.wandern-goldsteig.de
www.ostbayern-tourismus.de
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
26 - August 2008
Auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg – Sommer 2010
Von Wolfgang Dettling
Wieder einmal – oder ein weiteres Mal
auch in Deutschland: „Pilgerwege und kein Ende in Sicht“ (G. Wandel)? Es scheint
ja inzwischen fast eine besondere Originalität darin zu bestehen, wenn man auch
in Deutschland nicht an einem Jakobsweg wohnt und auf einem Weg wandern kann,
der nicht gleichzeitig auch ein Jakobsweg ist.
Aber dennoch: Im Jahr 1999 wurde der so genannte Fränkisch-Schwäbische Jakobsweg
erschlossen, der die mittelalterlichen Pilger(sammel)orte Würzburg, Rothenburg
o.d.T. und Ulm verbindet. Damit schließt dieser Weg an den Mittelfränkischen
Jakobsweg an, der von der tschechischen Grenze über Nürnberg und
Heilsbronn herkommt und später dann über
die Jakobuskirche von Hohenberg bei Ellwangen über die Schwäbische Alb
weiterführt nach Ulm.
Inzwischen hat der Fränkisch-Schwäbische Jakobsweg, vom Steigerwald Klub und dem
Schwäbischen Albverein mit einer weißen Muschel auf blauem Grund markiert, eine
gute Akzeptanz gefunden. „Ah, dia Pilger kommed“, begrüßt der alte Landwirt am
Ortseingang von Schainbach bei Wallhausen den Jakobspilger, „ond bei ons kennd
dr au guad übernachda!“. Gesagt – getan, das sind gerade die Überraschungen, die
die Jakobswege immer noch attraktiv machen, wenn man sich auf die Wege einlässt
und ohne genauere Vorplanungen startet. Ein (nicht ganz vollständiges)
Übernachtungsverzeichnis gibt es bei der Fränkischen St. Jakobusgesellschaft in
Würzburg, die Markierungen sind inzwischen
zum
großen Teil ausreichend und verlässlich – ab Würzburg bis zum Hohenberg verläuft
der Jakobsweg auch zum Teil parallel zum HW4 – und das im Seehars-Verlag in der
dritten aktualisierten Auflage 2010 erschienene Buch zum Fränkisch-Schwäbischen
Jakobsweg bietet dem Pilger eine solide Wegbeschreibung und vielfältige
kulturelle Anregungen.
 Der
Jakobspilger startet in Würzburg und geht bis Ulm 270 km auf meist sanft
hügeligen und vielfach gut ausgebauten Wegen. Der Weitwanderer mag die langen
Teeretappen (z. B. von Würzburg bis Uffenheim) als lästig empfinden, als
Pilgerweg (und HW4) lassen sie sich nicht umgehen. Entschädigt wird man aber
durch herrliche Wege in den Flusstälern der Jagst, des Kochers, der Lein und der
Lone, wo der Weg immer wieder auch ansteigt, alte Verbindungstraßen benützt und
zum Beispiel beim Albaufstieg zwischen Bargau und dem Bargauer Kreuz ein
längeres Stück auch heftiger ansteigt. Für den ganzen Weg sollte man
mindestens 11 Tage veranschlagen. Besser ist es, sich mehr Zeit zu lassen, denn
im Eilschritt lassen sich Spiritualität, Kultur und Begegnungen mit den Menschen
am Weg kaum erleben. Der
Jakobspilger startet in Würzburg und geht bis Ulm 270 km auf meist sanft
hügeligen und vielfach gut ausgebauten Wegen. Der Weitwanderer mag die langen
Teeretappen (z. B. von Würzburg bis Uffenheim) als lästig empfinden, als
Pilgerweg (und HW4) lassen sie sich nicht umgehen. Entschädigt wird man aber
durch herrliche Wege in den Flusstälern der Jagst, des Kochers, der Lein und der
Lone, wo der Weg immer wieder auch ansteigt, alte Verbindungstraßen benützt und
zum Beispiel beim Albaufstieg zwischen Bargau und dem Bargauer Kreuz ein
längeres Stück auch heftiger ansteigt. Für den ganzen Weg sollte man
mindestens 11 Tage veranschlagen. Besser ist es, sich mehr Zeit zu lassen, denn
im Eilschritt lassen sich Spiritualität, Kultur und Begegnungen mit den Menschen
am Weg kaum erleben.
Beeindruckt haben mich am
Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg neben der Erfahrung, dass die Menschen sich
vielfach mit diesem Weg zu identifizieren gelernt haben, die abwechslungsreichen
Landschaften und Siedlungen. Romantische Städte, stattliche Bauerndörfer,
verträumte Weiler und einsame Gehöfte wechseln sich ab: die ehrwürdige und
geschichtsträchtige Bischofsstadt Würzburg und die romantischen Mainstädte bis
Ochsenfurt, Uffenheim und das mittelalterliche Rothenburg o. d. T., Crailsheim
und Ulm sind Städte am Wege, die zum Verweilen einladen. Sehr oft aber kommen
der Pilger und Wanderer durch kleine Dörfer, ohne Industrieansiedlung, dafür mit
stattlichen Bauernhäusern, gepflegten Gärten und freundlichen Menschen.
 Wer sich
von Volksfrömmigkeit noch ansprechen lässt, der hat auf diesem Weg vielfache
Gelegenheiten. Unterwegs trifft man immer wieder auf (neu errichtete) Feld- oder
Pilgerkreuze, Bildstöcke, Meditationsstelen und Kapellen. In vielen Dörfern,
laden Kirchen zu Gebet und Meditation ein, sofern man sich die Mühe macht, den
Schlüssel zu holen, den man meist nahe der Kirche problemlos („das mach´ ich
doch gern!“) erhalten kann. Höhepunkte mittelalterlicher Kirchenkunst sind
sicherlich der Herlin- und der Riemenschneideraltar in der Jakobuskirche in
Rothenburg (für Jakobspilger kostenloser Besuch), der Flügelaltar der
Johanneskirche in Crailsheim und der Multscher-Altar
in der
unscheinbaren evangelischen Dorfkirche von Scharenstetten. Eben gerade die
Kirchlein am Weg – Eiblstadt, Schainbach, Sontbergen sind mir besonders in
Erinnerung – machen den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg zu einem auch kulturell
lohnend zu gehenden Pilger- und Wanderweg. Wer sich
von Volksfrömmigkeit noch ansprechen lässt, der hat auf diesem Weg vielfache
Gelegenheiten. Unterwegs trifft man immer wieder auf (neu errichtete) Feld- oder
Pilgerkreuze, Bildstöcke, Meditationsstelen und Kapellen. In vielen Dörfern,
laden Kirchen zu Gebet und Meditation ein, sofern man sich die Mühe macht, den
Schlüssel zu holen, den man meist nahe der Kirche problemlos („das mach´ ich
doch gern!“) erhalten kann. Höhepunkte mittelalterlicher Kirchenkunst sind
sicherlich der Herlin- und der Riemenschneideraltar in der Jakobuskirche in
Rothenburg (für Jakobspilger kostenloser Besuch), der Flügelaltar der
Johanneskirche in Crailsheim und der Multscher-Altar
in der
unscheinbaren evangelischen Dorfkirche von Scharenstetten. Eben gerade die
Kirchlein am Weg – Eiblstadt, Schainbach, Sontbergen sind mir besonders in
Erinnerung – machen den Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg zu einem auch kulturell
lohnend zu gehenden Pilger- und Wanderweg.
Wer sich – als Wanderer – mehr für den Weg als solchen interessiert, den führt
der Pilgerweg fast ausschließlich durch dünn besiedeltes Gebiet, in welchem bis
jetzt sehr wenig Industrie und Fremdenverkehr Einzug gehalten haben. Auf den
meist einsamen Wegen durch Wald, Feld und Flur hat man auch (noch) nicht den
Eindruck, auf einem überfüllten Jakobsweg zu sein. Die Einkaufs- und
Übernachtungsmöglichkeiten sind – so haben wir es trotz mancher urlaubsbedingt
geschlossenen Gasthäuser erlebt – insgesamt gut. In Gaukönigshofen und am
Hohenberg gibt es typische Pilgerherbergen, vielfach am Weg auch
Privatunterkünfte (von Jakobspilgern) und selbst
der
passionierte Zelt-Pilger hat in den weiten (Fluss-)Ebenen Möglichkeiten, seine
Unabhängigkeit durch spontan gewählte Übernachtungsplätze noch zu steigern.
Nähere Informationen erhält man bei der Fränkischen St. Jakobusgesellschaft
Würzburg e.V. (www.jakobus-gesellschaften.de)
und/oder gerne auch bei mir (Wolfgang.Dettling@web.de - Telefon 07520/953637). Für Beobachtungen am Weg,
Eindrücke und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar!
Buchtipp: Erich Baierl, Wolfgang Dettling, Peter Högler, Johann
Rebele, Auf dem Jakobsweg von Würzburg über Rothenburg o.d.T. und Hohenberg nach
Ulm, Seehars Verlag Uffenheim, 32010 (ISBN 978-3-927598-27-0)
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
33 - Dezember 2010
Auf dem EB
unterwegs im Erzgebirge
Drei
Etappen auf dem EB: von Neuhermsdorf über Rechenberg-Bienenmühle,
Deutschgeorgenthal und Rauschenbach nach Neuhausen und weiter über
Schwartenberg, Seiffen, Olbernhau und Ansprung nach Pobershau
Von Katharina Wegelt
 Unterwegs
auf dem E4 im großen Urlaub. Und zwischendurch? Na Mensch, der E3 verläuft doch
quasi vor unserer Haustür. Das wäre doch mal was … Na gut – gehen wir´s an,
dachten wir im Frühjahr 2009 und nahmen uns zunächst den Abschnitt vor, der auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR verläuft. Immer Ostern wollen wir hier unterwegs
sein. So starteten wir Ostern vor zwei Jahren in Bad Schandau – nachzulesen im
Blog
http://www.netzwerk-weitwandern.de/.
Unterwegs änderten wir unsere Meinung ein wenig – und stiegen vom E3 auf den EB
um, den „legendären“ Weg Eisenach-Budapest. (Beide Wege verlaufen zu großen
Teilen parallel). Im vergangenen Jahr nun - Anfang April - war´s ein absolutes
Heimspiel: Unterwegs im Erzgebirge. Unterwegs
auf dem E4 im großen Urlaub. Und zwischendurch? Na Mensch, der E3 verläuft doch
quasi vor unserer Haustür. Das wäre doch mal was … Na gut – gehen wir´s an,
dachten wir im Frühjahr 2009 und nahmen uns zunächst den Abschnitt vor, der auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR verläuft. Immer Ostern wollen wir hier unterwegs
sein. So starteten wir Ostern vor zwei Jahren in Bad Schandau – nachzulesen im
Blog
http://www.netzwerk-weitwandern.de/.
Unterwegs änderten wir unsere Meinung ein wenig – und stiegen vom E3 auf den EB
um, den „legendären“ Weg Eisenach-Budapest. (Beide Wege verlaufen zu großen
Teilen parallel). Im vergangenen Jahr nun - Anfang April - war´s ein absolutes
Heimspiel: Unterwegs im Erzgebirge.
1. Tag: von Neuhermsdorf über Rechenberg-Bienenmühle, Deutschgeorgenthal und
Rauschenbach nach Neuhausen - 28 km
Es ist nicht wirklich überraschend, dennoch wäre es nicht nötig gewesen zur
Auftaktwanderung: Es liegt noch Schne e im Erzgebirge. Und der ist leider fest
und teilweise spiegelglatt an diesem Freitagmorgen. Doch wir sind frohgemut nach
einem leckeren Frühstück im Hermsdorfer Sporthotel (siehe 5. Etappe/
Vorjahresbericht im blog), wo es kein Problem war, sich zu früher Stunde als
Nicht-Haus-Gast zu stärken. Hier bekomme ich auch meinen ersten Stempel für
diese Tour. Als wir im Mai vergangenen Jahres hier anlangten, gab es die
EB-Stempelstelle noch nicht.
 Los
geht´s entlang der inzwischen an vielen Orten bekannten Hochzeitsbäume. Die
Sonne erkämpft sich ihre Höhe. Wir genießen sie und bald den Blick in die Ferne,
wo malerisch die Burgruine Frauenstein (Anlage erbaut um 1000) grüßt. Am
südlichsten Zipfel Nassaus (entstanden um 1200 als so genanntes Waldhufendorf,
heute gehört es zur Stadt Frauenstein und ist ein beliebtes Urlaubsziel, vor
allem für Wintersportler und zum Wandern, besitzt eine der Orgeln des bekanntes
Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann) präsentieren sich uns herrliche
erzgebirgische Häuschen mit einladenden Gärten. Richtig urig. Kurz nach dem
Forsthaus biegt links ein Trimm-Dich-Pfad vorm beginnenden
Wald ab. Hier fehlt das Wanderzeichen – sowohl für den EB als auch für den E3,
die derzeit noch zusammen verlaufen. Wir marschieren trotz Karte (man sollte
eben ab und an auch drauf schauen) geradeaus durch den Wald und erhalten für den
Umweg – wie wir dann gleich bemerken werden – einen herrlichen Panoramablick.
Dann richten wir unseren Fehler: Wir marschieren die zum Glück nur wenigen 100
Meter zurück und biegen nun auch ab. Los
geht´s entlang der inzwischen an vielen Orten bekannten Hochzeitsbäume. Die
Sonne erkämpft sich ihre Höhe. Wir genießen sie und bald den Blick in die Ferne,
wo malerisch die Burgruine Frauenstein (Anlage erbaut um 1000) grüßt. Am
südlichsten Zipfel Nassaus (entstanden um 1200 als so genanntes Waldhufendorf,
heute gehört es zur Stadt Frauenstein und ist ein beliebtes Urlaubsziel, vor
allem für Wintersportler und zum Wandern, besitzt eine der Orgeln des bekanntes
Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann) präsentieren sich uns herrliche
erzgebirgische Häuschen mit einladenden Gärten. Richtig urig. Kurz nach dem
Forsthaus biegt links ein Trimm-Dich-Pfad vorm beginnenden
Wald ab. Hier fehlt das Wanderzeichen – sowohl für den EB als auch für den E3,
die derzeit noch zusammen verlaufen. Wir marschieren trotz Karte (man sollte
eben ab und an auch drauf schauen) geradeaus durch den Wald und erhalten für den
Umweg – wie wir dann gleich bemerken werden – einen herrlichen Panoramablick.
Dann richten wir unseren Fehler: Wir marschieren die zum Glück nur wenigen 100
Meter zurück und biegen nun auch ab.
 Mitten
im Wald dann eine große Wanderwegkreuzung. EB und E3 trennen sich. Während der
E3 nun nördlich durch Rechenberg-Bienenmühle und dann weiter nach Sayda führt,
landen wir mitten im Ort und marschieren hier 2 km am Straßenrand bis zur
malerischen Burgruine. Dort ist auch das Tourist-Büro. Leider ist es nicht
besetzt (Ich schicke später mein Stempelheftchen dorthin und bekomme meinen
Eintrag). Auch Rebi, wie die Erzgebirger den langen Doppelortsnamen abkürzen,
ist ein typischer Erzgebirgsort: Schmucke, meist kleine, niedrige Häuser mit
hohen Dächern prägen das Bild. Eine Eisenbahnlandschaft. Mitten
im Wald dann eine große Wanderwegkreuzung. EB und E3 trennen sich. Während der
E3 nun nördlich durch Rechenberg-Bienenmühle und dann weiter nach Sayda führt,
landen wir mitten im Ort und marschieren hier 2 km am Straßenrand bis zur
malerischen Burgruine. Dort ist auch das Tourist-Büro. Leider ist es nicht
besetzt (Ich schicke später mein Stempelheftchen dorthin und bekomme meinen
Eintrag). Auch Rebi, wie die Erzgebirger den langen Doppelortsnamen abkürzen,
ist ein typischer Erzgebirgsort: Schmucke, meist kleine, niedrige Häuser mit
hohen Dächern prägen das Bild. Eine Eisenbahnlandschaft.
(Die Geschichte des heutigen Ferien- und Erholungsortes Rechenberg-Bienenmühle
geht auch bis ins 11. Jhd. zurück. Burgfelsen, ehemaliges Schloss und zahlreiche
Fachwerkhäuser prägen noch immer das Bild des Ortes, der auch bekannt ist für
seine Brauerei – Braurecht seit 1558. Interessant das dazugehörige Museum:
www.museumsbrauerei.de
)
Es geht wieder bergan und ab in den Wald. Die Sonne lacht. An einer
Wanderwegkreuzung finden wir einen hübschen Rastplatz. Kaum ausgepackt, zeigt
Frau Holle, was sie kann: Riesige Schneeflocken lassen unseren heißen Tee
schnell auskühlen. Also weiter, bevor auch wir auskühlen.
Deutschgeorgenthal ist schnell erreicht (Der Ortsteil Neuhausen liegt im
Übergangsgebiet von Westerzgebirge zu Osterzgebirge auf deutscher Seite und
grenzt direkt ans böhmische Erzgebirge – getrennt durch die Flöha. Der
Grenzübergang zur tschechischen
Nachbargemeinde Český Jiřetín (Georgendorf) wurde 1995 für Wanderer
wiedereröffnet, für Autofahrer erst 2008. Während der EB durch
Deutschgeorgenthal verläuft, führt der E3 durch Český Jiřetín).
 Am
Grenzübergang nach Tschechien ist viel Betrieb. Wir biegen fix ab und sind recht
bald wieder allein unterwegs. Jetzt geht es immer mit Blick auf die
Rauschenbachtalsperre um diese herum, bis wir den gleichnamigen Ort erreichen.
Rasch einen Stempel geholt in der Jägerklause und ein Eis auf die Hand, und
weiter geht´s in Richtung Neuhausen, unserem heutigen Ziel. Leider marschieren
wir ab jetzt nur noch auf Asphalt. Das fetzt nach dieser nicht wirklich kurzen
Auftaktwanderung gar nicht. Schnell qualmen unsere Füße. Am
Grenzübergang nach Tschechien ist viel Betrieb. Wir biegen fix ab und sind recht
bald wieder allein unterwegs. Jetzt geht es immer mit Blick auf die
Rauschenbachtalsperre um diese herum, bis wir den gleichnamigen Ort erreichen.
Rasch einen Stempel geholt in der Jägerklause und ein Eis auf die Hand, und
weiter geht´s in Richtung Neuhausen, unserem heutigen Ziel. Leider marschieren
wir ab jetzt nur noch auf Asphalt. Das fetzt nach dieser nicht wirklich kurzen
Auftaktwanderung gar nicht. Schnell qualmen unsere Füße.
Neuhausen ist uns bekannt, hier haben wir schon einige Tagestouren gemacht. Das
Nußknackermuseum mit dem weltgrößten funktionierenden Nussknacker oder das
Schloss Purschenstein mit seinem schönen Park sowie das Glasmuseum etc.
kann man hier besuchen – es lohnt in jedem Fall.
Die Ortsdurchquerung Neuhausen zieht sich – und unsere Pension liegt am anderen
Ende des Ortes. Natürlich „verlaufen“ wir uns noch einmal, kommen dann aber doch
gut an im „Gasthof zur edlen Krone“ – er liegt fast ganz am Ende einer Sackgasse
im OT Frauenbach – total ruhig. Allerdings ist jetzt erstmal nichts mit
ausruhen. Denn es ist schon 19 Uhr, und 20 Uhr schließt der Gasthof. Drum hurtig
geduscht und ab zum Essen. Das ist lecker.
Fazit des Tages: Eine Strecke mit herrlichen Aussichten, schöner Wegeführung,
viel Kultur und einsamen Abschnitten. Lohnenswert.
Gasthof zur edlen Krone
Tel.: 037361/ 45 608
www.edle-krone-erzgebirge.de
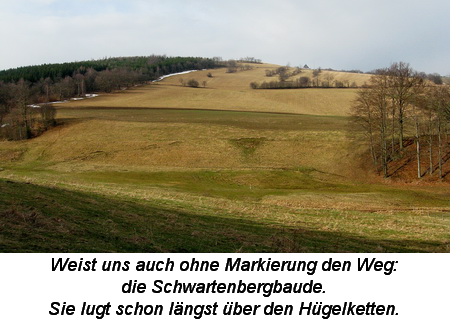 2. Tag:
von Neuhausen über den Schwartenberg und Seiffen nach Olbernhau - 18 km 2. Tag:
von Neuhausen über den Schwartenberg und Seiffen nach Olbernhau - 18 km
Herrlich haben wir geschlafen in diesem Gasthof, der schon sehr lange Gäste
willkommen heißt. Er liegt etwas abseits unseres Wanderwegs. Wir aber
marschieren nicht erst zurück ins Ortszentrum, sondern peilen unser nächstes
Ziel direkt an: den Schwartenberg, dessen Baude uns über viele km das Ziel
weist, denn sie lugt über die Hügelketten herüber. Unterwegs laufen wir auf so
lustig benannten Wegen wie dem Kuhdreckflussweg und kreuzen den Wanderweg Sayda
- Mezibori, der die beiden Partnerstädte im Erzgebirge und in Tschechien
miteinander verbindet. Einmal im Jahr wird dieser Weg von Bürgern beider Städte
gemeinsam gegangen.

Am Fuße des Schwartenberges stoßen wir wieder auf unseren Wanderweg. Vor uns
kämpfen sich zwei Radfahrer den Berg hinauf. Nein, wir laufen lieber! Herrlich
ist der Rundblick vom Schwartenberg bis weit ins Land.
Auch Wanderwege ohne Ende verlaufen hier, selbst der E3 ist wieder da – aber nur
kurz. Fast parallel führen beide Wege nun bis Seiffen (Der Kurort Seiffen ist
wegen seiner traditionellen Holzkunstherstellung besser bekannt als
Spielzeugdorf – oft wird dabei auch die barocke Dorfkirche dargestellt).
Hier ist Trubel – Weihnachtstrubel zu Ostern. Der Ort geschmückt mit allerlei
Gedrechseltem. Neben Weihnachtspyramiden und anderen schönen erzgebirgischen
Dingen für die Advents- und Weihnachtszeit, gibt es aber auch Österliches und
Zeitloses. Ein kurzer Abstecher ins Spielzeugmuseum muss sein: Hier gibt es den
Stempel für heute.
 Dann
drängen wir uns durch die Menschenmassen und laufen auf dem Sachsenweg nach
Olbernhau. Ein schöner, ruhiger Weg. Wir legen eine kleine Rast ein. Olbernhau –
die Stadt der sieben Täler, die uns am Abend in der Kneipe wahrlich jeder Gast
aufzählen kann – begrüßt uns mit einem Auf und Ab. Dann
drängen wir uns durch die Menschenmassen und laufen auf dem Sachsenweg nach
Olbernhau. Ein schöner, ruhiger Weg. Wir legen eine kleine Rast ein. Olbernhau –
die Stadt der sieben Täler, die uns am Abend in der Kneipe wahrlich jeder Gast
aufzählen kann – begrüßt uns mit einem Auf und Ab.
 Kurz
nach dem Ortseingang geht es durch
die Hotelanlage Saigerhütte, in der es noch regelmäßig Führungen durch die
erhaltenen Anlagen bzw. deren Reste der 1537 gegründeten Saigerhütte gibt (Tel.:
037360/73367). 22 einst privilegierte Gemeinden, ausgestattet mit allen Rechten
und Pflichten, wie Gerichtsbarkeit, Schulwesen, Brau- und Schankrecht. Zu sehen
sind von der ehemals in sich geschlossenen Industriegemeinde noch das Haus des
Richters, die Hüttenschule und Zimmerhaus, Brauhaus und Hüttenschänke sowie
Teile der Mauer. Kurz
nach dem Ortseingang geht es durch
die Hotelanlage Saigerhütte, in der es noch regelmäßig Führungen durch die
erhaltenen Anlagen bzw. deren Reste der 1537 gegründeten Saigerhütte gibt (Tel.:
037360/73367). 22 einst privilegierte Gemeinden, ausgestattet mit allen Rechten
und Pflichten, wie Gerichtsbarkeit, Schulwesen, Brau- und Schankrecht. Zu sehen
sind von der ehemals in sich geschlossenen Industriegemeinde noch das Haus des
Richters, die Hüttenschule und Zimmerhaus, Brauhaus und Hüttenschänke sowie
Teile der Mauer.
Nach diesem spannenden Ausflug in zurückliegende Jahrhunderte wird es nun
zunächst sehr nüchtern. Denn bevor man wieder im Wald ist, geht es durchs
Gewerbegebiet und dann ein letztes Mal für heute bergan. Wenn auch nur auf knapp
600 Meter, unsere Beine spüren es deutlich.
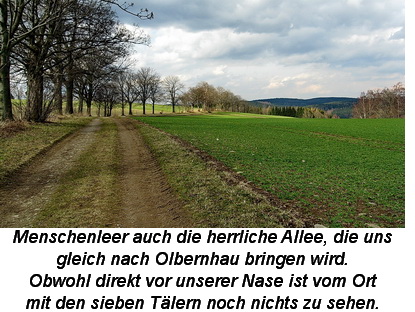 Und wieder geht eine Etappe traumhaft zu Ende: Entlang einer herrlichen Allee
mit fantastischem Blick auf die Stadt, vorbei an der zu dieser Jahreszeit
verwaisten Skianlage geht es hinab nach Olbernhau. Vorbei am Rittergut, in dem
sich auch das städtische Museum befindet und in dem alljährlich in der
Adventszeit zu einem besonderen Weihnachtsmarkt eingeladen wird, geht es über
den anheimelnden Boulevard mit seinen hübschen Häusern in unsere heutige
Pension. Dort sind wir die einzigen Gäste, die Bewirtschafterin telefonieren wir
– wie besprochen – erst heran. Und wieder geht eine Etappe traumhaft zu Ende: Entlang einer herrlichen Allee
mit fantastischem Blick auf die Stadt, vorbei an der zu dieser Jahreszeit
verwaisten Skianlage geht es hinab nach Olbernhau. Vorbei am Rittergut, in dem
sich auch das städtische Museum befindet und in dem alljährlich in der
Adventszeit zu einem besonderen Weihnachtsmarkt eingeladen wird, geht es über
den anheimelnden Boulevard mit seinen hübschen Häusern in unsere heutige
Pension. Dort sind wir die einzigen Gäste, die Bewirtschafterin telefonieren wir
– wie besprochen – erst heran.
Die Idee, am Abend doch noch ins Kino zu gehen, denn Olbernhau hat noch eins und
das auch sehr nahe unserer Unterkunft, verwerfen wir, da der Film erst ziemlich
spät anläuft. Beim Abendessen in der Gastwirtschaft auf dem Areal unserer
Pension kommen wir mit dem Wirt und einheimischen jungen Männern schnell ins
Gespräch. Unseren Schlenker um Olbernhau herum verstehen sie nicht: „Das wäre
auch kürzer gegangen“, meinen sie lachend und bieten sogar an, uns morgen zum
nächsten Etappenziel zu fahren.
Fazit des Tages: Spannender Anfang, große Wegeteile im Wald, dennoch sehr
abwechslungsreich, fast komplett asphaltfrei, nur der Bogen um den Zielort zieht
sich – der letzte Abschnitt entlohnt dafür jedoch.
Gaststätte und Pension „Berggasse“
Tel. 037360/660 112
www.berghof-olbernhau.de
 3. Tag: von Olbernhau über Ansprung nach Pobershau - 17 km 3. Tag: von Olbernhau über Ansprung nach Pobershau - 17 km
Der Start ähnelt an diesem Tag einem Rundwanderweg. Im Ort flitzen wir dreimal
hin und her – einfach zu viele
EB-Schilder, die wirklich in alle vier Himmelsrichtungen weisen. Dann haben wir
endlich den Steinbruchweg unter den Füßen und damit die richtige Richtung.
 Hinaus aus Olbernhau erreichen wir bald das Rungstocktal, ein romantisches,
einsames und ursprüngliches Tal. Danach setzen wir unseren Weg auf einem
Forstweg fort. Als wir den Wald verlassen, liegt Ansprung vor uns. Hinaus aus Olbernhau erreichen wir bald das Rungstocktal, ein romantisches,
einsames und ursprüngliches Tal. Danach setzen wir unseren Weg auf einem
Forstweg fort. Als wir den Wald verlassen, liegt Ansprung vor uns.
Ein Ort, der scheinbar lustige Einwohner hat: In einem Vorgarten sehen wir u. a.
ein Wetterhaus mit lebendigen Ziegen. Im Zentrum des Ortes kehren wir zu Mittag
in den Gasthof „Zur Sonne“ ein. Wir haben vergessen, dass Ostersonntag ist. So
passen wir mit unserer verschwitzten Wanderkluft nicht recht zu den anderen
Festtagsgästen. Die Wirtin ist herzlich, das Essen schmeckt.
 Gut gestärkt ziehen wir weiter – übers freie Feld mit weitem Blick in Richtung
Freizeitheim Hüttstattmühle. Im davor gelegenen ehemaligen Aussiedlerheim (noch
früher Jugendherberge) sollen wir unseren EB-Stempel bekommen. Doch dort wohnen
nur noch die Mäuse. Aber einen Gut gestärkt ziehen wir weiter – übers freie Feld mit weitem Blick in Richtung
Freizeitheim Hüttstattmühle. Im davor gelegenen ehemaligen Aussiedlerheim (noch
früher Jugendherberge) sollen wir unseren EB-Stempel bekommen. Doch dort wohnen
nur noch die Mäuse. Aber einen
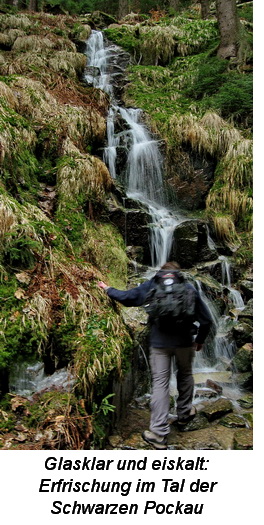 Stempel habe ich mir dennoch geholt: im
Freizeitheim, das wild romantisch liegt und damit einstimmt auf die nächsten
Kilometer. Stempel habe ich mir dennoch geholt: im
Freizeitheim, das wild romantisch liegt und damit einstimmt auf die nächsten
Kilometer.
Es geht tief hinab ins Tal der Schwarzen Pockau, meist nur Schwarzwassertal
genannt. Eine beliebte Wandergegend – man sieht es. Trotz Schneematsches und
kühler Temperaturen sind viele Menschen mit Kind und Kegel unterwegs. Über den
steilen Königssteig erreichen wir ein beliebtes Ausflugsziel: den Katzenstein,
der seinen Namen seiner einstigen Form verdankt. Wegen Absturzgefahr ist der
Felsvorsprung jedoch abgetragen worden. Von der herrlichen Aussichtsplattform
ist das Rauschen der Pockau in rund 90 Metern Tiefe zu hören, und wir können
einen Teil unseres Weges zurückverfolgen.
Im nahe gelegenen Pobershau, in dem wir wegen starken Regens kurz den Weg
verlieren und so eine größere Schleife umsonst laufen – weil sie nur durch eine
austauschbare Eigenheimsiedlung führt – endet unsere Ostertour 2010.
Fazit des Tages: Einsame Tour – bis auf das „Highlight“ Katzenstein, wild
romantisch, ursprünglich. asphaltarm.
Und hier geht es nun zu Ostern in diesem Jahr weiter: von Pobershau über
Marienberg nach Wolkenstein (18 km), weiter nach Geyer (22 km) und dann via
Schlettau nach Scheibenberg (20 km).
Fotos: Katharina Wegelt
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
34 - April 2011
Pfingsten 2010
Durch die südliche Eifel von
Brohl am Rhein nach Trier:
22.5. - 04.06.2010
Von Walter Brückner
Wanderkarten: 1:25.000
Topogr. Karte „ Rund um den Laacher See“
1:50.000
Kompass Karte 838 „ Hohe Eifel – Osteifel“
1:25.000
„Daun, rund um die Kraterseen“
1:50.000
GeoMap „Vulkaneifel Schneifel“
1:25.000
Naturpark Südeifel ( Blatt 2 )
1:25.000
„Das Ferschweiler Plateau“
1:25.000
Topogr. Karte „Trier und Trier-Land“
Führer: „Der Weitwanderweg durch
die südliche Eifel“, Christiane Rüffer-Lukowicz und Jochen Rüffer, J.P.Bachem
Verlag, Köln, ISBN 978-3-7616-2045-8
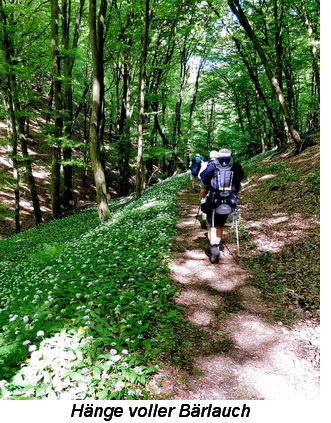 Die
Autoren haben die Strecke selbst zusammengestellt und dabei weitgehend markierte
Wanderwege benutzt, wobei die Markierung öfter wechseln kann. Es gibt auch
Teilstrecken ohne jede Markierung. Das verlangt von den Autoren eine genaue und
prägnante Wegbeschreibung, was nicht einfach ist und trotz aller Sorgfalt zu
Fehldeutungen führen kann. Vom Benutzer des Führers wird entweder ein sehr gutes
Gedächtnis erwartet oder, dass er häufig mit dem Führer in der Hand wandert, was
auf Dauer niemand durchhält. Man muss also darauf gefasst sein, sich immer mal
wieder zu verlaufen. Das ist allerdings nicht schlimm. Schließlich kann sich ja
jeder seine eigene Strecke
basteln. Wichtig ist nur, dass man auch die richtigen Wanderkarten dabei hat. Die
Autoren haben die Strecke selbst zusammengestellt und dabei weitgehend markierte
Wanderwege benutzt, wobei die Markierung öfter wechseln kann. Es gibt auch
Teilstrecken ohne jede Markierung. Das verlangt von den Autoren eine genaue und
prägnante Wegbeschreibung, was nicht einfach ist und trotz aller Sorgfalt zu
Fehldeutungen führen kann. Vom Benutzer des Führers wird entweder ein sehr gutes
Gedächtnis erwartet oder, dass er häufig mit dem Führer in der Hand wandert, was
auf Dauer niemand durchhält. Man muss also darauf gefasst sein, sich immer mal
wieder zu verlaufen. Das ist allerdings nicht schlimm. Schließlich kann sich ja
jeder seine eigene Strecke
basteln. Wichtig ist nur, dass man auch die richtigen Wanderkarten dabei hat.
Dieses Jahr waren wir nur vier: Mechthild, Roland, Erwin und ich. Die
Anreise erfolgte am Freitag mit der Bahn nach Bad Breisig, wo wir übernachteten.
In Brohl hatten wir nichts Geeignetes bekommen.
Samstag, 22. Mai 2010
Die Bahn bringt uns in wenigen Minuten
nach Brohl. Das Wetter ist sonnig und warm. Heutiges Tagesziel ist Mendig. Mit
dem R des Rheinhöhenwegs steil hinauf auf die Hochfläche und dann durch Wald und
später durch Felder. Einem kleinen Bach folgend trotten wir hinunter zu der
Abfüllanlage des Tönissteiner Sprudels. Die steilen Hänge des Tälchens sind über
und über bewachsen mit Bärlauch. Der durchdringende „Duft“ begleitet uns eine
ganze Weile. Ich wundere mich, dass hier niemand den Bärlauch erntet, wo doch
zur Zeit jedes Restaurant in seiner Speisekarte ein Extrablatt mit
Bärlauchspezialitäten aufweist.
 Vom
Tönissteiner Sprudel geht es aufwärts zu einem Aussichtspunkt, der mittlerweile
total zugewachsen ist und anschließend einen schmalen Pfad hinunter ins Brohltal
zum Gasthof „Jägerheim“, hinter dem die Trasshöhlen liegen. Hier wurde früher
Lavaasche abgebaut, die einem hervorragenden Zement abgab. Wir folgen der Straße
die wenigen hundert Meter nach Bad Tönisstein. Die Fachklinik, an der wir
abzweigen sollen, wird gerade in eine Seniorenresidenz umgewandelt. An den
überwucherten Ruinen des Klosters Tönisstein vorbei weiter zur Wolfsschlucht
(der Name ist offensichtlich sehr beliebt), die uns recht zahm vorkommt.
Anschließend durch Wald und Felder nach Wassenach, wo wir kurz
herumirren. Vom
Tönissteiner Sprudel geht es aufwärts zu einem Aussichtspunkt, der mittlerweile
total zugewachsen ist und anschließend einen schmalen Pfad hinunter ins Brohltal
zum Gasthof „Jägerheim“, hinter dem die Trasshöhlen liegen. Hier wurde früher
Lavaasche abgebaut, die einem hervorragenden Zement abgab. Wir folgen der Straße
die wenigen hundert Meter nach Bad Tönisstein. Die Fachklinik, an der wir
abzweigen sollen, wird gerade in eine Seniorenresidenz umgewandelt. An den
überwucherten Ruinen des Klosters Tönisstein vorbei weiter zur Wolfsschlucht
(der Name ist offensichtlich sehr beliebt), die uns recht zahm vorkommt.
Anschließend durch Wald und Felder nach Wassenach, wo wir kurz
herumirren.
Wenig später ist der Laacher See erreicht. Der Trubel hier ist wie ein
Schlag aufs Auge: Spaziergänger, Jogger, Radfahrer, Ausflügler und am nicht
zugänglichen Ufer Wohnwagen- und Wohnmobilplätze und Camping. Am Kloster ist der
Trubel der Touristen noch schlimmer. Wir suchen uns unseren Weg nach Mendig, wo
wir Quartier gebucht haben.
  Sonntag,
23. Mai 2010 Sonntag,
23. Mai 2010
Das Wetter ist wie gestern: sonnig und heiß. Heutiges Tagesziel ist Mayen,
eine Strecke von 26 km. Wir gehen nicht nach Maria Laach zurück, sondern nehmen
die gesperrte L 120 nach Bell. Erwin ist wieder ganz entzückt von den
großflächigen, leuchtenden Rapsfeldern überall. Von Bell geht es bald steil
hinauf auf den „Gänsehals“, zunächst weiterhin in der prallen Sonne.
Anschließend durch Wald hinunter zu den „Roderhöfen“, über die L 82 und dann
hinauf auf den Hochstein zur „Genovevahöhle“. Serpentinen bringen uns danach
hinunter nach Ettringen, wo wir auftanken. Als nächstes steigen wir hinauf auf
den Hochsimmer, bevor uns schmale,
teilweise zugewachsene oder von gefallenen Bäumen blockierte Pfade hinunter nach
St. Johann und weiter ins Nettetal bringen. Ein Hangweg oberhalb des Tales führt
uns dann nach Mayen, wo wir in der Jugendherberge unterkommen.
 Montag,
24. Mai 2010 Montag,
24. Mai 2010
Das sonnige und heiße Wetter bleibt uns treu. Nach Monreal, dem heutigen
Tagesziel, sollen es 20 km sein. Zunächst müssen wir zurück zur „Hammesmühle“,
der Stelle, wo wir gestern ins Nettetal kamen. Wir gönnen uns den Abstecher zum
„Schloss Bürresheim“ und folgen der Straße etwa 500 m weiter. Und wieder müssen
wir zurück, denn unser Weg zweigt an der „Hammesmühle“ ab und folgt jetzt dem
Nitzbach durch Wald und über Weiden nach Nitztal. Von dort steigen wir hinauf
zur „Bleiberg-hütte“ und laufen weiter nach Kürrenberg. Dort irren wir etwas
herum, bevor wir „frei Schnauze“ hinuntersteigen ins
Tal des Trillbaches und ihm bis zu dem hübschen, kleinen Fachwerkstädtchen
Monreal folgen.
 Dienstag,
25. Mai 2010 Dienstag,
25. Mai 2010
Auch heute ist es wieder sonnig und heiß.
Heute geht es nach Ulmen, runde 27 km. Wir folgen dem Thürelzbach über
Urmersbach nach Kaisersesch. Dort folgen wir der Markierung am Friedhof vorbei
hinauf auf die Hochebene und laufen zur „Franzosenwiese“ und
weiter zum Ortsrand von Breitenbruch, wo uns ein Wiesenweg und bald ein
Waldpfad teilweise steil hinunterbringt zum Kloster „Maria Martental“. Jetzt ist
es nur noch ein kurzes Stück bis hinunter ins Enderttal, dem wir nun folgen. Um
16.30h trotten wir steil abwärts nach Ulmen, wo wir wenige Meter vom Maar in
einem Gästehaus unterkommen.
  Mittwoch,
26. Mai 2010 Mittwoch,
26. Mai 2010
Heute Nacht hat es heftig geregnet. Da wir in der Ferienwohnung kein
Frühstück bekommen, nehmen wir das in einer Bäckerei im Industriegebiet ein, die
ohnehin am Weg liegt. Bis wir fertig sind, nieselt es aus dem bedeckten Himmel,
also laufen wir im Regenzeug. Heutiges Ziel ist Daun, eine Strecke von
20 km. Über Schönbach laufen wir in Richtung Mehren. Zwischendurch gibt
es immer wieder teils heftige Schauer. Leider laufen wir zunächst viel auf Teer.
Nach einem längeren Waldstück unterqueren wir die A 1 und laufen schließlich
abwärts nach Mehren, wo wir uns in einem Cafe aufwärmen. Auf
der Weinfelder Straße aus dem Ort. Bald steil hinauf zum Flugfeld Daun-Senheld
und weiter zum nahen Weinfelder Maar. Am westlichen Ufer entlang und schließlich
abwärts zum Gemündener Maar und weiter hinunter nach Gemünden. Entlang der L 46
nach Daun und hinauf zur Tourist Info, die uns im nahen „Hotel Daun“
einquartiert.
  Donnerstag,
27. Mai 2010 Donnerstag,
27. Mai 2010
Heute geht es nach Gerolstein, gute 25 km entfernt. Das Wetter ist anfangs
bedeckt, wird aber besser. Der Weg macht immer neue Schwenks und Bögen, führt
kleinere Buckel hinauf und wieder hinunter, bis die Neunkirchener Mühle erreicht
ist. Bald darauf ersteigen wir den Birkenberg und folgen dem Kamm zum Nerother
Kopf. Ein kurzer, knackiger Aufstieg bringt uns hinauf. Nach dem Gedenken an den
berühmten „Nerother Wandervogel“ hinunter nach Neroth, wo wir im Cafe
„Mausefalle“ einkehren. Neroth liegt nicht an der Markierung. Wir versuchen,
entlang des Enzenbachs wieder auf sie zu treffen, landen aber auf dem neuen
„Eifelsteig“, der heute
häufig parallel läuft. Da er ebenfalls nach Gerolstein führt, bleiben wir auf
ihm. Durch Wald und immer wieder über Buckel und endlich auf den Aussichtspunkt
„Dietzenley“. Danach auf verschlungenen Wegen abwärts und über das „Grafenkreuz“
nach Gerolstein zur Tourist Info. Die besorgt uns mit Mühe Zimmer.
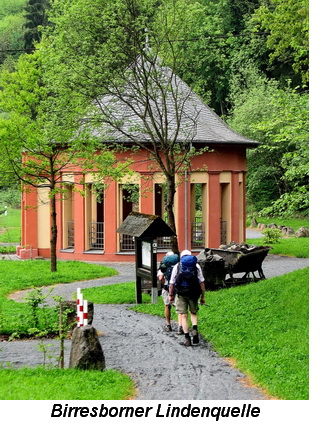 Freitag,
28. Mai 2010 Freitag,
28. Mai 2010
Heutiges Ziel ist Prüm, über 30km weit weg. Das Wetter ist gut, aber
Mechthild muss einen Schontag einlegen. Die Blasen an ihrer Ferse sind offen und
schmerzen enorm. Sie wird vorausfahren und Quartier machen. Wir starten von der
Höhe, von der wir gestern nach Gerolstein hinuntergelaufen sind. Das Wetter ist
gut. Anfangs suchen wir etwas herum. Der Führer ist hier missverständlich. Dann
klappt es. Durch schönen Wald geht es hinunter zur Kyll, auf einem Steg hinüber
und entlang der L 24 zum rosa Tempelchen der „Lindenquelle“. Es folgt ein
unangenehmer Pfad durch Gras und Gestrüpp, der
zu guter Letzt durch Sturmholz verbarrikadiert ist. Wir versuchen die Fläche zu
umgehen bzw. uns durchzuzwängen. Das gelingt nur teilweise und ist sehr mühsam,
anstrengend und zeitraubend. Schließlich geben wir entnervt auf und kämpfen uns
den steilen Hang hinunter zur L 24 und folgen dem Radweg zum Waldweg nach
Birresborn, das schnell erreicht ist. In, durch und aus dem Ort aufwärts
Richtung „Birresborner Eishöhlen“. Wir folgen der Markierung zu lange und landen
stattdessen bei den Bäumen „Adam und Eva“. Irgendwann merken wir, dass wir nicht
da sind, wo wir sein sollten. Nach kurzer Beratung und dem Studium der Karte und
des GPS laufen wir so lange quer durchs Gelände, bis der richtige Weg wieder
erreicht ist. Über Ober- und Nieder-Hersdorf und einem Teil der „Schönecker
Schweiz“ kommen wir nach Rommersheim. Steil hinauf zur B 51, über die Straße,
einen Stacheldrahtzaun und eine Weide und schon laufen wir hinunter nach Prüm,
wo uns Mechthild schon erwartet.
 Samstag,
29. Mai 2010. Samstag,
29. Mai 2010.
Heute geht es nach Waxweiler, knappe 25 km entfernt. Das Wetter ist
herrlich, sonnig und warm. Mechthild kann noch nicht mitwandern und wird wieder
voraus fahren. Zunächst zurück auf die Höhe, von der wir gestern kamen. Entlang
Wiesen und durch Wald, und schon sind wir wieder einmal am Wegsuchen.
Schließlich nehmen wir die Straße von Nieder-Prüm nach Ellwerath. Ab dort klappt
es dann. Leider geht es ein längeres Stück auf Teer bis Dingdorf erreicht ist.
Die Hitze macht uns zu schaffen. Aufwärts auf den Haseldell, eine Höhe mit 5
Windrädern. Oben wird es problematisch. Der Führer ist nicht eindeutig.
Unglücklicherweise suchen
wir uns die falsche Richtfunkantenne als Wegweiser aus und laufen einen großen
Umweg, bis wir endlich wieder auf der richtigen Strecke sind. Vorbei am
Feriendorf „Hasert“, einen Höhenrücken entlang, durch Wald und hinunter nach
Lascheid. Der Rest ist Teer, zunächst die L 10, dann einen geteerten Weg, der
uns zur L 12 und dann abwärts in den Ort bringt, wo Mechthild uns eine
Ferienwohnung besorgt hat.
 Sonntag,
30. Mai 2010 Sonntag,
30. Mai 2010
Heutiges Ziel ist Neuerburg, angeblich gerade mal 20 km weit weg. Mit
Umwegen sind es dann 21. Heute Nacht hat es heftig gegossen. Auch jetzt schauert
es immer wieder. Es ist bedeckt und man hat wenig Sicht. Mechthild kann auch
heute noch nicht laufen. Im Poncho aus dem Ort, über die Kyll und dann die K 123
aufwärts. Ein nasser Waldweg bringt uns nach Oberpierscheid, wo wir erneut einen
Markierungswechsel verpassen. Anstatt in Röllersdorf landen wir in
Phillipsweiler. Da wir keinen Weg durch das zwischen den Orten liegende Tal
finden, laufen wir die L 9 und dann die
L 8 weiter, bis wir auf unsere Markierung überwechseln können. Ein langer,
leicht fallender Weg führt uns zum Segelfluggelände Utscheid. Von dort geht es
steil abwärts nach Fischbach – Oberraden. Auf der K 62 aus dem Ort und
schließlich ein Seitental steil aufwärts auf die Höhe. Anschließend heißt es
steil hinunter nach Neuerburg. Kurz vor dem Ortsanfang liegt die Kreuzkapelle,
der wir einen Blick gönnen. Unten erwartet uns Mechthild und führt uns zum
Quartier.
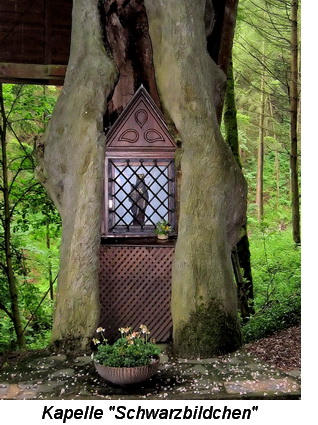  Montag,
31. Mai 2010 Montag,
31. Mai 2010
Der Führer geht
heute bis Vianden. Wir gehen noch 2 – 3 Kilometer weiter bis Roth an der Our,
insgesamt etwa 23 km. Mechthild kann noch nicht mitwandern und wird von der
neuen Wirtin sogar abgeholt. Das Wetter ist heute trübe und kalt. Straße
aufwärts, vorbei an der Burg, dann den Waldweg zur Kapelle „Schwarzbildchen“, wo
in einer hohlen Buche ein Marienbild eingelassen ist. Weiter aufwärts. Kurz
hinter Kreutzdorf beginnt ein mehrfaches Ab und Auf, nass hinunter in Tälchen
und wieder hinauf zu den Orten. So kommen wir über Koxhausen und Berscheid steil
hinunter nach Gaymühle. Der dortige Aufstieg auf den Beidenberg und Borndell zur
L 1 wärmt uns etwas auf. Der kalte Wind ist unangenehm. Auf der
K 47 eben weiter nach Waldhof – Falkenstein, dann
steil abwärts und über die Ruine der Burg
Falkenstein hinunter zur Our. Über den Bivelser Steg hinüber nach Luxemburg
und weiter nach Bivels. Ab hier bis Vianden ist alles Teer: Straße oder Gehweg.
Am Ortseingang von Vianden erwartet uns Mechthild. Nach kurzem Aufwärmen im Cafe
du Pont weiter nach Roth, leider auch Teer.
  Dienstag,
01. Juni 2010 Dienstag,
01. Juni 2010
Heute geht es nach Bollendorf, bzw. ein Stück dahinter, eine Strecke von
rund 20 km. Das Wetter ist trübe, aber trocken. Auch heute haben wir größere
Stücke auf der Straße zu laufen, aber Mechthild ist wieder dabei. Im Prinzip
folgen wir nur der Our und - nach deren Einmündung – der Sauer. Über Gentingen
und Ameldingen nach Wallendorf. Dann entlang der Sauer weiter. Hinter
Dillingerbrück stoßen wir auf das „Schmitten-kreuz“, Reste eines römischen
Grabmals. 20 Minuten später durchqueren wir einen großen Campingplatz kurz vor
Bollendorf, das bald darauf erreicht
ist. Nach einer Pause in einem
Cafe auf dem Uferweg weiter zum Laufenwehr bei Weilerbach, weil dort das „Hotel
am Wehr“ ist, wo wir Quartier haben. Roland, der hier aufgewachsen ist, erzählt
uns Geschichten über seine Jugend hier und die Zustände nach dem Krieg. Er freut
sich sichtlich, alles wiederzusehen.
 Mittwoch,
02. Juni 2010 Mittwoch,
02. Juni 2010
Die nächsten beiden Tage sollen Höhepunkte der Wanderung sein. Der Führer
empfiehlt eine Wanderung auf dem Ferschweiler Felsenweg und zwar entlang des
Ostrandes des Plateaus nach Echternach. Roland und Erwin meinen, der Felsenweg
entlang des Westrandes wäre interessanter, also laufen wir den. Da wir unser
Quartier für zwei Nächte gebucht haben, können wir ohne Gepäck laufen, was das
Ganze angenehmer macht. Erwin leert allerdings seinen Rucksack, damit wir Sachen
für unterwegs mitnehmen können. Erfreulicherweise ist das Wetter sonnig und
warm. Gegen 9.00 Uhr auf dem Uferweg bis zum Steg hinüber nach Weilerbach.
Roland schwelgt wieder in Erinnerungen. Dann hinauf zur L 1,
überqueren sie und folgen einem Sträßchen hinauf zum Schloss Weilerbach. Wir
werfen einen Blick in den schmucklosen, etwas lieblos wirkenden Schlossgarten
und steigen weiter aufwärts Richtung Ferschweiler. Ich übernehme von Erwin den
Rucksack, weil ich damit leichter aufwärts laufen kann. Bald verlassen wir die K
19 und laufen auf Wegen mehr oder weniger parallel zu ihr. Wegen, die allerdings
recht häufig matschig sind und gelegentlich einen Hindernisparcours darstellen.
Schließlich werden wir auf die Straße zurückgeleitet und folgen ihr das letzte
Stück hinauf nach Ferschweiler. Eine Jugendfreundin Rolands betreibt hier eine
Gastwirtschaft. Natürlich wollen wir einkehren, sie sehen und das Wiedersehen
miterleben. Um 10.17 Uhr sind wir dort. Die Wirtschaft heißt passenderweise „Zum
Felsenpfad“. Die Wirtin erkennt Roland nicht sofort, ist dann aber sehr
herzlich.
Um 11.00 Uhr brechen wir auf. Das Ferschweiler Plateau fällt an seinen Rändern
mit senkrechten Sandsteinwänden ab, die unterschiedlich hoch sein können. Am Fuß
der Felsen, die dann in einen steilen Berghang übergehen, schlängelt sich ein
Pfad entlang, der den Konturen des Hanges folgt und häufig leicht steigt oder
fällt, der „Felsenpfad“ eben. Erfreulicherweise sind wir die ganze Zeit im Wald
und damit im Schatten. Erwin und Mechthild fallen immer wieder weit zurück, weil
sie von den verschiedenen Felsformationen so entzückt sind, dass sie nur schwer
aufhören können, zu fotografieren. An einer Reihe von Stellen stehen
Informationstafeln, die auf
verschiedene Dinge hinweisen, bzw. manches erklären. Manche Sandsteinformationen
wecken Erinnerungen an die „Sächsische Schweiz“. Über Schlösserlay, Jegerkreuz,
die „Schweineställe“, den Türkenkopf und die Vogtsgrotte erreichen wir um kurz
vor 13.00 Uhr Falkenlay, wo ich von Erwin wieder den Rucksack übernehme.
 Trotz
der interessanten Formationen wirkt der Pfad langsam ermüdend und beginnt sich
zu ziehen. Wir umrunden einen Ausläufer des Hanges und landen im Tal des
Gutenbaches. Der Pfad führt nun abwärts, hinunter auf einen Schotterweg, dem wir
talaufwärts folgen. Um 13.37 Uhr sind wir an der Grillhütte (am Felsenweiher),
unterhalb des Sportplatzes von Ernzen und machen Mittagspause. Um 14.00 Uhr
machen wir uns wieder auf den Weg. Ziel ist zunächst die Liboriuskapelle am
Aussichtspunkt über Echternacherbrück. Etwas zurück, dann sind wir bald wieder
auf dem Felsenpfad, der jetzt am anderen Hang des Gutenbachtals zurückläuft.
Vorbei am Stubenlay umrunden wir auch diesen Hangausläufer und
gelangen
so ins Tal des Fölkenbachs und folgen ihm aufwärts. Schließlich wird es steil.
Wir bleiben auf dem Felsenpfad und erreichen – endlich – um 15.15 Uhr die
Aussichtskanzel. Roland erklärt uns die markanten Orte von Echternach. Wir
genießen die Aussicht und setzen uns auch eine Weile auf die Bank an der
Kapelle. Trotz
der interessanten Formationen wirkt der Pfad langsam ermüdend und beginnt sich
zu ziehen. Wir umrunden einen Ausläufer des Hanges und landen im Tal des
Gutenbaches. Der Pfad führt nun abwärts, hinunter auf einen Schotterweg, dem wir
talaufwärts folgen. Um 13.37 Uhr sind wir an der Grillhütte (am Felsenweiher),
unterhalb des Sportplatzes von Ernzen und machen Mittagspause. Um 14.00 Uhr
machen wir uns wieder auf den Weg. Ziel ist zunächst die Liboriuskapelle am
Aussichtspunkt über Echternacherbrück. Etwas zurück, dann sind wir bald wieder
auf dem Felsenpfad, der jetzt am anderen Hang des Gutenbachtals zurückläuft.
Vorbei am Stubenlay umrunden wir auch diesen Hangausläufer und
gelangen
so ins Tal des Fölkenbachs und folgen ihm aufwärts. Schließlich wird es steil.
Wir bleiben auf dem Felsenpfad und erreichen – endlich – um 15.15 Uhr die
Aussichtskanzel. Roland erklärt uns die markanten Orte von Echternach. Wir
genießen die Aussicht und setzen uns auch eine Weile auf die Bank an der
Kapelle.
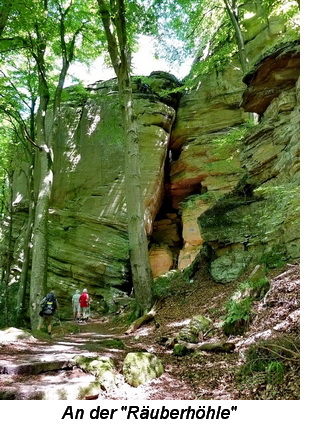 Anschließend
steil hinunter nach Echternacherbrück. Dort besorgen wir uns zunächst ein
Quartier für morgen, bevor wir über die Brücke nach Echternach hinübertrotten.
Am eher ungemütlichen „ Cafe de la Culture“ vor der Basilika trinken wir eine
Kleinigkeit und schlendern danach durch die Altstadt zum Ufer der Sauer an der
wir zurück zum Hotel laufen. Wir brauchen doch tatsächlich über eine Stunde, bis
das Quartier um 18.00 Uhr erreicht ist. Duschen, umziehen, Abendessen. Morgen
wollen wir durch die Felsenlandschaft im luxemburgischen Müllerthal. Habe mich
gefragt, warum wir nicht - wie heute - ohne Gepäck laufen. Können die Rucksäcke
ja morgen Früh ins neue
Quartier bringen. Bin überrascht, dass keiner auf die Idee gekommen ist, aber
man greift meinen Vorschlag gerne auf. Erwin ruft sofort dort an und macht alles
klar. Unterhalten uns und setzen uns noch ein bisschen auf die Terrasse vor den
Zimmern, dann ins Bett. Anschließend
steil hinunter nach Echternacherbrück. Dort besorgen wir uns zunächst ein
Quartier für morgen, bevor wir über die Brücke nach Echternach hinübertrotten.
Am eher ungemütlichen „ Cafe de la Culture“ vor der Basilika trinken wir eine
Kleinigkeit und schlendern danach durch die Altstadt zum Ufer der Sauer an der
wir zurück zum Hotel laufen. Wir brauchen doch tatsächlich über eine Stunde, bis
das Quartier um 18.00 Uhr erreicht ist. Duschen, umziehen, Abendessen. Morgen
wollen wir durch die Felsenlandschaft im luxemburgischen Müllerthal. Habe mich
gefragt, warum wir nicht - wie heute - ohne Gepäck laufen. Können die Rucksäcke
ja morgen Früh ins neue
Quartier bringen. Bin überrascht, dass keiner auf die Idee gekommen ist, aber
man greift meinen Vorschlag gerne auf. Erwin ruft sofort dort an und macht alles
klar. Unterhalten uns und setzen uns noch ein bisschen auf die Terrasse vor den
Zimmern, dann ins Bett.
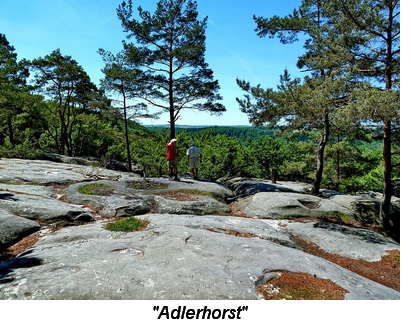 Donnerstag,
03. Juni 2010 Donnerstag,
03. Juni 2010
Heute steht also Müllerthal auf dem Programm. Roland hat mit dem Wirt
gesprochen, den er noch von früher kennt. Er ist bereit, uns nach
Echternacherbrück zu fahren. So sind wir nicht auf den Bus angewiesen. Natürlich
zahlen wir ihm etwas. Kurz nach 9.00 Uhr haben wir unser Gepäck im neuen
Quartier verstaut und laufen los. Nach Echternach hinüber und an der Sauer
entlang. Das Wetter ist auch heute sonnig und warm. Unsere Experten finden aber
den Einstieg in den „Müllerthal Trail“ nicht, Markierung ist auch keine zu
sehen, so dass wir auf dem Uferweg bleiben, bis wir auf
die Straße nach Berdorf stoßen. Der folgen wir aufwärts, bis wir schließlich auf
den Pfad mit dem „grünen Dreieck“ stoßen, dem wir eigentlich folgen wollen, was
wir jetzt auch tun. Bald sind wir in einer Art Schlucht mit beeindruckenden
Felsformationen. Erstes Teilziel ist Berdorf. Bin etwas voraus. Als der Rest aus
Gründen, die ich akustisch nicht verstehe, zur begleitenden Straße hinaufsteigt,
bleibe ich unten im Tälchen und folge dem Bach weiter. Immerhin wollen wir ja
nach Berdorf. Spätestens dort werden wir uns wieder treffen. Weitere
Felsformationen folgen, dann geht es in Stufen hinauf zur Houllay Höhle, in der
schon die Römer Mühlsteine gebrochen haben. Setze mich ein Stück oberhalb auf
eine Bank und warte eine Weile, aber meine Kollegen kommen nicht. Also weiter.
Bald bin ich aus dem Wald draußen und laufe auf direktem Weg ins nahe Berdorf.
Setze mich an einer Telefonzelle auf eine Bank und warte erneut. Schließlich
kommen sie. Gegen 11.30 Uhr legen wir im Scharff-Hotel gegenüber eine Pause ein.
Das Etikett der Mineralwasserflasche („gutt spruddeleg“) amüsiert uns.
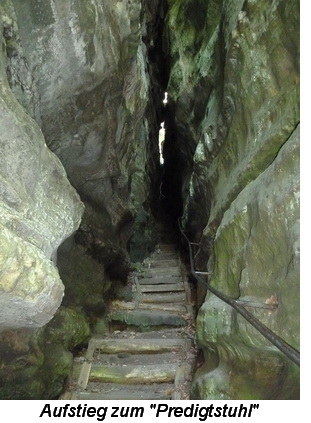 Um
12.00 Uhr weiter. Zunächst auf der Straße aus dem Ort, bevor wir erneut in eine
Schlucht mit interessanten Felsformationen einsteigen und dem Bach folgen. Alles
ist gut ausgeschildert. Bezeichnungen wie „Adlerhorst“ oder „Räuberhöhle“ wecken
unsere Neugier. Da müssen wir hin. Es ist nicht weit. Teste die Räuberhöhle. Sie
ist teilweise eng, aber man kommt durch. Innen ist wenig Platz. Eine Eisenleiter
führt nach oben zu einem zweiten Ausgang. Dort führt ein Pfad weiter zu Stufen
hinauf auf einen flachen Felsen mit
weitreichender Aussicht, dem Adlerhorst. Schließlich hinunter zum Pfad. Folgen
ihm ein Stück, merken aber bald, dass wir hier auf Abwegen sein müssen. Der
Führer bestätigt das. Räuberhöhle und Adlerhorst waren nur ein „freiwilliger
Abstecher“. Also zurück zur Kreuzung und auf dem Müllerthal Trail weiter. Um
12.00 Uhr weiter. Zunächst auf der Straße aus dem Ort, bevor wir erneut in eine
Schlucht mit interessanten Felsformationen einsteigen und dem Bach folgen. Alles
ist gut ausgeschildert. Bezeichnungen wie „Adlerhorst“ oder „Räuberhöhle“ wecken
unsere Neugier. Da müssen wir hin. Es ist nicht weit. Teste die Räuberhöhle. Sie
ist teilweise eng, aber man kommt durch. Innen ist wenig Platz. Eine Eisenleiter
führt nach oben zu einem zweiten Ausgang. Dort führt ein Pfad weiter zu Stufen
hinauf auf einen flachen Felsen mit
weitreichender Aussicht, dem Adlerhorst. Schließlich hinunter zum Pfad. Folgen
ihm ein Stück, merken aber bald, dass wir hier auf Abwegen sein müssen. Der
Führer bestätigt das. Räuberhöhle und Adlerhorst waren nur ein „freiwilliger
Abstecher“. Also zurück zur Kreuzung und auf dem Müllerthal Trail weiter.
Nach kurzer Zeit stoßen wir auf eine weitere Höhle (eigentlich nur ein schmaler
Spalt im Fels), die sinnigerweise „Hölle“ getauft ist. Natürlich interessiert
mich das. Mit einer Taschenlampe bewaffnet dringe ich ein. Der Spalt führt
abwärts und wird niedriger. Außerdem wird es recht kühl. Als man nur noch auf
Händen und Knien weiterkommt, habe ich genug und kehre um. Und weiter geht es.
Wir durchlaufen das Felslabyrinth der Binzelt-Schloeff und sind kurz darauf am
Parkplatz und der Straße am „Predigtstuhl“. Der Fels wird von hinten bestiegen.
Eine Treppe und ein schmaler Riss in der Felswand führen zur Rückseite.
Wir haben
schon eine Menge Leute getroffen, aber hier wimmelt es geradezu. Wir sparen uns
die Besteigung und laufen auf dem Felsenpfad weiter.
Schließlich haben wir die Felsen hinter
uns gelassen und folgen einem Waldweg zur Ortschaft Müllerthal. Eine Pause ist
angebracht. Auf der Terrasse von „Le Cigalon“ finden wir einen schönen Platz.
Etwa eine halbe Stunde später brechen wir auf. Es ist bereits nach 15.30 Uhr und
der Rückweg ist noch weit. So beschließen wir, auf der Straße nach Consdorf und
weiter nach Scheidgen zu laufen. Eine Stunde nach dem Aufbruch von Müllerthal
sind wir dort und pausieren am „Hotel de la Station“ erneut.
Nach rund 30
Minuten weiter. Sehr schnell ist die M – Markierung des Müllerthal Trails
gefunden. Jetzt sind wir endlich wieder auf einem schönen, kühlen Waldweg ohne
Teer. Später stoßen wir auf den Radweg und folgen ihm zur Straße nach
Echternach, auf der viel Verkehr vorbeirauscht. So sind wir froh, als uns die
Markierung „gelber Punkt“ von der Straße wegführt, aber trotzdem direkt ins
Zentrum bringt. Um 19.00 Uhr sind wir endlich im Quartier. Duschen umziehen. In
der nahen Pizzeria stillen wir unseren Flüssigkeitsbedarf und essen Pizza. Im
Quartier schreiben Erwin und ich noch unsere Notizen und gehen
dann schlafen.
 Freitag,
04. Juni 2010 Freitag,
04. Juni 2010
Heute ist also der große Tag: unser letzter Wandertag, laut Führer 27km bis
Trier. Erwins Schrittzähler nennt uns am Ende 30,5km. Wie auch immer: ein
langer, heißer Tag liegt vor uns. Um 8.20 Uhr brechen wir auf. Es wird lange
Zeit parallel zur Sauer gehen, hoffentlich nicht zu viel auf Teer. Ein schmaler
Grasweg, angenehm und gut zu laufen, bringt uns an den Ortsanfang von Minden,
über die Prüm und bergauf. Bald irren wir etwas herum, da die Markierungen
irreführend sind oder fehlen. Zwängen uns durch Gestrüpp und folgen der Nase,
bis wir wieder auf die B 418 stoßen. Überqueren sie und die
Leitplanke und steigen hinunter zum begleitenden Radweg, an den wir uns jetzt
halten. Tatsächlich tauchen auch unsere Markierungen wieder auf. So erreichen
wir Ralingen.
Es ist heiß geworden. Die Sauer macht
hier eine große Schleife. Irgendwann wird es uns zu dumm und wir kürzen quer
durch ab. Auf dem Radweg weiter bis Wintersdorf, wo wir bei „Hildas
Bauernstübchen“ einfallen. Ein Tankstopp ist dringend geboten. Eine Stunde
später geht es weiter. Bald verlassen wir die Sauer und steigen durch Wald
hinauf nach Udelfangen.
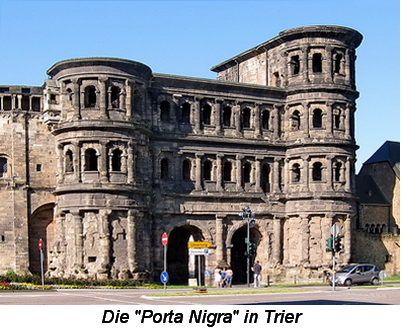 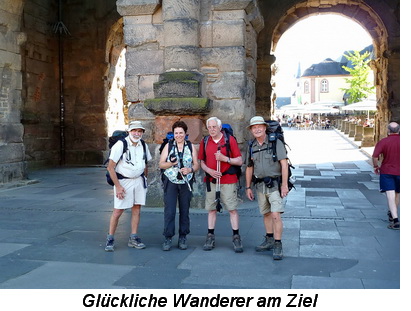 Ab
hier heißt es Straße in der prallen Sonne bis Trierweiler. Während der Pause
telefoniert Erwin und bucht unser Quartier in Trier. Dann steil aufwärts zur
Autobahn A 64, die wir unterqueren. Ein reparaturbedürftiger, geteerter Feldweg
bringt uns direkt zum Wald, wo die Markierung uns fast ganz auf den Mohrenkopf
leitet und anschließend abwärts zum Gasthaus „Mohrenkopf“. Im großen, schattigen
Biergarten haben wir einen hervorragenden Blick auf das ausgebreitete Trier
unter uns. Die Straße führt uns durch Markusberg zur Mariensäule, dann hinunter
zur Kaiser-Wilhelm-Brücke. Kurz vor 18.00 Uhr sind wir – müde, aber glücklich – an der
Porta Nigra. Ziel erreicht, Wanderung erfolgreich abgeschlossen. Ab
hier heißt es Straße in der prallen Sonne bis Trierweiler. Während der Pause
telefoniert Erwin und bucht unser Quartier in Trier. Dann steil aufwärts zur
Autobahn A 64, die wir unterqueren. Ein reparaturbedürftiger, geteerter Feldweg
bringt uns direkt zum Wald, wo die Markierung uns fast ganz auf den Mohrenkopf
leitet und anschließend abwärts zum Gasthaus „Mohrenkopf“. Im großen, schattigen
Biergarten haben wir einen hervorragenden Blick auf das ausgebreitete Trier
unter uns. Die Straße führt uns durch Markusberg zur Mariensäule, dann hinunter
zur Kaiser-Wilhelm-Brücke. Kurz vor 18.00 Uhr sind wir – müde, aber glücklich – an der
Porta Nigra. Ziel erreicht, Wanderung erfolgreich abgeschlossen.
Fotos: Walter Brückner
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
36 - Dezember 2011
Fern, so fern, der Fichtelberg
Bei einer Wanderung auf dem
Kammweg eintauchen in die Geschichte des Erzgebirges
- und der Schnaps schmeckt nach
weißen Gummibärchen.
Von Franz Lerchenmüller
 Wandern
ist nichts für verträumte Seelen. Da stapft man versonnen vom Pöhlagrund bergan,
diesem im Sommer weltvergessenen Gasthof, freut sich am Gekeife eines
Eichelhähers und dem Duft des Wermuts, sinniert und phantasiert, tritt aus der
Sonne in den kühlen Wald - und plötzlich ist der Balken weg: Jener
weiß-blau-weiße Balken, der dem Wanderer in unregelmäßigem Abstand auf einem
Baum, an einem Zaun oder einem Felsen anzeigt, dass er sich noch auf dem rechten
Pfad befindet, dem Kammweg. Wandern
ist nichts für verträumte Seelen. Da stapft man versonnen vom Pöhlagrund bergan,
diesem im Sommer weltvergessenen Gasthof, freut sich am Gekeife eines
Eichelhähers und dem Duft des Wermuts, sinniert und phantasiert, tritt aus der
Sonne in den kühlen Wald - und plötzlich ist der Balken weg: Jener
weiß-blau-weiße Balken, der dem Wanderer in unregelmäßigem Abstand auf einem
Baum, an einem Zaun oder einem Felsen anzeigt, dass er sich noch auf dem rechten
Pfad befindet, dem Kammweg.
Kein einziger Hinweis mehr - nur purer,
weithin unmarkierter Forst. Da hilft nichts: Es geht zurück. Zweihundert Meter,
dreihundert, irgendwo muss doch... - und tatsächlich: Nach einigem Suchen blitzt
es tröstlich weiß-blau-weiß von einer Buche - tief in Gedanken ist der Wanderer
blind vorbeimarschiert.
 Jetzt
aber geht mit offenen Augen weiter, direkt hoch zum Bärenstein. Ein kompaktes
Hotel krönt ihn, ein mächtiger Kasten von 1913 mit einem stabil gemauerten
viereckigen Turm, der alle Stürme seitdem überstanden hat. Von ganz oben
schweift der Blick in die vier Himmelsrichtungen: Im Norden liegt der Pöhlberg
und das acht Kilometer entfernte Annaberg-Buchholz, im Osten
Jöhstadt und der Kühberg, gen Westen
blickt man auf Crottendorf und die Talsperre Cranzahl. Ein abwechslungsreiches
Äcker-Wald-und-Wiesen-Puzzle mit ein paar Schieferdächern dazwischen deckt die
Hügel, the rolling hills of Arzgebirg, wenn man so will. Jetzt
aber geht mit offenen Augen weiter, direkt hoch zum Bärenstein. Ein kompaktes
Hotel krönt ihn, ein mächtiger Kasten von 1913 mit einem stabil gemauerten
viereckigen Turm, der alle Stürme seitdem überstanden hat. Von ganz oben
schweift der Blick in die vier Himmelsrichtungen: Im Norden liegt der Pöhlberg
und das acht Kilometer entfernte Annaberg-Buchholz, im Osten
Jöhstadt und der Kühberg, gen Westen
blickt man auf Crottendorf und die Talsperre Cranzahl. Ein abwechslungsreiches
Äcker-Wald-und-Wiesen-Puzzle mit ein paar Schieferdächern dazwischen deckt die
Hügel, the rolling hills of Arzgebirg, wenn man so will.
 Nach
Süden aber, da erhebt sich in Tschechien der Keilberg, mit 1244 m der höchste
Gipfel des Erzgebirges, und gleich daneben der Fichtelberg mit einem winzigen
Bleistift als Spitze. Mit letzterem hat es eine besondere Bewandtnis: Er ist
nicht nur der höchste Berg Sachsens, sondern auch das Ziel dieser heutigen
Etappe des Kammwegs - und er liegt noch in weiter, weiter Ferne. Dabei ist der
geplante Abschnitt gerade mal 20 Kilometer lang, von insgesamt 289 Kilometern,
die sich der Kammweg vom östlichen Erzgebirge bis nach Thüringen erstreckt, der
erste zertifizierte, Regionen übergreifende Wanderweg in Sachsen. Nach
Süden aber, da erhebt sich in Tschechien der Keilberg, mit 1244 m der höchste
Gipfel des Erzgebirges, und gleich daneben der Fichtelberg mit einem winzigen
Bleistift als Spitze. Mit letzterem hat es eine besondere Bewandtnis: Er ist
nicht nur der höchste Berg Sachsens, sondern auch das Ziel dieser heutigen
Etappe des Kammwegs - und er liegt noch in weiter, weiter Ferne. Dabei ist der
geplante Abschnitt gerade mal 20 Kilometer lang, von insgesamt 289 Kilometern,
die sich der Kammweg vom östlichen Erzgebirge bis nach Thüringen erstreckt, der
erste zertifizierte, Regionen übergreifende Wanderweg in Sachsen.
 Die
Sonne hat die Morgennebel vertrieben, Bienen summen, an einer Bank warnt ein
Schild eventuelle Spitzbuben unter den Wanderern: Äpfel pflücken bei Strafe
verboten!. Plötzlich herrscht kein Mangel mehr an weiß-blau-weißen Balken - und
im Rhythmus der Schritte beginnen die Gedanken wieder zu vagabundieren. Zurück
zum Hirtstein wandern sie, mit seinem ungewöhnlichen Basaltfächer: Die Wand aus
strahlenförmig angeordneten Steinstreifen war entstanden, als ein Lavastrom noch
unter der Erde erstarrte. Und sie wurde erst entdeckt, als man auf der Suche
nach Kies und Steinen den Boden abtrug. Noch weiter zurück liegt der Spaziergang
durch das Spielzeugdorf Seiffen, in dessen Hauptstraße man
keinen Schritt unbeobachtet von grimmigen Nussknackern, holden Engeln und
rotbackigen Lichtermännchen tun kann. Schließlich der Abstecher ins Moor bei
Reitzenhain: Seggen wiegten sich im Wind, die Moos-beere streckte ihre langen
Tentakel aus und die Wälder aus Moorbirken standen denen Skandinaviens in nichts
nach. Die
Sonne hat die Morgennebel vertrieben, Bienen summen, an einer Bank warnt ein
Schild eventuelle Spitzbuben unter den Wanderern: Äpfel pflücken bei Strafe
verboten!. Plötzlich herrscht kein Mangel mehr an weiß-blau-weißen Balken - und
im Rhythmus der Schritte beginnen die Gedanken wieder zu vagabundieren. Zurück
zum Hirtstein wandern sie, mit seinem ungewöhnlichen Basaltfächer: Die Wand aus
strahlenförmig angeordneten Steinstreifen war entstanden, als ein Lavastrom noch
unter der Erde erstarrte. Und sie wurde erst entdeckt, als man auf der Suche
nach Kies und Steinen den Boden abtrug. Noch weiter zurück liegt der Spaziergang
durch das Spielzeugdorf Seiffen, in dessen Hauptstraße man
keinen Schritt unbeobachtet von grimmigen Nussknackern, holden Engeln und
rotbackigen Lichtermännchen tun kann. Schließlich der Abstecher ins Moor bei
Reitzenhain: Seggen wiegten sich im Wind, die Moos-beere streckte ihre langen
Tentakel aus und die Wälder aus Moorbirken standen denen Skandinaviens in nichts
nach.
 Im
Hier und Jetzt aber, Freitagmorgen 9.25 Uhr, führt der Kammweg über den Staudamm
der Talsperre Cranzahl. Sie wurde zwischen 1949 und 1954 erbaut, heißt Talsperre
der Freundschaft und die bronzene Friedens-taube der FDJ flattert noch immer auf
dem Gedenkstein. Mitten auf der Sperrmauer beginnt es aus fast heiterem Himmel
zu nieseln, und am anderen Ufer wartet eine weitere Überraschung: Bis
Kretscham-Rothensehma ist der Kammweg wegen Kalkung des Waldbodens gesperrt.
Diese erfolgt per Flugzeug, steht auf einem Zettel - was erklärt, warum schon
die ganze Zeit zwei schwarz-gelbe Flieger dicht über den Fichten-wipfeln ihre
Bahnen ziehen. Wanderer müs-sen auf den Erlebnispfad
Bimmelbahn aus-weichen. Der ist
bestens markiert und führt fast immer am Gleis der Fichtelbergbahn entlang.
Zweimal pfeift und heult die historische Dampflok auch von fern - und beim
Näherkommen bimmelt sie tatsächlich. Dann stampft und faucht der schwarz
glänzende Haufen Eisen vorbei und die Lokführer lehnen in den Fenstern, als
wären sie stolz bis an ihr Lebensende, sich diesen Kindertraum erfüllt zu haben. Im
Hier und Jetzt aber, Freitagmorgen 9.25 Uhr, führt der Kammweg über den Staudamm
der Talsperre Cranzahl. Sie wurde zwischen 1949 und 1954 erbaut, heißt Talsperre
der Freundschaft und die bronzene Friedens-taube der FDJ flattert noch immer auf
dem Gedenkstein. Mitten auf der Sperrmauer beginnt es aus fast heiterem Himmel
zu nieseln, und am anderen Ufer wartet eine weitere Überraschung: Bis
Kretscham-Rothensehma ist der Kammweg wegen Kalkung des Waldbodens gesperrt.
Diese erfolgt per Flugzeug, steht auf einem Zettel - was erklärt, warum schon
die ganze Zeit zwei schwarz-gelbe Flieger dicht über den Fichten-wipfeln ihre
Bahnen ziehen. Wanderer müs-sen auf den Erlebnispfad
Bimmelbahn aus-weichen. Der ist
bestens markiert und führt fast immer am Gleis der Fichtelbergbahn entlang.
Zweimal pfeift und heult die historische Dampflok auch von fern - und beim
Näherkommen bimmelt sie tatsächlich. Dann stampft und faucht der schwarz
glänzende Haufen Eisen vorbei und die Lokführer lehnen in den Fenstern, als
wären sie stolz bis an ihr Lebensende, sich diesen Kindertraum erfüllt zu haben.
 Von
einer Hauswand in Cranzahl mahnt ein alter Mann mit Pfeife: Vergaß dei Haamit
net! Wie könnte man? Die Bilder dieser Landschaft prägen sich auch dem Fremden
ein. Holunder und Schafgarbe säumen die Wege. In Lärchenwäldern bezaubert
diffuses grünes Licht. Und vor weißgelben Weizenfeldern leuchten knallrote
Vogelbeeren. Man kocht Marmelade daraus, brennt aber auch einen Schnaps, der
nach Gummibärchen schmeckt, aber nur nach den weißen, wie die junge Wirtin des
Poehla- Von
einer Hauswand in Cranzahl mahnt ein alter Mann mit Pfeife: Vergaß dei Haamit
net! Wie könnte man? Die Bilder dieser Landschaft prägen sich auch dem Fremden
ein. Holunder und Schafgarbe säumen die Wege. In Lärchenwäldern bezaubert
diffuses grünes Licht. Und vor weißgelben Weizenfeldern leuchten knallrote
Vogelbeeren. Man kocht Marmelade daraus, brennt aber auch einen Schnaps, der
nach Gummibärchen schmeckt, aber nur nach den weißen, wie die junge Wirtin des
Poehla-
grunds kennerisch angemerkt hatte.
Auch an der historischen Toilette auf dem
Bahnhof Neudorf prangt ein Hinweis – Sachsen schätzen scheinbar Schilder: "Drum
halt den Abtritt sauber - halt ihn rein. Du könntest selbst der nächste sein".
 Aus der Ferne grüßt der Fichtelberg herüber
- ein wenig hämisch vielleicht: Nicht einen Schritt scheint er näher gerückt
zu sein. Neudorf selbst zieht sich schmal und langgestreckt durch das Sehmatal,
eines der typischen langgestreckten Wald-hufendörfer. Nicht weniger typisch für
das Erzgebirge, hat der Wanderer gelernt, sind Streusiedlungen. Rübenau hatte
sich als perfektes Beispiel präsentiert. Wie gewürfelt schmiegten sich die
kleinen Häuser weit verstreut an Hügel und in Mulden - manche sind noch in
traditioneller Form erhalten: Ein Vorhäusl schützt den Eingang gegen Wind und
Schnee, die Fenster sind klein und die Dächer tief heruntergezogen, aber fast
ohne Überstand. An manchen hängt sogar noch der alte, außen
liegende Aborterker.
Aus der Ferne grüßt der Fichtelberg herüber
- ein wenig hämisch vielleicht: Nicht einen Schritt scheint er näher gerückt
zu sein. Neudorf selbst zieht sich schmal und langgestreckt durch das Sehmatal,
eines der typischen langgestreckten Wald-hufendörfer. Nicht weniger typisch für
das Erzgebirge, hat der Wanderer gelernt, sind Streusiedlungen. Rübenau hatte
sich als perfektes Beispiel präsentiert. Wie gewürfelt schmiegten sich die
kleinen Häuser weit verstreut an Hügel und in Mulden - manche sind noch in
traditioneller Form erhalten: Ein Vorhäusl schützt den Eingang gegen Wind und
Schnee, die Fenster sind klein und die Dächer tief heruntergezogen, aber fast
ohne Überstand. An manchen hängt sogar noch der alte, außen
liegende Aborterker.
Ein gutes Dutzend dieser schindel- oder strohgedeckten Gebäude steht auch im
Freilichtmuseum in Seiffen. In jedem erinnern Werkzeug, Kleidung, Möbel und
Maschinen an die Handwerker, die einst im Erzgebirge tätig waren: Stellmacher
und Bergleute, Flößer und Köhler, Waldarbeiter und Spankorbmacher. Im Drehwerk
spannt Drechslermeister Dirk Weber gerade einen Ring aus einer Scheibe junger
Fichte in die Drehbank. Während sie rotiert, stemmt er unterschiedliche Flach-
und Hohleisen ins Holz. Späne fliegen, ringeln sich wie Spaghetti, immer wieder
prüft er mit den Fingern die Rillen und Kerben, die er ins Holz schneidet. Als
er den Reifen abnimmt, ist wenig zu
sehen. Erst als er mit einem Messer schmale Stücke abspaltet, wird erkennbar,
was er geschaffen hat: Das Holzstück hat die perfekten Umrisse einer Kuh -
Dutzende gleichförmiger Kühe warten im Holz auf ihre Befreiung.
 Von
einer Baustelle dröhnt ein Radio herüber: Der Wetterbericht des MDR meldet
vorübergehende Schauer im Erzgebirge. Zurück im Wald kommt es zu einem freudigen
Wiedersehen: Der weiß-blau-weiße Balken ist zurück. Ein öder Forstweg zieht
gemächlich, aber stetig bergauf. Noch fünf Kilometer bis zum Fichtelberg, sagt
das Schild. Sollten dies schon seine ersten Vorboten sein? Es riecht würzig nach
frisch geschlagenem Holz, entastete Fichten liegen zwischen wild wuchern-dem
Springkraut. Früher lebten die meisten Menschen im Erzgebirge in irgend-einer
Form vom Holz - nicht ohne Grund heißen Gaststätten immer noch Zum Holzwurm und
Auf dem Holzweg. Auch in der Saigerhütte, ein
paar Tage zuvor am Weg, brauchte man viel Holz. Man heizte damit die Öfen, in
denen aus dem Gestein Erz Silber und Kupfer geschmolzen wurde - etwas simpel
gesagt. Denn in Wirklichkeit war dies ein hochkomplexer, aufwendiger Prozess mit
sechs, sieben verschiedenen Arbeitsgängen, den nur Spezialisten beherrschten.
Dafür wurde im 16. Jahrhundert nicht nur die Hütte in Grüntal gebaut, sondern
nach und nach eine richtige kleine Industriestadt. Die Bergleute hatten eine der
ersten Schulen im Land, sie erhielten verbilligtes Bier und subventioniertes
Brot und lebten kostenfrei in den Wohnhäusern. Vor einigen Jahren wurden
Grundmauern und Ofenreste freigelegt, in den alten Gebäuden sind Hotels, ein
Museum und eine Spiel- und Erlebniswelt untergebracht und ... Von
einer Baustelle dröhnt ein Radio herüber: Der Wetterbericht des MDR meldet
vorübergehende Schauer im Erzgebirge. Zurück im Wald kommt es zu einem freudigen
Wiedersehen: Der weiß-blau-weiße Balken ist zurück. Ein öder Forstweg zieht
gemächlich, aber stetig bergauf. Noch fünf Kilometer bis zum Fichtelberg, sagt
das Schild. Sollten dies schon seine ersten Vorboten sein? Es riecht würzig nach
frisch geschlagenem Holz, entastete Fichten liegen zwischen wild wuchern-dem
Springkraut. Früher lebten die meisten Menschen im Erzgebirge in irgend-einer
Form vom Holz - nicht ohne Grund heißen Gaststätten immer noch Zum Holzwurm und
Auf dem Holzweg. Auch in der Saigerhütte, ein
paar Tage zuvor am Weg, brauchte man viel Holz. Man heizte damit die Öfen, in
denen aus dem Gestein Erz Silber und Kupfer geschmolzen wurde - etwas simpel
gesagt. Denn in Wirklichkeit war dies ein hochkomplexer, aufwendiger Prozess mit
sechs, sieben verschiedenen Arbeitsgängen, den nur Spezialisten beherrschten.
Dafür wurde im 16. Jahrhundert nicht nur die Hütte in Grüntal gebaut, sondern
nach und nach eine richtige kleine Industriestadt. Die Bergleute hatten eine der
ersten Schulen im Land, sie erhielten verbilligtes Bier und subventioniertes
Brot und lebten kostenfrei in den Wohnhäusern. Vor einigen Jahren wurden
Grundmauern und Ofenreste freigelegt, in den alten Gebäuden sind Hotels, ein
Museum und eine Spiel- und Erlebniswelt untergebracht und ...
 ...
jetzt reißt ein Regenschauer den Wanderer unsanft aus seinen
Kammweg-Erinnerungen. Mittlerweile geht es zügig dem Gipfel entgegen. Der Himmel
hat sich dunkel bezogen, im Blick zurück breiten sich Wälder und Wiesen wie ein
schwarz-grünes Pantherfell über die Hügel. Ganz oben, auf 1215 Meter Höhe, ist
die Natur zu Ende, die Zivilisation begrüßt den Ankömmling mit einem
Park-automaten, einem Bus mit Rentnern aus Gera und, versteht sich, einem
fröhlichen Schild: Freibier gibt es morgen, verspricht ein sparsamer Wirt. Das
aber, was von ferne erst an einen Stift, dann an eine winzige Kirche erinnert
hatte, erweist sich als eine Art Burg
mit Granitmauern, dunkelbraunen Holzwänden, gelben Fensterkreuzen und
türkis-grauem Blechdach: Das berühmte Fichtel-berghaus mit dem Hotel "Die Guck"
strahlt durchaus so etwas wie schwerfällige Eleganz aus. ...
jetzt reißt ein Regenschauer den Wanderer unsanft aus seinen
Kammweg-Erinnerungen. Mittlerweile geht es zügig dem Gipfel entgegen. Der Himmel
hat sich dunkel bezogen, im Blick zurück breiten sich Wälder und Wiesen wie ein
schwarz-grünes Pantherfell über die Hügel. Ganz oben, auf 1215 Meter Höhe, ist
die Natur zu Ende, die Zivilisation begrüßt den Ankömmling mit einem
Park-automaten, einem Bus mit Rentnern aus Gera und, versteht sich, einem
fröhlichen Schild: Freibier gibt es morgen, verspricht ein sparsamer Wirt. Das
aber, was von ferne erst an einen Stift, dann an eine winzige Kirche erinnert
hatte, erweist sich als eine Art Burg
mit Granitmauern, dunkelbraunen Holzwänden, gelben Fensterkreuzen und
türkis-grauem Blechdach: Das berühmte Fichtel-berghaus mit dem Hotel "Die Guck"
strahlt durchaus so etwas wie schwerfällige Eleganz aus.
Gemütlich ist es nicht auf dem Dach Sachsens. Kalte Böen jagen über die
Parkplätze, die Wetterstation und die Aussichtsplattform, und lassen den
Wanderer im schweißnassen Hemd frösteln. Da wird die Bestellung des Gipfelbiers
doch eher ins Tal vertagt, nach Oberwiesenthal - und zur Abwechslung geht es mal
mit der Schwebebahn hinunter. Gut wird er schlafen heute Nacht, der Wanderer.
Und höchstens ein- oder zweimal hochschrecken aus einem kleinen Alptraum: Wo ist
der weiß-blau-weiße Balken bloß geblieben ...?
Fotos: Franz Lerchenmüller
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
38 - August 2012
„Zehn kleine Negerlein“-Wanderung
Mitgliederwanderung des Netzwerks
aus der Sicht von Gästen
Von Dr. Klaus Stanek, Gast-Mitwanderer
Der Verein Netzwerk Weitwandern e.V. hatte zur Jahreswanderung 2012 nach
Blumberg in den südlichen Schwarzwald eingeladen. Der Name “Weitwandern” klang
verlockend, wir – Ilka und Klaus Stanek aus Freiberg/Sachs. - kannten den
Schwarzwald noch nicht, und so folgten wir der Einladung von Katharina, der
Vereinsvorsitzenden.
 
Ausgangspunkt der Wanderung durch die Wutachschlucht war Blumberg. Entgegen
der allgemein üblichen Route wanderten die 14 Teilnehmer dieser
Mitglieder-wanderung – von der nur drei wirklich bis ins Ziel kamen – nach
Stühlingen. Mit der Sonne im Rücken stiegen wir über die Kalkhänge des
Buchberges auf. Die Luft war wassergesättigt nach dem Regen der letzten Tage.
Der Wald dampfte im Morgenlicht.
 Entsprechend
dampfte auch die gesamte Wandergruppe am ersten Halt auf dem Buchberg. Der
blühende kalkliebende Bärlauch bildete einen Teppich unter den Buchen des
Gipfelplateaus. Nach dem Einstieg in die Wutachschlucht war von der Wutach
anfangs nur ab und zu ein Rauschen zu hören. Der Wanderweg verlief weit oberhalb
an den Muschelkalkwänden. Am Eisenbahntunnel der Blumberger Traditionsbahn
teilte sich die Gruppe. Mit einigen Lampen und Handys ausgestattet, marschierten
die Wagemutigsten durch den 1,2 km langen Tunnel. Der erste Tag fand seinen
Abschluss in Stühlingen im Café “Einstein”. Entsprechend
dampfte auch die gesamte Wandergruppe am ersten Halt auf dem Buchberg. Der
blühende kalkliebende Bärlauch bildete einen Teppich unter den Buchen des
Gipfelplateaus. Nach dem Einstieg in die Wutachschlucht war von der Wutach
anfangs nur ab und zu ein Rauschen zu hören. Der Wanderweg verlief weit oberhalb
an den Muschelkalkwänden. Am Eisenbahntunnel der Blumberger Traditionsbahn
teilte sich die Gruppe. Mit einigen Lampen und Handys ausgestattet, marschierten
die Wagemutigsten durch den 1,2 km langen Tunnel. Der erste Tag fand seinen
Abschluss in Stühlingen im Café “Einstein”.
Am nächsten Morgen wurden die Autos von Bonndorf zur Schatten-mühle
umgesetzt. Die Wanderung startete um 09:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein in
Blumberg. Zu Beginn der Abstieg in das Bachtal. Der Nebenlauf zur Wutach hatte
sich mit einem Wasserfall in die kalkigen und tonigen Sedimente eingeschnitten.
Der Abstieg über eine steile Leiter verursachte auch eine erste Dezimierung der
Wandergruppe, man konnte die Leiter auch
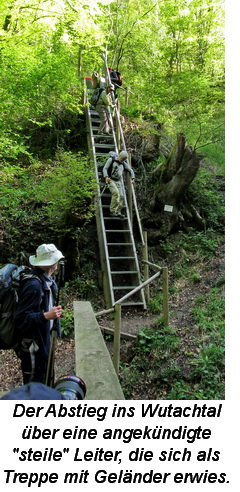 umgehen.
Auf dem Marsch durch das blühende Tal zerstreute sich die Gruppe in einzelne
Diskussionsrunden. Nach kurzer Rast an einer Sägemühle ging es auf dem
landschaftlich sehr schönen, teilweise etwas anspruchsvollen Pfad am Steilhang
der Wutach bis zur Schattenmühle. Hier erwartete uns eine hübsche Bedienung in
Schwarzwälder Tracht mit großen roten Bommeln am Hut. Die auf der Wanderung
verbrauchten Kalorien wurden umgehend bei Kaiserschmarren und anderen Leckereien
wieder aufgefüllt. Übernachtet wurde in Bonndorf im Hotel Kranz. Die Wirtin
zau-berte trotz Ruhetag ein gutes Abendessen. In der Nacht gab es einen
Wetterumschwung. umgehen.
Auf dem Marsch durch das blühende Tal zerstreute sich die Gruppe in einzelne
Diskussionsrunden. Nach kurzer Rast an einer Sägemühle ging es auf dem
landschaftlich sehr schönen, teilweise etwas anspruchsvollen Pfad am Steilhang
der Wutach bis zur Schattenmühle. Hier erwartete uns eine hübsche Bedienung in
Schwarzwälder Tracht mit großen roten Bommeln am Hut. Die auf der Wanderung
verbrauchten Kalorien wurden umgehend bei Kaiserschmarren und anderen Leckereien
wieder aufgefüllt. Übernachtet wurde in Bonndorf im Hotel Kranz. Die Wirtin
zau-berte trotz Ruhetag ein gutes Abendessen. In der Nacht gab es einen
Wetterumschwung.
 Die
Wanderung am dritten Tag begann mit dem Umsetzen der Autos von Bonndorf nach
Oberfischbach in strömendem Regen. Mit dem Abstieg in die Lottebachklamm ließ
auch der Regen nach. Der Abstieg in leichtem Nieselregen ging vorbei an
Granitklippen, über die der Lottebach kleine Wasserfälle bildet. Der Wald
triefte immer noch vor Nässe. An der Schattenmühle querten wir die Wutach und
wanderten auf der Nordseite Richtung Die
Wanderung am dritten Tag begann mit dem Umsetzen der Autos von Bonndorf nach
Oberfischbach in strömendem Regen. Mit dem Abstieg in die Lottebachklamm ließ
auch der Regen nach. Der Abstieg in leichtem Nieselregen ging vorbei an
Granitklippen, über die der Lottebach kleine Wasserfälle bildet. Der Wald
triefte immer noch vor Nässe. An der Schattenmühle querten wir die Wutach und
wanderten auf der Nordseite Richtung
Räuberschlößl. Der Aufstieg im Buntsandstein brachte den Hosen einige
rötliche Schlammspritzer. Der Wald besteht hier aus mächtigen Weißtannen und
Buchen, der ursprünglichen Vegetation der Wutachschlucht. Das Räuberschlößl ist
eine Felsklippe aus rötlichen Porphyr inmitten eines porphyrischen Granits. Die
Erläuterungstafel weist auf eine alte Burganlage hin, die hier mal gestanden
haben soll.
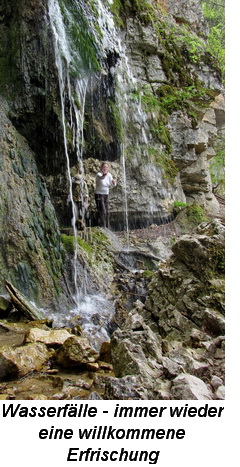 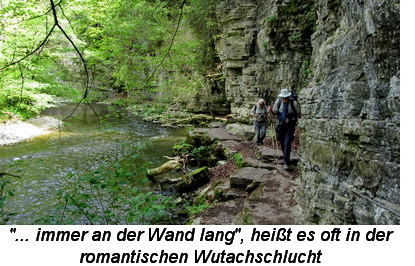 Vom
Räuberschlößl führte der Weg in Richtung der Stalleg-Brücke entlang der
Hangkante. Nach einem kurzen Abstieg sah man eine hölzerne Hausbrücke, die die
Wutach an einer engen Klamm überspannt. Laut Erläuterungstafel hatte die Brücke
in der Vergangenheit strategische Bedeutung. Hier wurde unter schützendem Dach
der Brücke Rast gemacht. Nach der Mündung des Röthenbaches lief die Wandergruppe
auf einem schmalen Steig in Richtung Haslachklamm. Der Bach windet sich durch
eine Serie von Glimmerschiefern und Gneisen, die schmale Felsriegel bilden, die
dann in Serpentinen
umstiegen werden mussten. Der Schachtelhalm begann zu sprießen, zunehmend wurden
die Tannen durch Fichten ersetzt. Nach kurzem Anstieg erreichten wir einen
früheren Bahndamm, auf dem es dann in Richtung Lenzkirch ging. Schon mit Blick
auf Lenzkirch begann es zu gießen, so dass für die letzten Kilometer der
komplette Regenschutz angesagt war. Der Treffpunkt für die zersplitternde
Wandergruppe war das Café Central am Markt in Lenzkirch. Vom
Räuberschlößl führte der Weg in Richtung der Stalleg-Brücke entlang der
Hangkante. Nach einem kurzen Abstieg sah man eine hölzerne Hausbrücke, die die
Wutach an einer engen Klamm überspannt. Laut Erläuterungstafel hatte die Brücke
in der Vergangenheit strategische Bedeutung. Hier wurde unter schützendem Dach
der Brücke Rast gemacht. Nach der Mündung des Röthenbaches lief die Wandergruppe
auf einem schmalen Steig in Richtung Haslachklamm. Der Bach windet sich durch
eine Serie von Glimmerschiefern und Gneisen, die schmale Felsriegel bilden, die
dann in Serpentinen
umstiegen werden mussten. Der Schachtelhalm begann zu sprießen, zunehmend wurden
die Tannen durch Fichten ersetzt. Nach kurzem Anstieg erreichten wir einen
früheren Bahndamm, auf dem es dann in Richtung Lenzkirch ging. Schon mit Blick
auf Lenzkirch begann es zu gießen, so dass für die letzten Kilometer der
komplette Regenschutz angesagt war. Der Treffpunkt für die zersplitternde
Wandergruppe war das Café Central am Markt in Lenzkirch.
Hier verabschiedeten sich aus beruflichen Gründen Katharina und Carsten,
Ursula war schon zuvor verschollen. Von Lenzkirch gab es nur noch ein Ziel: nach
oben. Vorbei am Geopark von Lenzkirch mit einigen schwach erläuterten Gesteinen
aus dem südlichen Schwarzwald, vorbei an einer einsamen Kapelle und benachbarten
Schwarzwaldwirtschaften. Am Ende des steilen Aufstieges wurden wir durch einen
kräftigen Regenguss erfrischt. In der Grillhütte am Sportplatz Oberfischen
hatten vor uns schon andere Wanderer Schutz gesucht. Mit dem Aufklaren
erreichten wir die Autos, um in das Hotel
“Hochschwarzwaldhof” zu fahren.
 Am
vierten Tag setzten wir den Marsch von Oberfischbach in Richtung Bildstein fort.
Bei strahlendem Sonnenschein hatte man eine sehr gute Aussicht über den noch
teilweise schneebedeckten Feldberg. Die Wanderroute verlief um den südwestlichen
Schluchsee herum. Am
vierten Tag setzten wir den Marsch von Oberfischbach in Richtung Bildstein fort.
Bei strahlendem Sonnenschein hatte man eine sehr gute Aussicht über den noch
teilweise schneebedeckten Feldberg. Die Wanderroute verlief um den südwestlichen
Schluchsee herum.
Nach kurzer Mittagsrast marschierten wir auf breiten mit Granitgrus belegten
Waldwegen auf die Höhe in Richtung Krummenkreuz-Hütte und -Brunnen. Das Wasser
aus dem Brunnen schmeckte gut. Im Wald öffnete sich ab und zu ein Tal mit
typischen Schwarzwaldhäusern. Auf der mit Heidekraut bewachsen Erosionsfläche
eines Granites sammelte sich die Gruppe zu einer ausgedehnten Rast in der
Mittagssonne. Die Wiesenflächen öffneten den Blick auf die schneebedeckten Kämme
der Schweizer Alpen. Mit einer gewissen Schadenfreude schickten wir per Handy
ein Gruppenfoto an die bereits wieder berufstätige Katharina.
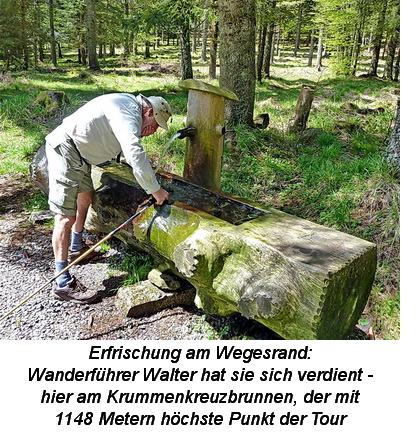  Von
der Hochfläche stiegen wir über die Windbergschlucht ab. Die Windbergschlucht
ist eine kleine Klamm, die sich im rötlichen Porphyr bis zum Ortseingang von St.
Blasien erstreckt. Auf der Suche nach einem Café liefen wir bis zum Ortszentrum
und zum Dom. Der Dom ist Teil einer Benediktiner-Klosteranlage. Hier machte Lutz
eine kurze Führung zum frühklassizistischen Baustil der runden Kirche. Heute
beherbergt das ehemalige Kloster ein von Jesuiten geführtes Internat und
Gymnasium. Nach einer Stärkung mit Eiskaffee und Schwarzwälder-Kirsch-Eisbecher
im Café Domspatz fuhren wir in unser Hotel. Von
der Hochfläche stiegen wir über die Windbergschlucht ab. Die Windbergschlucht
ist eine kleine Klamm, die sich im rötlichen Porphyr bis zum Ortseingang von St.
Blasien erstreckt. Auf der Suche nach einem Café liefen wir bis zum Ortszentrum
und zum Dom. Der Dom ist Teil einer Benediktiner-Klosteranlage. Hier machte Lutz
eine kurze Führung zum frühklassizistischen Baustil der runden Kirche. Heute
beherbergt das ehemalige Kloster ein von Jesuiten geführtes Internat und
Gymnasium. Nach einer Stärkung mit Eiskaffee und Schwarzwälder-Kirsch-Eisbecher
im Café Domspatz fuhren wir in unser Hotel.
 Das Hotel
“Zum Hirschen” in Mutterslehen (westlich St. Blasien) ist eine großzügige
Pension/Hotel im Jagdhausstil. Laut Gästetafel waren wir auf den Spuren von
Bundespräsidenten und Ministern, die alle hierher vor allem zum Jagen kamen. Das Hotel
“Zum Hirschen” in Mutterslehen (westlich St. Blasien) ist eine großzügige
Pension/Hotel im Jagdhausstil. Laut Gästetafel waren wir auf den Spuren von
Bundespräsidenten und Ministern, die alle hierher vor allem zum Jagen kamen.
Am nächsten Morgen verließ uns Lutz. Der Rest der Gruppe stieg bei strahlend
schönem Wetter und schon warmen Temperaturen auf. Zum Glück warf der
Buchen-Mischwald etwas Schatten. Vorbei am Jesuitenblick, einem Überblick über
den Internatskomplex (siehe
Titelseite), ging es zum
Aussichtsturm am Lehenkopf. Von hier aus hatte man einen schönen Blick nach
Norden zum Feldberg und nach Süden auf die schneebedeckten Schweizer Alpen.
Danach ging es in lockerem Auf und Ab über den Weidberg zu einer Aussicht über
den südlichen Schwarzwald, den Schweizer Faltenjura und die südlich
anschließenden Alpenketten.
 Der
Abstieg in der prallen Sonne führte zu einem Weiher, dessen Wirtschaft aber erst
zwei Tage später am 12. Mai neu eröffnet wurde. Wir verließen das Tal über einen
steilen Anstieg, vorbei an einigen Schautafeln zum historischen Bergbau auf
liquidmagmatische Sulfidvererzungen im Gebiet Ibach-Todtmoos. Auf dem
Granitplateau sammelte sich die Gruppe im Schatten einer Fichtengruppe zu einer
längeren Rast. Zum Nachmittag mussten wir in Richtung Todtmoos zweimal die
Straße queren, zuletzt am Ibacher Kreuz. Der Weg führte abwechslungsreich über
Weiden, durch kleine schattenspendende
Waldstücke und mündete
schließlich ins Wehra-Tal. Der Wehra folgend stiegen wir relativ steil einem
schmalen Pfad hinterher und erreichten gegen 16:00 Uhr Todtmoos. Der erste Gang
der durstigen Truppe führte in ein Café gegenüber der Apotheke. Hier zeigte das
digitale Thermometer immer noch 27 Grad Celsius. Begierig wurden Apfelschorle,
Eiskaffee und Schwarzwälder Kirschtorte bestellt, jedoch lag das Angebot weit
unter dem Durchschnitt der bisherigen Wanderung. Dafür entschädigte das
Schwimmbad im Hotel. Der
Abstieg in der prallen Sonne führte zu einem Weiher, dessen Wirtschaft aber erst
zwei Tage später am 12. Mai neu eröffnet wurde. Wir verließen das Tal über einen
steilen Anstieg, vorbei an einigen Schautafeln zum historischen Bergbau auf
liquidmagmatische Sulfidvererzungen im Gebiet Ibach-Todtmoos. Auf dem
Granitplateau sammelte sich die Gruppe im Schatten einer Fichtengruppe zu einer
längeren Rast. Zum Nachmittag mussten wir in Richtung Todtmoos zweimal die
Straße queren, zuletzt am Ibacher Kreuz. Der Weg führte abwechslungsreich über
Weiden, durch kleine schattenspendende
Waldstücke und mündete
schließlich ins Wehra-Tal. Der Wehra folgend stiegen wir relativ steil einem
schmalen Pfad hinterher und erreichten gegen 16:00 Uhr Todtmoos. Der erste Gang
der durstigen Truppe führte in ein Café gegenüber der Apotheke. Hier zeigte das
digitale Thermometer immer noch 27 Grad Celsius. Begierig wurden Apfelschorle,
Eiskaffee und Schwarzwälder Kirschtorte bestellt, jedoch lag das Angebot weit
unter dem Durchschnitt der bisherigen Wanderung. Dafür entschädigte das
Schwimmbad im Hotel.
Nach Mitternacht setzte der schon am Tag zuvor angekündigte Regen ein.
Christine hat sogar Gewitterdonner gehört, alle anderen hatten tief und fest
geschlafen. Am Morgen des letzten Tages spürte man schon die Aufbruchstimmung.
Während des Frühstücks wurde schon der Heimweg geplant, Mitfahrer wurden
eingeteilt und die Autos entlang der Strecke postiert.
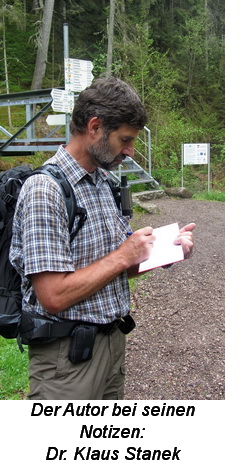 Beim
Abmarsch in Todtmoos zeigte das Thermometer an der Apotheke nur noch 9 Grad
Celsius. Über Nacht gab es einen Temperatursturz von 18 Grad. In strömendem
Regen verließen wir den letzten Etappenort. Anfangs folgten wir auf der
Westseite des Tales nach Wehr breiten, befestigten Wanderwegen. Nach dem Wechsel
auf die östliche Talseite verengten sich die Wege zu einem Steig, der sich am
oberen Talhang entlang schlängelte. Wir liefen so jedes Nebental aus. Beim
Abmarsch in Todtmoos zeigte das Thermometer an der Apotheke nur noch 9 Grad
Celsius. Über Nacht gab es einen Temperatursturz von 18 Grad. In strömendem
Regen verließen wir den letzten Etappenort. Anfangs folgten wir auf der
Westseite des Tales nach Wehr breiten, befestigten Wanderwegen. Nach dem Wechsel
auf die östliche Talseite verengten sich die Wege zu einem Steig, der sich am
oberen Talhang entlang schlängelte. Wir liefen so jedes Nebental aus.
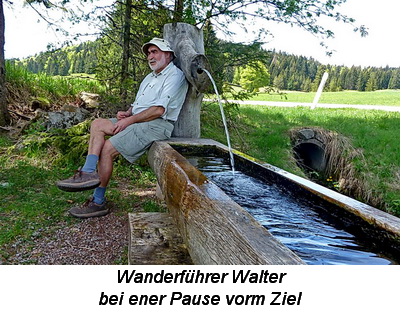 Gegen
13:00 Uhr erreichten wir nach wechselnden Regengüssen den Parkplatz an einer
Steinbrücke auf halber Strecke. Hier verabschiedeten sich Regine, Christine und
Helmi. Andere machten ausgiebig Pause, so marschierten wir nur noch zu dritt
Richtung Wehr. Der Pfad führte wieder auf die westliche Talhöhe. Stellenweise
war der Weg durch Windbruch versperrt, der zum Teil mühsam auf glitschigem
Geläuf umgangen werden musste. An der oberen Hangkante angekommen, stiegen wir
auf einem breiten Waldweg ab. Die Stadt Wehr lag nebelumrahmt im Kerbtal vor
uns. Gegen 16:00 Uhr waren wir am Auslauf des Stauwerkes angelangt. Nach einem
kurzen Marsch erreichten
wir unseren Autostandort am Hotel. Gegen
13:00 Uhr erreichten wir nach wechselnden Regengüssen den Parkplatz an einer
Steinbrücke auf halber Strecke. Hier verabschiedeten sich Regine, Christine und
Helmi. Andere machten ausgiebig Pause, so marschierten wir nur noch zu dritt
Richtung Wehr. Der Pfad führte wieder auf die westliche Talhöhe. Stellenweise
war der Weg durch Windbruch versperrt, der zum Teil mühsam auf glitschigem
Geläuf umgangen werden musste. An der oberen Hangkante angekommen, stiegen wir
auf einem breiten Waldweg ab. Die Stadt Wehr lag nebelumrahmt im Kerbtal vor
uns. Gegen 16:00 Uhr waren wir am Auslauf des Stauwerkes angelangt. Nach einem
kurzen Marsch erreichten
wir unseren Autostandort am Hotel.
Wir haben eine sehr interessante Wanderung erlebt. Dank der exzellenten
Vorbereitung durch Walter, seinen Erläuterungen zur Historie und
Landschaftsgeschichte werden uns die fünf Tage Südschwarzwald in guter
Erinnerung bleiben.
Fotos: Katharina Wegelt (7) und Hans Losse (7)
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
39 - Dezember 2012
Pfälzer Wald Tour im Mai 2011
Von Hans Diem
Wir, Evelyn und Hans Diem, hatten uns den Pfälzerwald ausgesucht für eine
Rucksacktour zur Vorbereitung auf die Sommertour. Es wurde ein voller Erfolg.
Die 1. Runde war eine Fußtour über 5 Tage zu 15 gut erschlossenen Burgruinen
südlich vom Ort Dahn mit Infotafeln, neuen Treppen und Eisengeländern. Es kamen
bei ständigem Auf und Ab auch hier beachtliche Höhenmeter zusammen. Gute Wege
mit Beschilderung und Markierung führten sicher durch die riesigen Wälder, mal
durch düsteren Nadelwald, mal durch Sonnenlicht durchfluteten Buchenwald mit
feinster Atemluft und wohltuender Stille bei beruhigendem Rauschen der Bäume.
Allermeist waren wir allein, trafen
nur zwei Wandergruppen auf
Tagestour, drei Frauen auf Wochenendtour und einige Leute an einer der Ruinen.
Dazu kam der tolle Treff mit dem Wanderhans und seiner Frau aus St. Ingbert. Er
bot perfektes Gitarrenspiel mit Gesang, dazu Geschichten aus der Pfalz für einen
ganzen Nachmittag.
Die 2. Runde war eine Autoreise über zwei Tage im Norden von Dahn zu Dörfern
mit Abstechern zu drei Burgen. Fazit: Der Pfälzerwald ist weitere Reisen wert,
wir kommen wieder für den Weinsteig, den Waldpfad und den Höhenweg. Die
Wanderkarten haben wir schon, der Wanderhans hat die Tipps, dazu der
Pfälzerwald-Verein mit seinen Infos übers Internet (www.pwv.de)
- perfekt.
Also:
Anreise, schönes warmes
Wetter.
Anreise ab 12 Uhr, Autofahrt von Garmisch nach München, kurzer Besuch bei
meiner Schwester Annemarie. Weiterfahrt auf Autobahn über Stuttgart, Karlsruhe
bis Ausfahrt Kandel, auf Landstraße über Bad Bergzabern nach Dahn, zentraler
Ferienort im Felsenland und mitten im südlichen Pfälzerwald. Um 20.15 Uhr sind
wir 3 km außerhalb am Neudahner Weiher, zelten auf dem Campingplatz an einem
kleinen See, bekommen noch ein Essen im Gasthaus vom netten jungen Wirt.
1. Tag, am Morgen 6°C,
schönes Wetter mit 20°C, dann regnerisch.
Wir können das Auto am Campingplatz Neudahner Weiher parken, packen unser
großes Zelt ins Auto, gehen dann mit Zeltausrüstung und Kocher im großen
Rucksack auf eine Rundtour im Süden von Dahn.
Beginn auf dem Radweg am Bahngleis entlang in das Dorf Dahn (200 m üNN, in
45 min.). Rundgang im Dorf, rundherum schauen rote Felsbrocken aus dem Wald
hervor, ein 2. Frühstück beim Bäcker, dann aber los. Richtung Süd-West aus dem
Dorf hinaus, vorbei an den Felsnadeln Braut und Bräutigam, an einem super Hotel,
daneben ein Campingplatz, noch durch eine Häuserzeile namens Büttelwoog und ab
in den schönen Wald. Auf einem Fahrweg nach Wegweiser [Fischbach] und bestens
markiert mit rot/weiß leicht aufwärts zum Dahner Hals (320 m), eine Stunde
leicht bergab zum Dorf Fischbach (220 m, 2:30h, Brunnen, Gasthaus mit Zimmer,
Bäckerei).
 Weiter
mit rot/gelb auf Fahrweg zum Wanderheim und Gasthaus Walthari Klause im kleinen
Ort Petersbächel (250 m, 45 min). Einkehr zu Eintopf (sehr gut), Apfelschorle,
Espresso (weniger gut), fünf Leute hier. Es ist bewölkt und regnerisch geworden,
da gehen wir in langer Hose und langem Hemd bergauf zur Wegekreuzung Zollstock
(351 m, 25 min), hier ist ein Grenzübergang nach Frankreich. Flach weiter zum
Bayrischen Windstein an der Grenze zu Frankreich (35 min). Der tolle Felsbrocken
hat eine Leiter hinauf zum Ausblick auf das hüglige Riesen-Waldgebiet im Süden. Weiter
mit rot/gelb auf Fahrweg zum Wanderheim und Gasthaus Walthari Klause im kleinen
Ort Petersbächel (250 m, 45 min). Einkehr zu Eintopf (sehr gut), Apfelschorle,
Espresso (weniger gut), fünf Leute hier. Es ist bewölkt und regnerisch geworden,
da gehen wir in langer Hose und langem Hemd bergauf zur Wegekreuzung Zollstock
(351 m, 25 min), hier ist ein Grenzübergang nach Frankreich. Flach weiter zum
Bayrischen Windstein an der Grenze zu Frankreich (35 min). Der tolle Felsbrocken
hat eine Leiter hinauf zum Ausblick auf das hüglige Riesen-Waldgebiet im Süden.
Kurz bergab in Kehren, flach weiter, da brauche ich für 20 min. den Schirm
und Ev den Poncho wegen Regen. Jetzt in Frankreich kurzer Aufstieg in Urwald zur
Ruine Lützelhardt (351 m, 40 min). Wir steigen auf Leitern zu den Etagen, denken
uns hinein in die Zeit vom 12. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert, schauen vom
Turm in die Ferne. Um 18.45 Uhr ziehen wir weiter Richtung Süd Ost, suchen lange
einen ebenen Platz zum Zelten, müssen in einem Wald mit viel Totholz übernachten
(1:00 h). Gehzeit 6:40 Std.
2. Tag, 7° - 15°C, schön.
Nach unserem bescheidenen Frühstück im Zelt, dafür komfortabel im
luftgepolsterten Faltsitz mit Rückenlehne sitzend, sind wir in 10 min im Dorf
Obersteinbach (240 m) mit zwei Auberges und Restaurant. Links ab über die Rue du
Wachtfels und steil bergauf, biegen falsch ab und kommen auf Umwegen zur Ruine
Klein-Arnsburg (300 m, 1:15 h). Durch die Infotafel bekommen wir Einblick in das
Leben damals zur Ritterszeit.
Abstieg zum Langenbach und drüben im schönen Laubwald hinauf zur nächsten
Burg, zur großen Ruine Wasigenstein (300 m, 35 min). Der Doppelfelsen trägt 2
Burgen und ist eine der berühmtesten der Nordvogesen. Ganz oben machen wir
unsere Espressopause und schauen dabei aufs Land hinaus. Es kommen einige
Besucher.
 Nach
der Markierung gehen wir weiter Richtung Ost am Zigeunerfelsen (439 m) vorbei,
zwei Bergradler und zwei große Wandergruppen kommen uns entgegen. Der Weg geht
die Höhe haltend die Talschlüsse aus, weil durch Baumfällen Markierungen fehlen
gehen wir oberhalb zu weit, müssen zurück und abwärts zur Ruine Froensburg (305
m, 1:25 h). Unglaublich, was auf allen Burgen gebaut wurde durch Aushöhlen und
Dazubauen, und das mitten im Urwald, weil sich die roten Sandsteinfelsen dazu
eigneten. Auf Infotafeln und in unserer Beschreibung können wir das Wichtigste
nachlesen. Nach
der Markierung gehen wir weiter Richtung Ost am Zigeunerfelsen (439 m) vorbei,
zwei Bergradler und zwei große Wandergruppen kommen uns entgegen. Der Weg geht
die Höhe haltend die Talschlüsse aus, weil durch Baumfällen Markierungen fehlen
gehen wir oberhalb zu weit, müssen zurück und abwärts zur Ruine Froensburg (305
m, 1:25 h). Unglaublich, was auf allen Burgen gebaut wurde durch Aushöhlen und
Dazubauen, und das mitten im Urwald, weil sich die roten Sandsteinfelsen dazu
eigneten. Auf Infotafeln und in unserer Beschreibung können wir das Wichtigste
nachlesen.
Auf Fußwegen und Fahrwegen im durchweg schönen Wald, meist Laubwald mit viel
Sonne darin, mit unglaublich langen und schlanken Buchen zu einem kleinen
Stausee auf 200 m, kurz bergauf zur Ruine einer der mächtigsten Burgen der
Nordvogesen, zur Ruine Fleckenstein (370 m, 1:05 h). Ein ein-faches Gasthaus
bietet uns Flammkuchen, Würstel mit Kartoffelsalat, Saft, Kaffee und Kuchen,
auch ein Weißbrot zum Mitnehmen. Der Eintritt zur teils restaurierten Burg
kostet 2.50 €,
wir gehen die riesige Burg ab von vorne bis hinten, von unten bis oben,
fantastisch.
 Weiter
auf Waldwegen zur Ruine Löwenstein (520 m, 40 min.), die kleine Anlage hat nur
wenige Restmauern, hier hausten auch mal Raubritter. Weiter
auf Waldwegen zur Ruine Löwenstein (520 m, 40 min.), die kleine Anlage hat nur
wenige Restmauern, hier hausten auch mal Raubritter.
Daneben die Ruine Hohenburg (551 m, 5 min.), die gefällt uns am Besten.
Klein, aber toll, mit einem Rundum-Panorama oben auf dem Turm, 360° freie Sicht!
Kein Wald stört, es wurde frei geholzt!
Kurz nach der Burg gehen wir über die Landesgrenze nach Deutschland zurück
zur Ruine Wegelnburg (572 m, 15 min.). Es ist die höchst gelegene Burg, doch der
nahe Hochwald verbaut teilweise die Aussicht. Neben der Ruine zelten wir unter
dem Blätterdach mächtiger Buchen. 5:20 Std. Gehzeit und sieben Burgruinen.
 3. Tag,
am Morgen 9°C, bedeckt,
dann sonnig. 3. Tag,
am Morgen 9°C, bedeckt,
dann sonnig.
Um 8 Uhr gehen wir los, bergab in Kehren zum historischen kleinen Dorf
Nothweiler (318 m, 30 min., Gasthäuser). Wir lesen die Geschichte des Dorfes,
gehen dann auf Teer-Radweg neben Bach und Autostraße, das ist weniger schön, in
das Dorf Niederschlettenbach (185 m, 1:05 h). Das eine Gasthaus hat gerade
Ruhetag, die Bäckerei hat längst aufgegeben, einen Laden gibt es auch nicht,
schade. Da packe ich auf dem Dorfplatz unseren Kocher aus für unser 2. Frühstück
mit Kaffee und Keksen, zum Glück läuft Wasser im Brunnen. Eine Frau meint:
„Gell, mir sind ein armes Dorf“.
Unser Weiterweg, wieder auf Teer-Radweg, geht zum Dorf Erlenbach (200 m,
45 min.). Wir biegen ab und gehen auf der Straße hinauf zur Burg
Berwartstein
(15 min). In einer Stunde Burgführung erfahren wir viel über die Vergangenheit,
den (Un)Ritter Hans Trapp und die Gegenwart der teils bewohnten Burg. Die
Gaststätte ist im Rittersaal, da speisen wir Pfälzer Leberknödel mit Sauerkraut.
Hätten wir kein Geld dabei, müssten wir das wahrscheinlich schwer büßen in der
Folterkammer. Der Burgführer sieht unseren Abgang mit den großen Rucksäcken auf
dem Rücken und erkundigt sich. Das wäre
auch seines, meint er glaubhaft.
 Zurück
nach Erlenbach, im Fehrental ziehen wir weiter Richtung NW, vorbei an der
Drachenfelshütte (geschlossen) zur Ruine Drachenfels (368 m, 1:15 h). Wie bei
allen Ruinen ist diese auch hier gut erschlossen mit Stahltreppen bis hinauf auf
den Turm mit der tollen Aussicht aufs Land, zur nächsten Burg, zum großen Dorf
Busenberg am Fuß der Burg. Und wieder serviere ich uns einen Burg-Espresso mit
einem Keks in einer windge schützten Ecke. Zurück
nach Erlenbach, im Fehrental ziehen wir weiter Richtung NW, vorbei an der
Drachenfelshütte (geschlossen) zur Ruine Drachenfels (368 m, 1:15 h). Wie bei
allen Ruinen ist diese auch hier gut erschlossen mit Stahltreppen bis hinauf auf
den Turm mit der tollen Aussicht aufs Land, zur nächsten Burg, zum großen Dorf
Busenberg am Fuß der Burg. Und wieder serviere ich uns einen Burg-Espresso mit
einem Keks in einer windge schützten Ecke.
Nach 20 min. Abstieg sind wir im Dorf
Busenberg (250 m) und suchen den Laden zum Einkauf. Ätsch, der ist wegen
Krankheit an diesem Nachmittag geschlossen.
Doch der hochmoderne Bäckerladen hat auf, hat Butter, Marmelade und Brot für
uns, dazu Kaffee und Kuchen am Tisch. Bräuchte es ja eigentlich nicht, aber
etwas Luxus darf doch sein.
Vor lauter Torte gehe ich die verkehrte Richtung aus dem Dorf hinaus,
dummerweise merkt es mein Evchen eine Sekunde vor mir. Jetzt muss ich ihr auf
dem beschilderten Weg im großen Bogen durch das Dorf folgen, entgegen meiner
Meinung nach Karte und Kompass. Ich sag´s schon immer, in den Dörfern verläuft
man sich am ehesten. Wieder auf einer Radroute kommen wir nach Schindhard, dann
auf Wanderweg hinauf zur Ruine Alt Dahn (300 m, 1:15 h). Es ist 18.30 Uhr, die
Burg aber ist ab 18 Uhr geschlossen. Über den Heldenfriedhof gehen wir hinab
nach Dahn (200 m, 40 min) und zur Jugendherberge
hinauf. Sie haben ein Zimmerlager mit Dusche für uns. Im Haus tollen mehrere
Schulklassen wild durch das Treppenhaus, die Kids machen im Spielen tüchtig
Sport. Gehzeit 6:00 Std.
 4. Tag,
bedeckt. 4. Tag,
bedeckt.
Um 8 Uhr bekommen wir ein reichliches Frühstück, zahlen die Rechnung mit 35
€.
Durch Dahn gehen wir in Richtung NW, auf Waldweg hinauf, vorbei an den Felsen
Satansbrocken und Hexenpilz zur Ruine Neu Dahn (300 m, 1:15 h). Auch ein
gewaltiges Bauwerk aus Oberburg und Unterburg mit Wendeltreppen aus Sandstein,
auch mit viel Geschichte vom 12. bis 17. Jahrhundert.
Nach 15 min. Abstieg sind wir am Neudahner Weiher und bei unserem Auto.
Damit fahren wir hinauf zum Parkplatz unter der Ruine Alt Dahn und holen den
Besuch nach. Hier stehen drei Burgen nebeneinander auf mächtigen Felsen. Eine
ist zu besichtigen, wir steigen auf alle Ebenen über Eisentreppen und
Steintreppen, schauen in jeden Winkel und von ganz oben übers Land und zu den
umliegenden Burgen. Gehzeit 2:00 Std.
Mit dem Wanderhans aus St. Ingbert hatte ich einen Treff ausgemacht im
Gasthaus am Neudahner Weiher. Punkt 14 Uhr sind wir da, der Hans Abel und seine
Frau Liselotte warten schon auf uns. Ich kenne ihn und seine Wanderungen bisher
nur über das Internet. Der große schlanke 70-jährige hat seine Gitarre dabei und
viele zünftige Lieder und Schlager und auch Gedichte im Kopf, er trägt sie
gekonnt vor. Dazwischen die schönen Geschichten von ihm und ihr. Er tritt gerne
auf in den Pfälzer Hütten zu Wein, Weib und Gesang. Im Internet ist er präsent
mit seinen Beschreibungen
von Pfalzwegen und Berichten von langen Touren in den Alpen wie den
Maximiliansweg von Lindau nach Berchtesgaden (seinem Maxi), wie den Goetheweg
von München nach Venedig, wie seiner Tour per Anhalter vom Königsee zur Nordsee,
finanziert mit dem Erlös von Auftritten in Fußgängerzonen.(www.wandernmithans.de)
Ein Paar aus einem Wohnmobil setzt sich dazu und berichtet von seinen speziellen
Erfahrungen.
Wir zelten noch mal am Neudahner Weiher, der junge Wirt empfiehlt uns seinen
Winzer in Eschbach.
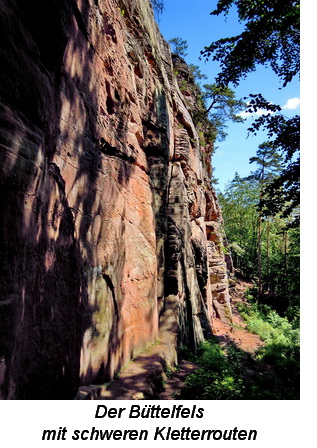 5. Tag,
8 – 28°C, schön. 5. Tag,
8 – 28°C, schön.
Frühstück im Zelt, dann packen und mit dem Auto 3 km weit zur Dahner Hütte
gefahren. Das Auto geparkt, den kleinen Rucksack gepackt, ab 9.30 Uhr gehen wir
auf den Rundweg Dahner Felsenpfad, ein Muss. Der markierte Weg geht 12 km lang
im Wald zu 14 bedeutenden Felsen, fünf davon als Aussichtspunkt. Es sind bizarre
Felsen aus Wasgauer Buntsandstein, jeder hat einen entsprechenden Namen. Erst
sind es kleinere Brocken die wir umrunden, den Hirschfelsen, das Schusterbänkel,
den Schlangenfelsen, den Mooskopf, den Roßkegelfelsen, den Ungeheuerfelsen. Von
11 bis 11.30 Uhr sind wir dann am Büttelfels. Riesig, lang, hoch, senkrecht, mit
einem großen Fenster, zu
dem man hinaufsteigen kann. In der sonnigen senkrechten Südwand sehen wir die
Bohrhacken von vielen Kletterrouten, einige mit weißen Magnesiumflecken von
Kletterern am Vortag. Ein Münchner Seniorenpaar ist auch hier, der Mann wollte
Kletterer fotografieren mit seiner tollen Hasselblad-Kamera. Leider sind keine
in der Wand, die ist sicher nur für wenige Steilwand-Akrobaten zu schaffen. Das
Paar hat mit einem Wohnmobil die Grenze Deutschlands abgefahren, hat all die
Sehenswürdigkeiten besucht und ist jetzt fast am Ende seiner Reise.
Dann der ebenfalls imposante
Lämmerfelsen, er besteht aus einer Reihe von Türmen, einer hat eine vermutlich
aller schwerste überhängende Kletterroute. Vorbei am Hotel Pfalzblick, vom
Wachtfelsen mit Leiter der Ausblick auf Dahn, Braut und Bräutigam stehen direkt
neben der Straße und sind ein schönes Fotomotiv, vom Pfaffenfels wieder ein
Ausblick, der Schillerfelsen steht nahe am Ort, vom Schwalbenfelsen wieder ein
Tiefblick auf Dahn aus einem 3. Blickwinkel.
 Nach
einer halbrunden Felsenformation mit dem passendem Namen Arena, sind wir um
14.35 Uhr nach fünf Stunden zurück an der Dahner Hütte. Hier sitzen eine Menge
Gäste an den Tischen im Freien, schön in der Sonne. Bei Bratwurst mit Kraut,
Radler und Saft, Kaffee und Kuchen beobachten wir das muntere Treiben, da fehlt
nur noch der Wanderhans mit seinem Gitarrenspiel zu lustigen Liedern. Das Paar
aus dem Wohnmobil ist auch da, wir setzen unsere Unterhaltung vom Dahner Weiher
hier fort. Nach
einer halbrunden Felsenformation mit dem passendem Namen Arena, sind wir um
14.35 Uhr nach fünf Stunden zurück an der Dahner Hütte. Hier sitzen eine Menge
Gäste an den Tischen im Freien, schön in der Sonne. Bei Bratwurst mit Kraut,
Radler und Saft, Kaffee und Kuchen beobachten wir das muntere Treiben, da fehlt
nur noch der Wanderhans mit seinem Gitarrenspiel zu lustigen Liedern. Das Paar
aus dem Wohnmobil ist auch da, wir setzen unsere Unterhaltung vom Dahner Weiher
hier fort.
Es fehlt uns nur noch das Wahrzeichen von Dahn. Mit dem Auto fahren wir hin,
steigen in 15 min auf den senkrechten Felsen am Dorfrand, den Jungfernsprung.
Das ist die Krönung mit dem Blick auf das Dorf und die umliegenden Felstürme,
die aus dem Wald herausragen.
Wir machen weiter mit der 2. Runde, der Autofahrt zu interessanten Zielen
nördlich von Dahn, fahren am Abend noch über Lemberg, Münchweiler, Merzalben,
Leimen zum kleinen Ort Hermesbergerhof, einsam auf einer Höhe gelegen im
Riesen-Waldgebiet. Der Landgasthof Luitpoldsturm hat ein Zimmer frei, die sechs
weiteren Gäste sind Jagdgäste.
6. Tag, schön und warm.
Nach einem reichlichen Frühstück fahren wir zum Parkplatz und gehen zum
Luitpoldsturm. Der steinerne Aussichtsturm steht auf 610 m, ist 34,6 m hoch und
bietet einen perfekten Rundumblick auf den Pfälzerwald, wir haben die gute Sicht
dazu. Über Leinen fahren wir ein Stück Straße zurück bis zum Parkplatz An der
Karlsmühle kurz vor Merzalben. In 35 min gehen wir auf einer Wanderroute zur
Ruine Gräfenstein. Groß, mächtig, prächtig, ein Juwel aus der Stauferzeit,
1985/86 restauriert.
 Nach
dem Rückweg Fahrt nach Johanniskreuz, auch ein kleiner Ort auf einer Kuppe
umgeben von Wald, mit Hotel und Pension, mit dem supermodernen Haus der
Nachhaltigkeit. Nach der Besichtigung unsere Weiterfahrt nach Annweiler und
hinauf zum Parkplatz Ahlmühle. 40 min Fußweg sind es zur Kaiserburg Trifels,
auch ein Muss. Wurde ausgebaut zum Reichsehrenmal, ist seit 1966 teilweise
bewohnt. Wir durchstreifen die Räume: den Kaisersaal, die Burgkapelle mit
feinstem Gregorianikgesang aus dem Lautsprecher, die Schatzkammer mit den
Nachbildungen der Reichskleinodien, vom Turm der Panoramablick. Nach
dem Rückweg Fahrt nach Johanniskreuz, auch ein kleiner Ort auf einer Kuppe
umgeben von Wald, mit Hotel und Pension, mit dem supermodernen Haus der
Nachhaltigkeit. Nach der Besichtigung unsere Weiterfahrt nach Annweiler und
hinauf zum Parkplatz Ahlmühle. 40 min Fußweg sind es zur Kaiserburg Trifels,
auch ein Muss. Wurde ausgebaut zum Reichsehrenmal, ist seit 1966 teilweise
bewohnt. Wir durchstreifen die Räume: den Kaisersaal, die Burgkapelle mit
feinstem Gregorianikgesang aus dem Lautsprecher, die Schatzkammer mit den
Nachbildungen der Reichskleinodien, vom Turm der Panoramablick.
Nach einem Bummel durch das Zentrum von Annweiler Weiterfahrt nach Eschbach,
ein Weindorf in der Rheinebene. Auf Empfehlung des Wirtes am Neudahner Weiher
suchen wir den Hof von Bruno Wind auf. Um 18.30 Uhr nimmt sich die junge Frau
des 20 ha großen Weingutes die Zeit für eine Weinprobe, erzählt dabei völlig
ungeniert wie es geht mit vier Kindern, Haushalt und Betrieb, was ihre Kleinen
für unterschiedliche Interessen haben. Wir packen drei Karton Wein ins Auto, so
nebenbei sagt sie, wir könnten in ihrem Gästehaus übernachten. Das macht die
Oma, die fährt voraus, hat eine schöne Ferienwohnung frei
auch für eine Nacht mit ausgiebigem Frühstück, und einen Tipp für ein gutes
Lokal zum Abendessen. Schon sind wir bestens versorgt.
 7. Tag,
schön, bis 29°C. 7. Tag,
schön, bis 29°C.
Erstmal auf Fußweg im Laubwald in 30 min hinauf zur Madenburg. Die große
Anlage ist teilweise ausgebaut, öffnet aber erst um 10.30 Uhr. Wir besichtigen
von außen, haben einen tollen Blick auf die Rheinebene mit den Weinfeldern.
Heimfahrt:
Über Bad Bergzabern fahren wir nach Schweigen, umkreisen das Weintor, dann
hinein nach Frankreich zur Stadt Wissembourg. Die historische Altstadt war eng
verbunden mit den Burgen, die wir besucht haben. Wir bummeln zum gotischen Dom,
dann die Einkehr in einem Cafè.
Auf Landstraßen kommen wir über Lembach
und Achern zur Schwarzwald-Hochstraße. Sehr schöne Fahrt auf dem Höhenzug
Richtung Süden, fahren über Freudenstadt, Alpirsbach nach Schramberg, hier
Stadtbummel. Dann am Bodensee entlang bei schönster Abendstimmung, bei Gohren
wollen wir nahe am See zelten. O weh, der riesengroße Campingplatz hat zwar eine
freie Wiese für uns, aber weit ab vom See. Da gehen wir zu Fuß hin, der
Segelhafen hier hat auch ein
unvorstellbares Ausmaß, immerhin grenzt der Campingplatz an den See mit
gepflegtem Kiesufer.
8. Tag, schön und sehr warm.
Die Weiterfahrt über Reute ist Routine, Bummel in Lindau, Rast in Oberjoch,
Einkauf in Lermoos, um 12.30 Uhr sind wir zuhause in Garmisch. Räumen das Auto
aus, gleich wird gewaschen, gesäubert, verstaut und gerechnet, die Ausgaben sind
960 €
geteilt durch 2 Personen, der Tacho im Auto zeigt 1130 km.
Es war eine gelungene Reise bei gutem Wetter.
Fotos: Hans Diem
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
39 - Dezember 2012
Ein ganzer Jakobsweg in zwei Tagen
September
2009: Vom Rhein an die Mosel
Von Wener Hohn
Dass Jakobswege nicht mehr zu den außergewöhnlichen Wanderwegen gehören,
dürfte dem nun schon seit Jahren anhaltenden Boom zu schulden sein. Aber der
hier ist außergewöhnlich, denn das ist überhaupt kein Jakobsweg, kein Camino,
keine „Via Irgendwas“. Der hier heißt nur Jakobsweg, weil der Eifelverein den
vor vielen Jahren so benannt hat, weit bevor der Boom eingesetzt hat. Jakobsweg
vermutlich, weil dieser Weitwanderweg teils über alte Handelsstraßen geführt
wird, von denen man annehmen kann, dass mittelalterliche Pilger auf ihrem Weg
nach Santiago darauf unterwegs waren. Eine gelbe Muschel, die internationale
Markierung aller Caminos,
sucht man jedenfalls vergeblich. Der heutige Weg fängt in
Bonn an und endet nach gut 115 km in Moselkern, welches, wie unschwer zu
erkennen ist, an der Mosel beheimatet ist.
Also, wer jetzt aus diesem Wanderbericht aussteigen will, weil ein
Pilgerbericht erwartet wird, sollte das tun, denn bei Licht betrachtet ist das
nur der Hauptwanderweg 1 (HWW 1) des Eifelvereins. Obwohl, zwischendurch bin ich
doch noch auf einem Camino gelandet. Das aber nur, weil ich mich an die alte
Route des Eifelvereins-Jakobswegs gehalten habe. Der ist nun auf einem Teilstück
verschwunden und hat dem „Eifel-Camino“ Platz gemacht.
Die Wanderung beginnt in Bonn, fast am Rheinufer, denn den eigentlichen
Startpunkt dieses Jakobswegs auf dem Bonner Venusberg habe ich gegen den Bahnhof
in Bonn-Mehlem ausgetauscht. Dort darf das Auto wegen kostenloser Parkplätze
eindeutig preiswerter auf die Rückkehr des Fahrers warten, und bei der Rückkehr
erspart das eine Stadtrundfahrt mit dem Bus.
1. Tag
Bonn – Bad Neuenahr - Brohltal – Maria Laach – Hütte bei Ettringen : 60
Kilometer
Sonntagsbrötchen. Spionage e.V. Rentnerleben. Das Brohltal mit
Anhang.
10.932 v. Christus.
Mit Schwung biegt der silberfarbene Familien-Van südkoreanischer Fertigung
auf den Parkplatz vor der Bäckerei ab, wo er mit kaum merkbaren Nicken zum
Stehen kommt. Behände schwingt sich ein Mitvierziger im Jogginganzug, weißen
Socken und Badelatschen vom Fahrersitz, nimmt Kurs auf die offenstehende
Ladentür und reiht sich in die Warteschlange vor der Verkaufstheke ein, in deren
spiegelblank geputzten Glasscheiben schon mehrere Jogginganzüge ein buntes
Stelldichein abhalten. Am Sonntagmorgen, so sieht es aus, ist Vati für frische
Brötchen und die „Bild am Sonntag“ zuständig. So fängt meine Wanderung in den
Bonner Vororten an. Ein sonntäglich ereignisloses Bild, wie es sonntäglicher
nicht sein könnte.
Während andere für Brötchen und die „Bild“ anstehen, mache ich mich auf den
Weg nach oben, auf die Rheinhöhen. Ungefähr dorthin wo der linksrheinische
Rheinhöhenweg seinen Weg nach Süden aufnimmt oder in den Bonner Vororten
aushaucht. Es dauert keine halbe Stunde, dann bin ich oben im Drachenfelser
Ländchen, das trotz des Namens nicht die Burg auf dem Drachenfels beherbergt.
Die ist auf der anderen Rheinseite, von wo sie als kaum wahrnehmbarer Zacken im
Morgendunst nur schwer auszumachen ist. Über Straßen muss ich weiter bis Berkum,
hinter dessen Ortsgrenze der von Norden kommende Jakobsweg
verläuft, der in den südlichen Vororten Bonns seinen Anfang nimmt.
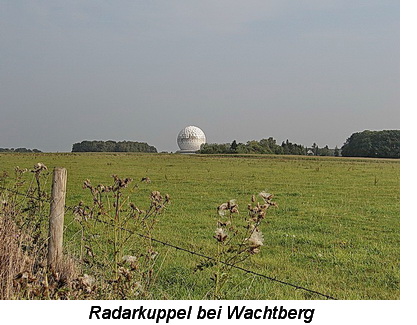 Zwischen
Berkum, korrekt Wachtberg-Berkum, und Werthoven steht eine große Kugel. Umwoben
von Gerüchten hat man sich nicht die Mühe gemacht, diese große Kugel hinter
Bäumen zu verstecken. Warum auch! In der Kugel steckt nur eine Radaranlage, die
der Sicherheitsforschung dienen soll. Früher war hier die „FGAN
(Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften e.V.)“ untergebracht,
die als Verein für meine Sicherheit gesorgt hat. Es lebe die deutsche
Vereinsmeierei! Im Jahr '09 hat die Fraunhofer Gesellschaft das Vereinsleben
abgewürgt, denn die betreiben ernsthafte Forschung – selbstverständlich
Verteidigungs- und Sicherheitsforschung. Zwischen
Berkum, korrekt Wachtberg-Berkum, und Werthoven steht eine große Kugel. Umwoben
von Gerüchten hat man sich nicht die Mühe gemacht, diese große Kugel hinter
Bäumen zu verstecken. Warum auch! In der Kugel steckt nur eine Radaranlage, die
der Sicherheitsforschung dienen soll. Früher war hier die „FGAN
(Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften e.V.)“ untergebracht,
die als Verein für meine Sicherheit gesorgt hat. Es lebe die deutsche
Vereinsmeierei! Im Jahr '09 hat die Fraunhofer Gesellschaft das Vereinsleben
abgewürgt, denn die betreiben ernsthafte Forschung – selbstverständlich
Verteidigungs- und Sicherheitsforschung.
Von wegen Spionage- und Abhöreinrichtung für den BND, MAD, CIA, Mossad oder
gar die legendenumwobene NSA! Die Wissenschaftler hier schauen nur nach
Weltraumschrott und ähnlichem. Trotzdem, ein kleines informatives Schild, eine
klare Erkennung, wer denn nun der Betreiber ist, und schon würde ich mich etwas
wohler fühlen. Vorsichtshalber unterlasse ich das Pinkeln gegen denn hohen
Gitterzaun. Wer weiß schon so genau, wo die Aufnahmen der Überwachungskameras
wieder auftauchen.
Zwischen Obstbäumen, beinahe durchweg Apfelbäume, die wiederum fast immer
durch hohe Drahtzäune vor der dem Zugriff hier sicherlich organisiert
auftretenden Apfelklaubanden geschützt werden müssen, wechsele ich vom
Drachenfelser Ländchen in „die Grafschaft“, einem aus lang vergessener
Kommunalreform entsprungenen Kunstgebilde, das an den Rotweinhängen der Ahr dann
auch Einhalt findet.
 Mittags
bin ich im Rentnerparadies Bad Neuenahr. Die Tische und Stühle der Straßencafés
sind da schon bis zum letzten Stuhl besetzt. Zwischen einem Tisch mit alten
Damen und dem einer Großfamilie finde auch ich noch einen Platz an der Sonne.
Die alten Damen geben sich alle Mühe gängigen Klischees weiter Nahrung zu geben.
Einmal quer durch die Kuchenkarte, aber bitte mit Sahne. Die Mitbewohner des
Altersheims bekommen auch noch ihr Fett weg, und zum Schluss „Zahlen bitte, aber
getrennt!“, womit sie der weiblichen Bedienung osteuropäischer Herkunft
sichtlich keine Freude machen. Zeit für
den Aufbruch. Mittags
bin ich im Rentnerparadies Bad Neuenahr. Die Tische und Stühle der Straßencafés
sind da schon bis zum letzten Stuhl besetzt. Zwischen einem Tisch mit alten
Damen und dem einer Großfamilie finde auch ich noch einen Platz an der Sonne.
Die alten Damen geben sich alle Mühe gängigen Klischees weiter Nahrung zu geben.
Einmal quer durch die Kuchenkarte, aber bitte mit Sahne. Die Mitbewohner des
Altersheims bekommen auch noch ihr Fett weg, und zum Schluss „Zahlen bitte, aber
getrennt!“, womit sie der weiblichen Bedienung osteuropäischer Herkunft
sichtlich keine Freude machen. Zeit für
den Aufbruch.
Nach ereignislosem Auf und Ab durch die Wälder südlich der Kurstadt taucht
am Spätnachmittag die Burg Ohlbrück aus dem Dunst über dem Brohltal auf. Das
Brohltal ist wie immer: eigentlich völlig ereignislos, aber wie so oft, schon
wieder mit miserabler Markierung. Auch bei diesem Wanderweg durch das hier nur
wenig eingeschnittene Tal, bestätigt sich mein seit Jahren gepflegtes
(Vor)Urteil. Es ist nun mal so, dass ich mich noch bei jeder Wanderung im
Brohltal verfranzt habe. Egal, ob das Tal rauf, das Tal runter oder quer durch,
irgendwo hängt es immer.
Unterhalb eines mit Solaranlagen gespickten Hauses – und ohne diese,
sicherlich ein sehr schönes, modernes Gebäude – fällt mir zum Glück auf den
letzten Schritt die an einem verwitterten Zaunpfahl auf Halb Acht hängende und
hinter hohem Gras kaum auszumachende Markierung ins Auge. Huch, noch mal Glück
gehabt. So dicht, wie anderswo, ist die Markierung hier nicht.
In Wehr, zugegeben, dass ist nicht mehr Brohltal, aber doch fast, verlaufe
ich mich endgültig. Wahlplakate an jeder Straßenlaterne, dazu eine
Straßensanierung, schupps, schon ist die Markierung verschwunden. Trotzdem,
Maria Laach, das geplante heutige Etappenziel, kann man eigentlich nicht
verfehlen. Den Weg dorthin über die Felder kennen sogar eingefleischte
Autofahrer, denn Maria Laach ist immer einen Ausflug wert.
Vor 13.000 Jahren, der Homo sapiens hatte sich mal eben häuslich
eingerichtet, ist ihm der Laacher See um die Ohren geflogen. Genau genommen
nicht der See, der Hügel war’s. Das soll 10.932 vor der Geburt Christi gewesen
sein. Vielleicht ist das an einem Sonntagabend geschehen, an einem wie dem
heutigen. Über jenes Ereignis haben sich meine Vorfahren vermutlich geärgert, so
wie heute die Fachleute, wenn vom See oder Maar gesprochen wird. Der See ist
weder Fisch noch Fleisch, das is’ne Caldera. Wie auch immer: Unverkennbar hat
sich in dem „Loch“ Wasser gesammelt und sieht heute doch
arg nach See aus.
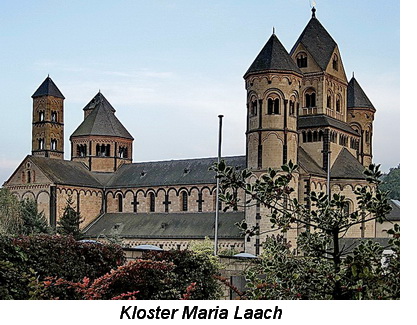 Für
die Katholische Kirche war der Vulkanausbruch ein Glücksfall. Denn gut 12.000
Jahre später hat Heinrich II. von Laach ein Gelübde abgelegt und ein Kloster am
Seeufer spendiert. Das war 1093 nach Christus. 900 Jahre später kam Napoleon
vorbei (im übertragenen Sinne) und hat es der Kirche weggenommen. Gut 90 Jahre
später war die Katholische Kirche wieder dran. Das Kloster ist sofort zur Abtei
befördert worden, und die Besitzer sind seitdem Benediktinermönche. Und hier
setzt der monetäre Glücksfall für die Kirche ein. 12.970 Jahre nach dem
Vulkanausbruch verzeichnet die Abtei 2.000.000 Besucher pro Jahr, die zurzeit
1,50 fürs Parken zahlen müssen und fürs Pinkeln 50 Cent
zahlen sollen. Wer knapp bei
Kasse ist, muss nicht verzagen, ein Geldautomat bietet Beistand. Für
die Katholische Kirche war der Vulkanausbruch ein Glücksfall. Denn gut 12.000
Jahre später hat Heinrich II. von Laach ein Gelübde abgelegt und ein Kloster am
Seeufer spendiert. Das war 1093 nach Christus. 900 Jahre später kam Napoleon
vorbei (im übertragenen Sinne) und hat es der Kirche weggenommen. Gut 90 Jahre
später war die Katholische Kirche wieder dran. Das Kloster ist sofort zur Abtei
befördert worden, und die Besitzer sind seitdem Benediktinermönche. Und hier
setzt der monetäre Glücksfall für die Kirche ein. 12.970 Jahre nach dem
Vulkanausbruch verzeichnet die Abtei 2.000.000 Besucher pro Jahr, die zurzeit
1,50 fürs Parken zahlen müssen und fürs Pinkeln 50 Cent
zahlen sollen. Wer knapp bei
Kasse ist, muss nicht verzagen, ein Geldautomat bietet Beistand.
Aber die Gärtnerei ist wirklich toll, die Buchhandlung ansehnlich, die
Kirche noch viel mehr und die Wanderung rund um den See kostet auch nichts.
Leider ist auf dem 8 km langen Seerundweg an schönen Wochenenden mehr Volk
anzutreffen als in allen Kirchen der Region zusammen.
Als ich im Kloster ankomme wird es dicht gemacht. Im Buchladen werden die
Verkaufsständer weggeschlossen, der Hofladen auf dem Parkplatz ist auch zu, das
Restaurant schon ein paar Minuten länger. Auf die Abtei Maria Laach hatte ich
gesetzt. Hier wollte ich meine Wasserflasche auffüllen und mir dann eine Hütte
im Wald suchen. Das sieht nun schlecht aus. Alles dicht und meine leere Flasche
passt nicht unter den modernen Wasserhahn auf dem Besucherklo.
 Und
nun? Ins zur Abtei gehörende Seehotel mit 4 Sternen, oder ins Naturfreundehaus
Richtung Autobahn? Im Seehotel werde ich arm und das Naturfreundehaus ist dann
doch etwas zu weit weg vom Schuss. Und
nun? Ins zur Abtei gehörende Seehotel mit 4 Sternen, oder ins Naturfreundehaus
Richtung Autobahn? Im Seehotel werde ich arm und das Naturfreundehaus ist dann
doch etwas zu weit weg vom Schuss.
Nicht ganz 2 Stunden später lande ich in der Wetterschutzhütte am Hochstein,
einem Hügel kurz vor Ettringen. Das Getränkeproblem hat sich in Bell in Luft
aufgelöst. Den ersten gedachten Schlafplatz am schattigen Erlenbrunnen habe ich
wegen Stechmücken, feuchter Wiese und ungemütlicher Hütte sausen lassen. Eine
Viertelstunde später ist es stockfinster im Wald. Mit einer lichtschwachen
LED-Stirnlampe stolpere ich über Waldwege, verlaufe mich, muss zurück,
vergleiche nun an jeder Wegkreuzung geahnte Realität mit der gesicherten
Wirklichkeit der Wanderkarte und endlich, als ich es schon nicht mehr glauben
wollte, taucht die im Funzellicht eben noch wahrnehmbare Hütte auf.
Ausgestreckt auf dem schmalen
Sitzbrett, verspricht die Nacht ungemütlich zu werden.
2. Tag
Hütte bei Ettringen – Mayen – Monreal – Burg Pyrmont – Burg Eltz –
Moselkern: 44 Kilometer
Montags in der Früh. Auf dem Camino. Kein Wasser in Monreal.
Die Mutter aller Burgen.
 Im
Wald ist es noch stockduster, als ich mich auf den Weg mache. Unbedingt brauche
ich einen Kaffee, den hoffe ich in Ettringen zu bekommen. Fehlanzeige. In
Ettringen hat die Woche noch nicht angefangen. Dann eben Mayen. Die Stadt macht
es dem Kaff nach. Noch ist alles dicht. Ich muss etwas warten, bis eine
Bäckereiverkäuferin sich bequemt und die Ladentür aufschließt, und mir mit einer
Kanne Kaffee ins Leben hilft. Dieser Montagmorgen in der Provinz bremst mich
aus. Im
Wald ist es noch stockduster, als ich mich auf den Weg mache. Unbedingt brauche
ich einen Kaffee, den hoffe ich in Ettringen zu bekommen. Fehlanzeige. In
Ettringen hat die Woche noch nicht angefangen. Dann eben Mayen. Die Stadt macht
es dem Kaff nach. Noch ist alles dicht. Ich muss etwas warten, bis eine
Bäckereiverkäuferin sich bequemt und die Ladentür aufschließt, und mir mit einer
Kanne Kaffee ins Leben hilft. Dieser Montagmorgen in der Provinz bremst mich
aus.
Immer noch bin ich viel zu früh dran. Weitergehen möchte ich nicht, denn auf
den nächsten 40 Kilometern ist Mayen der letzte Ort in dem ich Essen kaufen
kann. Dann kommt nur noch Monreal, dort gibt es nichts als Kneipen und Cafés.
Hinter Monreal kommt für Stunden nichts, wenn, dann nur abseits des Eltztals,
was mit Umwegen verbunden wäre. Die Zeit lässt sich ebenso gut in Mayen
verplempern. Es wird dann doch später als gehofft, bis ich mich auf den Weg
machen kann.
 Wettertechnisch
führt der Montag das fort, was der Sonntag begonnen hat. Sonnig, warm und
diesig, so dass ich froh bin, Mayen den Rücken zukehren zu können. Von Mayen
nach Monreal muss ich vom Jakobsweg runter. Der Eifelverein hat vor nicht allzu
langer Zeit die Wegführung geändert, damit keiner mehr durch die Stadt muss.
Schade, sollen Wanderer verhungern? Und so toll ist die neue Strecke bis Monreal
nun auch wieder nicht. Wald, nichts als Wald. Wettertechnisch
führt der Montag das fort, was der Sonntag begonnen hat. Sonnig, warm und
diesig, so dass ich froh bin, Mayen den Rücken zukehren zu können. Von Mayen
nach Monreal muss ich vom Jakobsweg runter. Der Eifelverein hat vor nicht allzu
langer Zeit die Wegführung geändert, damit keiner mehr durch die Stadt muss.
Schade, sollen Wanderer verhungern? Und so toll ist die neue Strecke bis Monreal
nun auch wieder nicht. Wald, nichts als Wald.
In meinen alten Wanderkarten nimmt der Jakobsweg noch den direkten und
schöneren Weg nach Monreal. Den Platz des Jakobsweges hat jetzt ein Pilgerweg
übernommen. Der Eifel-Camino hat den Jakobsweg verdrängt, oder ist in die sich
auftuende Bresche gesprungen. Es ist immer wieder erstaunlich, woher diese Wege
plötzlich kommen. Plötzlich ist auch genug Geld da, für Markierungsarbeiten, für
Farbe, für Wegweiser, ja, sogar für steinerne Stelen. Wie dem auch sei, dieser
Camino (welch Wort für einen Weg in Deutschland) ist besser markiert als der
Jakobsweg des Eifelvereins
und so stehe ich eine Stunde vor Mittag in Monreal am Friedhof.
Nein, Geschäfte gibt es hier schon lange nicht mehr, nur Kneipen und Cafés,
bestätigt ein alter Mann, der das Grab seiner Frau besucht. Gut, dann werde ich
vermutlich mal wieder gegen eine Friedhofsordnung verstoßen und Wasser
zweckentfremden, indem ich es in meine Trinkflasche abfülle.
 Monreal
ist der Traum vieler, meiner nicht. Orte, die sich in enge Täler quetschen,
können mit noch so vielen Fachwerkhäusern, steinernen Bogenbrücken,
Kopfsteinpflastergassen und Burgen ausge-stattet sein wie nur irgend möglich.
Ich brauche Licht und Sonne, Aussicht und Weitsicht. Zweifellos ist Monreal
schön und malerisch gelegen und alle paar Jahre immer wieder einen Besuch wert,
aber wohnen möchte ich da auf keinen Fall. Monreal
ist der Traum vieler, meiner nicht. Orte, die sich in enge Täler quetschen,
können mit noch so vielen Fachwerkhäusern, steinernen Bogenbrücken,
Kopfsteinpflastergassen und Burgen ausge-stattet sein wie nur irgend möglich.
Ich brauche Licht und Sonne, Aussicht und Weitsicht. Zweifellos ist Monreal
schön und malerisch gelegen und alle paar Jahre immer wieder einen Besuch wert,
aber wohnen möchte ich da auf keinen Fall.
Danach fängt die lange Durststrecke an. Bis runter an die Mosel sind es 33
Kilometer, davon bestimmt 25 über Trampelpfade und schmale Wege. Am Weg gibt es
nur einen Weiler aus 5 Häusern, einen Campingplatz, ein Gasthaus (montags zu)
und zwei Burgen. Weil es schon auf Mittag zugeht, bedeutet das für mich ohne
Pause durchgehen. Einen sauberen Zulauf zur Elz muss ich auch finden, damit ich
nicht verdurste.
 Spät
dran, um heute noch bis an die Mosel zu gelangen, meint dann auch der Bauer,
dessen Hof ich kurz nach Monreal überqueren muss. Das könnte stimmen, überlege
ich mir beim Blick in die zwei noch verbleibenden Karten. Der Elzbach schlängelt
sich ganz schön. Spät
dran, um heute noch bis an die Mosel zu gelangen, meint dann auch der Bauer,
dessen Hof ich kurz nach Monreal überqueren muss. Das könnte stimmen, überlege
ich mir beim Blick in die zwei noch verbleibenden Karten. Der Elzbach schlängelt
sich ganz schön.
Die Strecke durch das Tal ist einsam, niemand ist mir begegnet, als ich auf
die Klosterruine 'Mädburg' treffe.
Es stehen nur noch die Grundmauern. Etwas weiter zurück, leicht erhöht, steht
eine kleine weiße Rundkapelle von einer Felswand. Drumherum vereinzelte Kreuze
aus schwarzen Basaltstein, die an Menschen aus lang vergangenen Zeiten erinnern.
Früher sollen hier Einsiedler gelebt haben. Heute ist das schwer vorstellbar.
Jetzt steht ein Dixi-Klo vor der mittelalterlichen Klosterruine und versaut mir
das Foto.
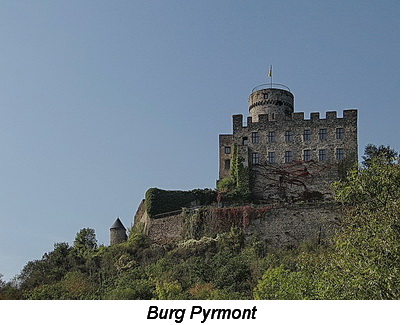 Danach
fängt für mich die Rechnerei an. Bei jedem Schild mit Kilometerangabe
überschlage ich die mir verbleibende Zeit. Die Besichtigung der Burg Pyrmont
muss ich sausen lassen. Was kein kultureller Beinbruch ist, denn die kenne ich
zur Genüge. Hinten raus passt es sonst nicht mehr. Als ich an der Pyrmonter
Mühle der alten Markierung folge, die im Nirgendwo endet, bin ich froh um diese
Entscheidung, denn das hat Zeit gekostet. Danach
fängt für mich die Rechnerei an. Bei jedem Schild mit Kilometerangabe
überschlage ich die mir verbleibende Zeit. Die Besichtigung der Burg Pyrmont
muss ich sausen lassen. Was kein kultureller Beinbruch ist, denn die kenne ich
zur Genüge. Hinten raus passt es sonst nicht mehr. Als ich an der Pyrmonter
Mühle der alten Markierung folge, die im Nirgendwo endet, bin ich froh um diese
Entscheidung, denn das hat Zeit gekostet.
Es kann nur
eine geben und das ist Burg Eltz. Da kommt keine Marksburg, keine
Hohenzollernburg oder eine Was-weiß-ich-Burg mit. Die Burg Eltz ist die Burg
meiner Kindheit, und das ist die Burg, zu der man im fortgeschritten Alter an
einem Sonntag fährt, wenn einem sonst nichts einfällt. Eine Gemeinsamkeit mit
Maria Laach. Zu dieser Burg wurde ich als Kind von meinen Eltern und als Schüler
von meinen Lehrern verschleppt. Später habe ich dann meine Kinder zur Burg
verschleppt, viel später dann sogar meinen Enkel. Ich bin alleine über den
Moselhöhenweg aus beiden Richtungen dorthin gelaufen. Einmal auch das ganze
Elztal runter. Ein Kumpel musste auch dran
glauben, meine Frau, sogar ein
ehemaliger Arbeitgeber. Der weiß das allerdings bis heute nicht. Das war vor
Jahren im Frühling. Ich hatte noch jede Menge Zeit und der Lkw war leer. Da habe
ich den am letzten Haus von Moselkern, einem Hotel, abgestellt und bin gemütlich
zur Burg und wieder zurück gewandert. 2 Stunden bei voller Lohnfortzahlung.
Selten hat mir die Arbeit so viel Freude gemacht.
 Nun
bin ich schon wieder da. Es ist später geworden als meine Überschlagsrechnungen
hoffen ließen. Von der Burg ist der Lärm eines Presslufthammers zu hören, eine
Seite ist eingerüstet und mit Planen verhangen. Klar, die Saison ist gelaufen,
nun stehen Renovierungen an. Einige englische Familien mit Kleinkindern sind um
die späte Tageszeit unter den letzten Besuchern. Gemeinsam halten wir die
Gastronomie noch für eine halbe Stunde am Leben. Dann wird es Zeit. Die
Engländer haben nur einen halben Kilometer bis zum Bus oben auf dem Parkplatz
und ich noch
eine Stunde bis an die Mosel. Dass ich am Bahnhof eine volle Stunde auf den Zug
warten muss, kann ich da noch nicht wissen. Nun
bin ich schon wieder da. Es ist später geworden als meine Überschlagsrechnungen
hoffen ließen. Von der Burg ist der Lärm eines Presslufthammers zu hören, eine
Seite ist eingerüstet und mit Planen verhangen. Klar, die Saison ist gelaufen,
nun stehen Renovierungen an. Einige englische Familien mit Kleinkindern sind um
die späte Tageszeit unter den letzten Besuchern. Gemeinsam halten wir die
Gastronomie noch für eine halbe Stunde am Leben. Dann wird es Zeit. Die
Engländer haben nur einen halben Kilometer bis zum Bus oben auf dem Parkplatz
und ich noch
eine Stunde bis an die Mosel. Dass ich am Bahnhof eine volle Stunde auf den Zug
warten muss, kann ich da noch nicht wissen.
Idiotisch?
Und wie! Aber eine schöne Form der Idiotie. 110 Kilometer in 2 Tagen ist nicht
nur Sport, das ist was fürs Ego. Es ist ein geiles Gefühl, nach nur 2 Tagen
unten am Moselufer zu sitzen und sich den Weg, den Raum den man durchquert hat,
in Erinnerung zu rufen. Es macht mir den Kopf frei, wenn man die eigenen
Messlatten anlegt. Und unglaublich befriedigend ist es sowieso. Nicht zu
vergessen: man wird schließlich nicht jünger. Die Zeit, die mir für diese Form
des Weitwanderns bleibt, bemisst sich schließlich nicht mehr nach Jahrzehnten.
Davon abgesehen, womit soll ich den alten Damen im
Altersheim, in dem ich sicher landen werde, auf die Nerven gehen? Etwa mit
Erzählungen über meine alltägliche Wanderungen?
Sicherlich lässt sich das auch in 5 oder
sogar 6 Tagen machen. Dieser Zeitrahmen ist sogar empfehlenswert, denn dann
bleibt sogar Zeit für die sehenswerten Burgen und Orte am Weg. Aber das ist
meine Heimat, wenn auch die etwas weitere. Das kenne ich alles. Da kann man
schon mal aus einer Wochenwanderung eine 2-Tages-Wanderung machen.
Alles für diesen Jakobsweg (HWW 1) hat der
www.eifelverein.de
Erschienen in "Wege und Ziele"
Zeitschrift des Vereins
Netzwerk Weitwandern e.V. Ausgabe
40 - April 2013
Europ
Alpen
A AL AND
B
BG BIH BY
CH
CY
CZ
D
DK
E
EST
F FIN FL
GB
GR
H
HR
I
IRL IS
L LT LV M MC MD
MK MNE
N
NL P
PL
RO RSM RUS
S
SK
SLO
SRB
TR
UKR V
| ![]()